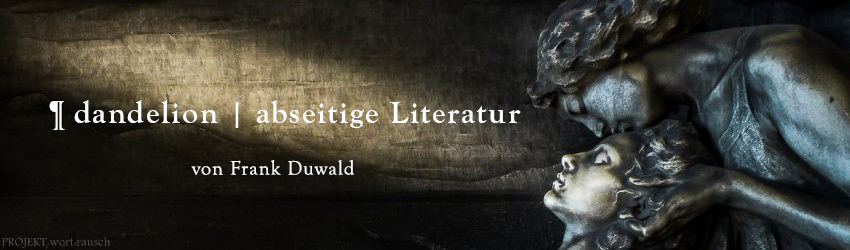Originalveröffentlichung:
Olivia (1949, geschrieben 1933)
Wie erschreckend dünn manchmal der Grat zwischen einem Klassiker und einem vergessenen unveröffentlichten Manuskript sein kann, lässt sich anhand von Olivia nachvollziehen, dem einzigen Roman von Dorothy Strachey. Als Dorothy Strachey das Buch 1933 im Alter von achtundsechzig auf Französisch schrieb, war ihr wohl schon klar, dass ihr Name zu Lebzeiten niemals Literaturgeschichte schreiben würde, verbot sie doch später selbst ihrem guten Freund, dem Dichter André Gide, der das Buch als Erster las, jemals jemandem zu erzählen, dass sie die Autorin sei. So waren die Zeiten.
Dabei war Gidé 1933 gar nicht erbaut von dem Roman und hätte ihn mit seinen negativen Bemerkungen fast vernichtet. Es dauerte daraufhin fünfzehn Jahre, bis Strachey das Manuskript erneut in die Hände nahm und Gefallen daran fand. Mit Unterstützung von Roger Martin du Gard übersetzte sie Olivia ins Englische. 1949, Strachey war jetzt dreiundachtzig, wurde die Version anonym als „Olivia von Olivia“ von der Hogarth Press veröffentlicht. Dorothy Strachey hatte offensichtlich jegliche Eitelkeit, als Autorin eines brillanten Buches gefeiert zu werden, abgelegt. Wie schön wäre es gewesen, zu Lebzeiten die Anerkennung zu erhalten, die sie verdient gehabt hätte. Ihr einziger Fehler war, sich nicht an die Spielregeln gehalten zu haben, nach denen Sexualität in Literatur abzuarbeiten war.
Für uns soll das keine Rolle mehr spielen, denn mit der Rettung von Olivia dürfen wir dem Schatz der großen Literatur eine der melancholisch-schönsten Liebesgeschichten hinzufügen. Erstaunlich ist die Dimensionstiefe, die man dem schmalen Roman zunächst nicht zutraut. Olivia ist in erster Instanz ein Buch, das gnadenlos die emotionale Struktur des Lesers angreift und sich erst bei wiederholtem Lesen als architektonisch ausgeklügeltes Kunstwerk entpuppt. Beginnt der Roman wie eine pubertäre Mädchengeschichte, so schleichen sich nach und nach die ersten Anzeichen von Missgunst ein, die zielstrebig in einen Kriminalplot münden, um schließlich die Ausmaße einer klassischen Tragödie anzunehmen. Dabei schreibt Strachey immer mit leichter Hand, in einer wunderschönen Sprache. Und das Ergebnis ist eine todtraurige Ballade, die aber für den Leser niemals niederschmetternd oder gar deprimierend ist.
Die Engländerin Olivia erzählt in Rückschau als erwachsene Frau über sich als junges Mädchen, „einem romantischen, sentimentalen Kind.“ Mit sechzehn wird sie von ihren Eltern an das französische Mädchenpensionat Les Avons geschickt, das von der charismatischen Mlle Julie und ihrer Partnerin Mlle Cara geführt wird. Wie Literaturwissenschaftler lokalisiert haben, ist der Handlungszeitpunkt irgendwo in den 1880er-Jahren anzusetzen.
Olivia weiß, was es heißt, in dem Korsett einer wohlhabenden viktorianischen Familie aufgewachsen und erzogen worden zu sein. Trotzdem hat sie sich eine Freundlichkeit und Natürlichkeit bewahrt, die ihr sofort die Sympathien der anderen Schülerinnen sichert. Mlle Julie bevorzugt Olivia deutlich, doch das scheint keines der anderen Mädchen zu stören. Les Avons scheint bis dahin eine Idylle aus Gelehrsamkeit und Kultur zu sein, doch schon bald schleichen sich erste falsche Töne ein. Die Mlles Julie und Cara scheinen zerstritten zu sein und die Schülerinnen in zwei Lager gespalten zu haben, die Julisten und die Caristen.
Olivia hat sich schnell entschieden, denn sie verliebt sich in die viel ältere Mlle Julie. Diese hält ihre Rolle als Olivias Schulleiterin zwar weitgehend aufrecht, aber es entsteht trotzdem eine spürbar sexuelle Anziehung zwischen den beiden. Für Olivia bedeutet es das sexuelle Erwachen, und auch Mlle Julie scheint nicht frei von Gelüsten sein, wenn sie Olivia ins Ohr flüstert, dass sie sie nachts besuchen werde, um ihr „etwas Gutes“ zu bringen. Offenbar in letzter Sekunde ändert sie ihren Plan. Um Olivia vor sich zu schützen? Ein mögliches Bekenntnis Mlle Julies ist auch, wenn sie auf Französisch (im Text nicht übersetzt) etwa sagt: „Ich mag dich, mein Kind.“ Und noch anschließt: „Mehr als du denkst.“ (Übersetzung von mir)
Es verbietet sich, mehr über die Handlung zu erzählen, aber es passiert noch einiges. Und ein Rätsel muss gelöst werden. Die Erzählerin Olivia teilt uns mit, dass sie die Lösung irgendwo im Geschilderten spürt, sie sie aber letztlich nicht findet. Eine Herausforderung für den Leser.
Und das ist das Besondere an Olivia: Alles Bedeutungsvolle liegt unter der Oberfläche, im Nichtgesagten.
Aus den weisen Gedanken der Erzählerin geht hervor, dass sie sich nach Les Avons, „fürs Leben verletzt“, nie mehr der Liebe zu einer Frau stellen konnte. Wenngleich ihre „‘Schwärmerei‘ kein Spaß war“, erahnt sie „etwas irgendwie Beschämendes, zutiefst zu Verbergendes“, was ihr Zeit ihres Lebens „jede literarische Betätigung untersagt hat“, da man nicht schreiben könne, „ohne die Seele zu entblößen.“
Dorothy Strachey hat, wenn auch spät, definitiv ihre Seele entblößt.
Deutsche Übersetzung: Olivia, übersetzt von Stefanie Neumann (Wien: Zsolnay, 1950)
Lektorat: Uwe Voehl