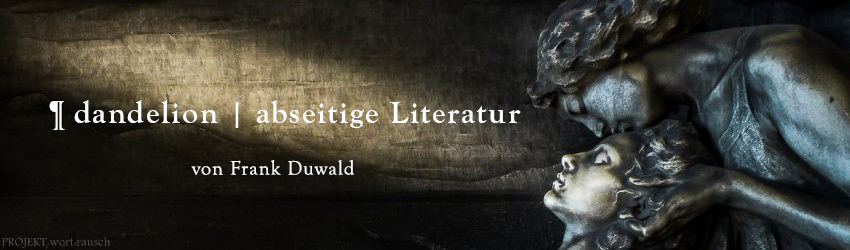Originalveröffentlichung:
The House of the Seven Gables (1851)

Im Gewand einer stimmungsvollen, sehr leisen Schauergeschichte umarmt Nathaniel Hawthorne voller Wärme die Ehrbaren, feiert die Liebe und verdammt mit abgründigem Abscheu die eigennützigen Blender.
Warum neigen wir eigentlich so oft dazu, das lange Vergangene als überholt und das Aktuelle als das Definitive anzusehen? Ist es die Überheblichkeit der Moderne oder schlicht eine Art multiples Vergessen?
Nathaniel Hawthornes dritten Roman The House of the Seven Gables [Das Haus mit den sieben Giebeln] aus dem Jahre 1851 zu lesen, ist ein wenig so, wie sich an etwas lange Vergessenes wieder zu erinnern. The House of the Seven Gables ist ein verblüffendes Beispiel dafür, wie ein alter Meister uns die beinahe ausgestorbene Kunst des stimmungskeimenden Erzählens vorführt. Er ist dabei aber nicht etwa einer, der ein großes Feuerwerk abbrennt, sondern eher ein empfindsamer Magier, der nahezu unsichtbar seine Zauberfunken ins Publikum versprüht.
Das Fundament, auf dem The House of the Seven Gables errichtet wurde, ist denkbar schwergewichtig, denn Hawthorne leuchtet kein geringeres Thema als die Erbsünde aus. Diese findet im historischen ersten Kapitel statt, dass uns nach Hawthornes Vorgängerroman The Scarlett Letter [Der scharlachrote Buchstabe] erneut ins 17. Jahrhundert, dem puritanischen Zeitalter der amerikanischen Hexenprozesse führt. Der angesehene Oberst Pyncheon bringt den unbedeutenden Matthew Maule wegen Hexerei an den Galgen, weil er scharf auf Maules Land ist. Mit seinem letzten Atemzug sagt Maule über Pyncheon: “Gott wird ihm Blut zu trinken geben!“ Oberst Pyncheon lässt auf dem neugewonnenen Stück Erde das Haus des Titels erbauen. Er und seine Nachkommen sollen nicht viel Freude daran haben.
Nachdem Hawthorne also sein Buch mit Hilfe dieser Legende mit Pauken und Trompeten eingeläutet hat, lässt er sich in einer Zeit nieder, die in etwa seiner eigenen Gegenwart entspricht und schrumpft den Rahmen auf ein Minimum zusammen, um mit der eigentlichen Geschichte zu beginnen, die denkbar leise daherkommt.
Zum Entstehungszeitpunkt von The House of the Seven Gables war der klassische Schauerroman schon seit Dekaden totgeritten. Trotzdem grast Hawthorne den Kramladen der gothic novel ab und nimmt alles an Topoi mit, was er gebrauchen kann: ein von Verfall gezeichnetes gotisches Haus, das von einer großen Ulme verfinstert wird; einen Familienfluch; einen geheimen Raum; ein düsteres Gemälde; die Machtausübung des Mannes über die Frau. Das kennen wir alles. Aber nicht, was Hawthorne daraus macht.
Viel von dem Glanz des einstigen Hauses mit den sieben Giebeln ist nicht mehr übrig geblieben. Im Haus ist alles von Verfall und Moder gekennzeichnet, und nur noch die alte Jungfer Hebzibah Pyncheon lebt hier, sofern man ihr Dahinvegetieren Leben nennen kann. Als Lady erzogen, kann sie längst nicht mehr aus ihrer steifen Rolle heraus. Obwohl sie nicht mehr tiefer sinken kann, hält sie sich mit imaginären Adelsparolen aufrecht. Von dem immer noch an der Wand hängenden unangenehmen Gemälde des Obersten Pnycheon lässt sie sich Tag für Tag an ihre wohlhabende Herkunft erinnern. Ihr äußeres Erscheinen wird als heruntergekommen und verbiestert beschrieben. Kontakt zur Außenwelt hat sie nur noch zu dem ihr wohlgesonnenen “Lumpenphilosophen“ Onkel Venner, der die Häuser der Stadt nach Essensresten für sein Schwein abgrast und von einem Lebensabend ohne Arbeiten träumt.
Dass Hepzibah aber noch tiefer sinken kann, stellt sie fest, als sie, um sich ernähren zu können, einen Tante-Emma-Laden eröffnet. Der Kontakt zu den wenigen Kunden ist ein Gräuel für sie, und dementsprechend schlecht läuft der Laden dann auch. Trostloser kann man ein Leben wohl nicht fristen.
Das ändert sich aber schlagartig, als eines Tages Hepzibahs junge Cousine Phoebe auftaucht und einen Schwall Sonne mit ins Haus bringt. Hawthorne liebt es, mit den Gegensätzen Licht und Dunkelheit zu spielen und setzt hier sehr bewusst auf kraftvolle Metaphern. Phoebe ist die unverdorbene Eva, die offensichtlich nicht ohne Grund in diesem heruntergekommenen Eden wie aus dem Nichts auftaucht. Ihr Erscheinen bewirkt eine erste Wende im Haus mit den sieben Giebeln. Die Misanthropin Hepzibah muss sich eingestehen, dass ihr das lebensfrohe Wesen Phoebes guttut, und das nicht nur, weil Phoebe Hepzibahs Hausladen zum Erfolg führt.
Neue Dunkelheit kehrt jedoch mit dem Erscheinen von Hepzibahs Bruder Clifford ein, den ein jahrzehntelanges Trauma heimsucht, das ihn zu einem gebrochenen alten Mann mit dem zeitweiligen Verstand eines Kindes gemacht hat. Auch ihn verzaubert Phoebe mit ihrer lebensbejahenden Art. Zusammen mit einem Untermieter, dem Protestkünstler Holgrave, bildet der bunte Haufen eine Kommune der Verlierer, dessen zaghaftes Zusammenwachsen in der Not Hawthorne mit unglaublicher Intensität zeichnet. Obwohl diese Menschen, mit Ausnahme Phoebes, derart tiefe Wunden davongetragen haben, dass sie eigentlich nie mehr menschlicher Nähe trauen dürften, führt Phoebe unbewusst alles zusammen. So sagt Onkel Venner nicht grundlos: “Es ist unbegreiflich, wie manche Leute einem so selbstverständlich werden können wie der eigene Atem […]“.
In einer Schlüsselszene zwischen Phoebe und Holgrave wirft Hawthorne alles in die allegorische Waagschale und lässt stark romantisierende Bilder deutlicher sprechen als es die beiden tun. Die Zeit scheint angehalten, und in einem stillen Mikroversum treffen Adam und Eva aufeinander. In diesem spirituellen Szenario gewinnt Holgrave die absolute Kontrolle über die Frau, die er liebt – und widersteht im zerbrechlichsten Augenblick des Buches zugunsten dieser Liebe der Verführung, Phoebe für immer zu unterjochen.
Diese Momente voller Harmonie gehören in all dem Odem der sündenverseuchten Vergangenheit zu den bewegendsten Szenen des Buches, die zudem sehr deutlich zeigen, dass Hawthornes Herz für die Gestrauchelten schlägt. Hawthorne hält zu den kleinen Leuten und hat nur Abscheu übrig für eine “erbärmliche Seele“ wie dem Richter Pyncheon.
Denn dieser Verwandte Hepzibahs, Cliffords und Phoebes, dieses Prachtexemplar von einem Manipulator, stolziert jetzt ins Haus der sieben Giebel, um den dunklen Schlund der Vergangenheit erneut aufzureißen und Clifford und Hepzibah endgültig zu vernichten.
Nathaniel Hawthorne prangt wie ein Steinriese über seinem schwierigen Stoff, den er jedoch zu jeder Zeit fest im Griff hat. Virtuos lenkt er seine in einer wunderschönen Sprache erzählte Geschichte sowohl durch die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele als auch die paradiesischen Momente, die Menschen durchaus zu erschaffen in der Lage sind. Man kann die subtile, eher angedeutete Art und Weise, wie er die Geheimnisse des Romans lüftet, nur vorbildlich und The House of the Seven Gables ohne Zweifel ein Meisterwerk nennen.
Und hoch darüber breitet Hawthorne seine tröstenden Arme aus und outet sich als großer Humanist, der den Ehrlichen ihre Menschenwürde zurück gibt.
Empfehlenswerte deutsche Übersetzung: Das Haus mit den sieben Giebeln, übersetzt von Irma Wehrli (Zürich: Manesse, 2014)