Rauch: Ja, natürlich. Heute dominiert der Typus des gendersensiblen Bücklings, der sich nicht ins Leben hineinwagt, weil dort zuviele Gefahren lauern. Und weil man zu viel falsch machen kann in dem Versuch, sich auszurichten an den Meinungs- und Haltungsvorgaben des inquisitorischen Umfelds. Ich wünschte mir manchmal, daß ein Kerl wie Arno Rink durch die Ateliers der Kunmststudenten gehen würden, um die jungen Männer zu ermuntern, daß es doch nicht schlimm ist, wenn man sich von weiblichen Körperformen angeregt fühlt. Man muß sich nicht nur angeregt fühlen von Blockseminaren zum gendersensiblen Sprachgebrauch. Das Leben ist schön, genießt es, möchte Arno Rink den Studenten dann zurufen. Seine Bilder weisen den Weg des genußfähigen Mannes weit in die Zukunft hinein. Heute werden Minderheiten zu Mehrheiten stilisiert, an deren Bedürfnislagen wir uns auszurichten haben, sofern wir nicht mit der Brandmarke des Sexismus oder Chauvinismus ausgestattet werden wollen. Das ist ein Zustand, der nicht hinnehmbar ist auf Dauer, und gar nicht für die Kunst.
[Arbeitswohnung, 7.29 Uhr
Martinů, Polní Mše]
Bin ganz vernarrt in >>>> dieses Stück und höre es seit gestern nacht zum fünften Mal hintereinander. Nicht daß ich es nicht schon früher mal angehört hätte, die Vinylplatte habe ich mir bereits vor Jahrzehnten in Prag gekauft; aber nie fand es wirklich in mich hinein. Vielleicht brauchen wir auch für das Verständnis einer Musik ein gewisses (ungewisses) Alter. Jetzt langt diese Komposition für mich, wiewohl sehr viel kürzer, fast an Brittens War Requiem heran.
Und ich war verdutzt. Mir hatte Ana, meines Freundes Broßmann Gefährtin, die ich Anoui nenne, >>>> zur Berliner Meere-Lesung einen Umschlag auf den Vortragstisch gelegt, mit einem roten Bänderl umwunden. >>>> Dort, liebste Freundin, habe ich es Ihnen schon erzählt, nicht aber, was sich darin befand. Es waren frische rote Chilischoten und eine ZEIT-Seite, auf der ein Interview mit Neo Rauch abgedruckt war.
Sein Name ließ mich Abstand nehmen, die Seite verschwand unter dem Arbeitsstapel links von mir. Ich hege, wie ich Anoui sagte, mit der ich gestern wieder ins Gespräch kam, bei gehypten Leuten einen Generalverdacht und nehme mir die Zeit lieber für Künstler wie >>>> Christopher Ecker oder >>>> Marcus Braun, zumal ich von gegenständlicher Malerei meist nicht berührt werde.
Nun bekam ich aber ein schlechtes Gewissen. „’tschuldigung, ich lese es jetzt gleich, dann melde ich mich wieder.”
Und also war ich baff. So sehr, daß ich, siehe oben, aus diesem Interview zitiere – mehr als erlaubt zitiere. Doch wenn man mich verklagen will, nun jà, dann hätte ich einen Kontakt, der sich möglicherweise vertiefen würde. Anoui, merci.
Aus dem Tief von gestern wieder raus, auch weil es ein schönes Gespräch mit der Contessa gab, die gestern in Venedig landete. „Wenn Sie Zeit finden, setzen Sie auf jeden Fall zur Giudecca über!” Eine Stunde später kam die, wenn Sie so wollen, Antwort: „Nicht zu fassen, da liegt mein Hotel!” So daß wir über die Stadt etwas spachen, die nach Paris den Platz meines jugendmännlichen Sehnsuchtsortes eingenommen hatte, bevor dann Sizilien kam, und Neapel. Es liegen hier noch Skizzen zu „venezianischen Erzählungen” herum, die ich aber verwarf, nachdem besonders Thomas Hettche die Stadt >>>> für seine Literatur entdeckte. Ich mochte und mag nach wie vor nicht einfach nirgendwo nachklappen.
Was beruhigt mich eigentlich so, wenn ich Messen und Requien höre? Je älter ich werde, desto stärker wird dies. Von wenigen, etwa denen >>>> Petterssons abgesehen, sind Sinfonien für mich in den Hintergrund gerückt, denen ich als junger Mann leidenschaftlich anhing. Heute stört mich nicht selten ihr fetziges Getöse oder sagen wir die Monumentalorchestrierung. Dies ändert sich erst mit den neuen Versuchen der Moderne, etwa hier:
Beethovens halt ich schon gar nicht mehr aus, abgesehen von der Sechsten. Auch Mahler ist unterdessen betroffen, außer der VI, VII, IX und der nachgelassenen X, besonders in Barshais Komplettierung.
>>>> Robert Pfaller spricht von einer Unkultur des sich Gestörtfühlens. Wann immer sich jemand behelligt meint – im öffentlichen Raum, wohlgemerkt –, wird nach Ordnungsregularien gerufen, anstelle daß wir begreifen, bestimmte „Dinge” auch einfach mal aushalten zu müssen. Ich renne ja auch nicht gleich zur Polizei, wenn mir permanent Pop um die Ohren gehauen wird, wenn sie mir damit zugestopft und völlig verklebt werden, sowie ich nur meine Wohnung verlasse. Wie still unsere Welt, todesstill, sie ohne das würde! Oder nur noch maschinenzerlärmt.
Ich finde es skandalös, daß Frauen nach wie vor schlechter als Männer bezahlt werden, für die gleiche oder sogar bessere Arbeit, die sie leisten; ich finde es ebenfalls skandalös, daß immer noch signifikant weniger Frauen an leitenden Positionen stehen; aber daß einer Frau männliches Begehren ausgedrückt wird, sei es durch nur Blicke, sei es durch Pfiffe, das haben sie auszuhalten. Im einen und/oder anderen Fall wird es ihnen lästig sein, ja, aber ein wirklicher Übergriff ist dies noch nicht. Ich meinerseits hatte sogar schon die ziemlich bestimmt fordernde Hand einer Frau, die ich nicht kannte, auf der Arschbacke, ohne daß mich dieses Erlebnis gleich traumatisiert hätte. Frauen und Männer sind einander Geschlechtsobjekte, ich bin’s ihnen auch. Es ist schlichtweg Biologie – noch. Möglicherweise werden wir uns, dann gänzlich replikant, nur noch aus Petrischalen zeugen.
Bei der Biologie bleibt es aber doch auch gar nicht. Meine Güte, Freundin, schauen Sie sich die Kunstgeschichten an.
Mit der Löwin sprach ich gestern drüber. Ja, unsere Kultur ist patriarchal einseitig, noch immer. Nicht das Verbot des Begehrens kann aber helfen, besser wäre, wie ich’s in indischen Tempeln sah, eine bildnerisch-künstlerische Aufladung des Phallus, in diesem Fall mal nicht durch Homosexuelle, sondern Frauen selbst. Gab es auch schon, in den Achtzigern. Eine kurze Zeit lang. Auch Männer sind Objekte. Unsere gesamte Wissenschaft ist aus Subjekt zu Objekt bezogen. Wo eins ist, kann kein anderes sein; wir sprechen von Objektivität als dem Fundament von Wahrheit. Die Medizin beruht darauf, sogar unsere Rechtsprechung.
Und, aber! welche Formen! Auf >>>> der Messe, von >>>> Arco kurz nur um die Ecke, gab es einen Stand, der einen Bildband bereithielt voller Mösen: Pussy Parade. Komisch, selbst ich, bevor ich ihn aufschlug, lugte nach rechts und nach links, ob mich jemand bemerkte… Das ärgerte mich. Wie kann ich nur so verkniffen sein!
Prägungen, ihr könnt mich mal! Sie kommen nicht aus Selbstbestimmung.
Also schauen.
Oh du Niqab von Sais!
Mein erster Gedanke war: Was würden Frauen fühlen, die ihr Intimstes derart abgebildet sähen? Mein zweiter: Was fühlte ich, wäre es ein Bildband voller Schwänze – und eben nicht in der Schwulenabteilung? Wäre als Mann derart ich vorgeführt? – Na jà, dachte ich, ich würde denken, „halt Schwänze”, und wäre nicht berührt.
Dann faszinierte mich etwas anderes: zum einen die Homomorphität, die aber zum anderen auf einer atemberaubenden Vielfalt beruht; nicht eine Möse glich der anderen und war doch jeder andren gleich. Vielgestalt des Identischen, irre. Ich verstehe Maler gut, die daran wahnsinnig werden.
Aber mehr noch! Die Formen selbst finden sich überall wieder: besonders in Blüten. Die stehen auch bei schüchternen Menschen ganz offen auf dem Tisch. Ja, sehen die denn nicht?
Überhaupt sind Pflanzen, dachte ich, die raffiniertesten Sublimationsobjekte, die wir Menschen kennen. Ihr zutiefst Anrüchiges wird einfach nicht bemerkt, schlicht, weil sie anders riechen: da liegt ja der Ursprung des Anruchs. Man riecht ihm etwas an, und ihr sowieso. Die Ruchspur des Begehrens kriecht bis zum Nacken hoch.
Pheromone.
Aber auch hier jetzt, Freundin, keinen Fehlschluß! Denn egal, ob es sie gibt: Wenn wir uns frei fühlen, handeln wir anders, als fühlten wir uns nicht frei. Die Realitätskraft der Fiktionen.
Welch ein Feuerwerk der Gedanken dieser Band in mir auslöste! Dabei gefielen mir die meisten Bilder gar nicht, teils weil zu ordinär oder nuttig, teils weil zu trashig. Also blieb die Erektion völlig aus, die er vielleicht bewirken soll. „Ich hätte”, sagte die Löwin, „vielleicht ein paar Bilder abfotografiert. um aufgrund dieser Vorlagen etwas Eigenes zu formen.” Über welche Bemerkung ich seltsamerweise nicht die Spur irritiert war; sie ist ja Kuratorin, nicht Künstlerin. In Wien, Sie wissen, Freundin, schon. Kann es sein, daß sie, wie manche Literaturkritiker, es eigentlich nicht nur selbst gern wäre, sondern heimlich ist? Ich werd sie fragen müssen.
„Pussy Parade” – allein der Titel kotzt mich an. Das Buch aber deshalb verbieten? Ganz sicher, liebste Freundin, nicht.
In Manhatten, vor Jahren, wurde ich mal verhaftet… na jà, fast verhaftet, weil ich geflirtet hatte, jemanden angeflirtet. Sanft, ich gehörte nie zu Pfeifern und Tatschern. Es genügte aber schon, um mich dem Polizisten erklären zu müssen. – Er ließ mich schließlich laufen. Für >>>> die Béart habe ich ein Gedicht aus dem Vorfall geformt. „Heute dominiert der Typus des gendersensiblen Bücklings, der sich nicht ins Leben hineinwagt, weil dort zuviele Gefahren lauern. Das ist ein Zustand, der nicht hinnehmbar ist auf Dauer, und gar nicht für die Kunst.”
wir wahrhaft letzten Menschen vor dem Aeropag
Der Große Replikant reicht uns die Hand, daß wir sie
küssen, was wir verweigern als Jünger Deiner linken Brust,
die Du, Béart, ihm angriffsfrei geblößt hast, uns als Standarte
Béart, >>>> VII
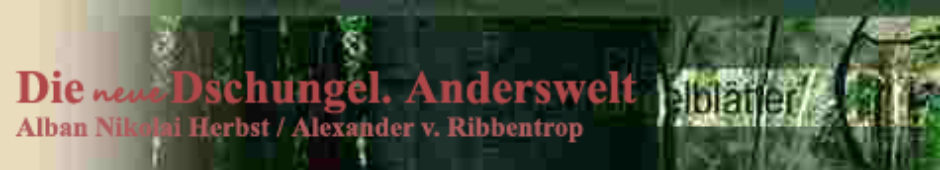




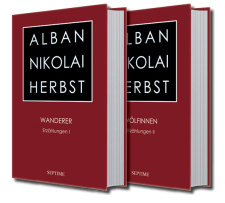

Ja, genau so! Ich hege seit schon einiger Zeit ähnliche Gedanken und habe Notizen in der Lade. Schon vor Jahren wurde mir beim Abbilden von Tatsachen seitens Frauen „Misogynität“ vorgeworfen. Ausgerechnet mir, dem kleinen staunenden Jungen, stets voll von positiver Bewunderung für´s göttlich Geschlechtliche. Und bei Ausstellungen meiner Bildwerke beobachte ich zunehmend ein ängstlich verklemmtes Wegschauen, sollte sich Nacktheit oder Klischee dort befinden. Ich bin gespannt, wie das alles weitergeht. Und ob es endet.
Das hängt, Herr schneck, davon ab, ob wir uns die Spiele nehmen lassen, die sich eben auch, und erst einmal, im Bicken ausdrücken. Es hat einen Grund, daß ich den angeblich veralteten Begriff des Flirtens so gerne verwende. Darüber hinaus gibt es, und muß es geben, auch die Verführung – die ja ein vorhergegangenes Nein voraussetzt; sonst wäre es keine. Die Correctness streicht sie durch und macht sie justitiabel. Es ist dies sogar schon „gelungen“.
Es hängt aber besonders auch davon ab, ob sich die-Frauen-selbst die Spiele nehmen lassen.
Eine komplett von Rücksichtsnormen durchregulierte Welt ist – auch und gerade, wenn diese Normen gerecht sein wollen – die unfreieste aller und damit die am wenigsten menschliche.
Na ja, der Witz daran ist ja, wir halten das ja alles aus, eben, es ist viel mehr, als mancher Mann aushalten muss. Ich kann mich nicht erinnern, einem Mann nachts in der S-Bahn halbbesoffen hinterhergesabbert zu haben: Mäuschen, Du hast n geilen Arsch, setz Dich mal zu mir. Flirten geht irgendwie anders und das ist schlicht die Demonstration von: Ich kann mir das herausnehmen, ich bin ein Mann, das gehört zu meinem Verhaltensrepertoire und wird nicht geahndet und letztlich wollt ihr geilen Pussys das doch so, gebt’s doch zu. Und ich denke, geh nach Hause armer in Deiner Gesellschaftsrolle degradierter Typ, der eigentlich nur mal gerade wieder einen unter sich sucht, mit dem er meint umspringen zu können, wie er will, so wie mit dir meist umgesprungen wird. Hat mit Flirten für mich nix zu tun, ist schlicht Belästigung. Mag ja sein, dass einige auch drauf stehen, andere finden ja auch ok, beim Sex geschlagen zu werden, oder beziehen Lust daraus, heißt aber nicht, dass es allen so geht, und alle anderen regeln ihre Fetische ja auch im Einvernehmen mit denen, die auch auf so etwas stehen, also, wo ist das Problem, sich öffentlich zurückzunehmen. Gerade öffentlicher Raum ist für Frauen, die allein in ihm unterwegs sind, ein völlig anderer Erfahrungsraum, als für Männer, und zwar meist einer, der zu Vermeidungshaltungen führt und die machen auf die Dauer Haltungsschäden. Warum wohl sonst verschleiert wohl eine ganze Kultur ihre Frauen, sie könnte ja auch stattdessen für Männer Ausgangssperren verhängen, wenn Frauen alle so geil machen, dass sich keiner mehr beherrschen kann. Und warum müssen keine Männer verhangen werden, ich kenne Friseure in Berlin, die dürften gar nicht mehr frei rumlaufen, kann mich aber nicht dran erinnern, dass ich sie darum mit Scheißsprüchen überhäufen müsste et al. Und die Kehrseite ist ja, wenn der geile Arsch dahin ist, was dann? Bin ich dann noch was wert? Das sind die zwei Seiten der selben Medaille und eine Béart hätte sich nicht so schrecklich chirurgisch zurichten lassen, wenn gerade sie nicht gespürt hätte, nein, ist sie nicht, sie ist nur was wert, wenn sie ewig schön bleibt und das in einem ganz und gar jugendlichen Sinn. Dass Frauen darauf immer weniger Bock haben, kann ich scho verstehen. Übrigens, Oskar Rink, die Tochter, macht die viel besseren Bilder, ich hätte mir beinahe mal einen Druck von ihr gekauft. Es ist wirklich so, ich will nicht immer kämpfen müssen, ich gehe Situationen aus dem Weg, wo ich denke, da lauert ne Scheißerfahrung, das Ergebnis davon, für Frauen gibts davon mehr, als für Männer, sie nehmen sich zurück, verschwinden, überlassen das Feld denen, die lauter krakeelen, kein Spaß, auch nicht für Männer, die diesen Rollenbildern nicht folgen wollen, aber meinen, das müssten sie irgendwie, als richtige Männer. Ich hatte nie Partner, die mich auch nur irgendwie gedemütigt hätten, sagt ja auch was.
@diadorim. Ich habe weder von „Scheißsprüchen“ noch sonstigen faktischen Übergriffen gesprochen, abgesehen davon, daß ich selbst mit Scheißsprüchen durchaus oft konfrontiert bin – Jugendlicher etwa, aber auch Alter, denen an mir was nicht paßt. Bisweilen kann das höchst aggressiv werden. Regulieren möchte ich es dennoch nicht, weil wir sonst eines Tages in imaginären Gittern leben. Wir sind schon drauf und dran. Und was die Béart anbelangt, so bringst Du hier mehrere Themen durcheinander. Was sie tat oder nicht tat, ist ihre Entscheidung; nehmen sich andere ein Beispiel daran, so deren. Daran den Flirtern schuld zu geben oder auch Jungs, die Mädels nachpfeifen, ist restlos bizarr. Ich werde mir zu flirten jedenfalls so wenig nehmen lassen, wie ein >>>> admirador zu sein und zu bleiben. Und Frauen werden für mich Geschlechtswesen weiterhin sein, wie eben auch ich eines bin. Beides werde ich keineswegs verstecken – wir landen nämlich sonst wieder im Sumpf der unzugegebenen Begehren. Außen hui, innen pfui, wie meine Großmutter zu sagen pflegte.
Der weibliche Körper – selbstverständlich nicht jeder – ist für mich ein Grundantrieb meiner Kunst, weil nämlich Eros es ist; wenn es für Frauen der männliche würde – auch da selbstverständlich nicht jeder -, sähe ich darin gar kein Problem, sondern eher eine lustvolle Erweiterung.
Ob Oskar, die Tochter, bessere Bilder macht als ihr Vater, weiß ich nicht zu entscheiden; es gibt ja auch Leute, die Spielberg für besser als Godard halten und Steven King für besser als Thomas Pynchon; insofern finde ich Deine Behauptung wenig weiterführend. Eine Frau mit Jungennamen findet allerdings mein Interesse.
(Übrigens war auch ich erschrocken und entsetzt, als ich sah, was die Béart sich angetan hat. Dennoch werde ich den Titel meines Gedichtzyklus‘ nicht verändern. Denn eine Imago ist gemeint. Die kann selbst sie nicht zerstören.)
Du sagst es ja selbst, Flirten ist das nicht, auch wenn einige es damit zu verwechseln scheinen, es ist einfaches Reviermarkieren, das besagen soll, ich hab hier das Sagen, in diesem Waggon des ÖPNV, am Set in Hollywood und es wird getan, was ich will, mehr nicht. Eros ist zudem ja auch für jeden, gemäß der eigenen Erlebnisse, etwas anders codiert. Es geht um Fragen des Respekts nicht zuletzt. Gomringers admirador bewundert ja breite Straßen, Blumen und Frauen und wird dabei selbst beobachtet, – ist Teil der Szenerie – ob von einer weiblichen Instanz, ist dabei nicht ausgeschlossen. Er ist eine Kunstfigur, eine sehr harmlose dazu, bei der man nicht mal weiß, was er an all dem bewundert, den Augenblick des (am Leben) Seins, so lese ich es, und keiner, der einem „du dumme Fotze“ hinterherbrüllt. Ich hab neulich zwei Jungs um die 12 Jahre hinter mir an der Supermarktkasse sich unterhalten hören. Da waren Begriffe wie Fotze und Bastard für einen der beiden so normal, dass es mich echt geärgert hat, mir schien, für den begleitenden Jungen war es auch unangenehm. Ich war drauf und dran, ihn zur Rede zu stellen, hab es aber gelassen und mich dann geärgert. Respekt und Eros schließen sich für mich nicht aus, die bedingen eher einander. Und natürlich macht bei allem auch der Ton und die Situation die Musik oder eben den Lärm. Was die Béart betrifft, sie hat einen Beruf, der sehr wohl davon abhängig ist, wie gut sie aussieht, ob da jede Entscheidung so freiwillig ist. Wenn Du als Frau gebucht und geliebt wirst, egal wie schluffig, alt und ungeliftet Du am Set erscheints, würdst Du es wahrscheinlich tun, Marlon Brando hat es so gehalten, vielleicht auch etwas gelitten unter der Verfettung, aber, so what, ihn behält die Nachwelt als großen Schauspieler, der er war. Tippi Hedrens Karriere soll vorbei gewesen sein, als sie Hitchcock einen Korb gab. Darum gehts ja dabei. Ich will nix verbieten, bestimmte Verhaltensweisen gesellschaftlich mehr ächten, kann allerdings nicht schaden. Und wenn man bedenkt, wie lange es Vergewaltigung in der Ehe nicht gegeben hat, nicht geben ‚durfte‘, fasst man sich ja auch an den Kopf. Und natürlich sind Jungen davon auch betroffen, von Übergriffen, sie stehen noch dazu in der Zwickmühle, ebenso ein blödes Rollenbild zu verkörperen, jedes sexuelle Angebot annehmen zu müssen, weil, nur darum geht es ihnen ja, was für ein Schwachsinn das alles. Ein verkorkstes Frauenbild bedingt ein verkorkstes Männerbild und vice versa, darum geht es doch, es für alle fairer zu gestalten.
Sah gerade ein Video zu Lotus feet, auch so ein Schönheitsideal gewesen, das chinesischen Frauen lebenslange Degenerationen und Schmerzen bereitet hat, was für ein Trauerspiel. Dann lieber keinen Männern mehr gefallen, wenn alles, was es bringt, doch nur Leiden sind. Es gibt ein sehr schönes Jazzstück, ein sehr trauriges, Lotus feet von Shakti und John Mclaughlin, oft gehört.
ad „gendersensibler Bückling“: Fand gerade einen >>>> klugen Text des Dilettanten dazu, der, wiewohl wir in der grundlegenden Angelegenheit durchaus einig sind, hier völlig anderer Meinung ist, als ich’s bin. Daß es nicht darum geht, die, von ihm völlig zurecht „Fläzereien“ genannt, Ungeheuerlichkeiten selbstbequemer und sich überhebender Männer nachträglich und weiterhin zu akzeptieren, scheint mir klar zu sein; viele davon waren und sind in der Tat unerträglich. Es dürfen aber das erotische Spiel und die Leichtigkeiten nicht verloren gehen; jedenfalls ich lasse sie mir nicht nehmen. Und wenn man mich noch tausendmal einen „Sexisten“ nennt.
@ das erotische Spiel brauchen wir unbedingt! Dennoch: es muss einvernehmlich und auf Augenhöhe (!) stattfinden, sonst sind dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Ich glaube wirklich nicht, dass unsere Positionen da so weit auseinander liegen, mein Augenmerk liegt jedoch darauf, dass Männern aufgrund ihres historisch lang eingeübten Dominanzverhaltens die Sensibilität für Augenhöhe und Einvernehmlichkeit größtenteils abhanden gekommen ist.
@dilettant. Nicht abhanden gekommen, sondern bis vor, sagen wir, fünfzig Jahren gab es sie schlichtweg nicht – von Ausnahmen abgesehen. Augenhöhe ist seither erst geworden.
Aber soweit einverstanden (also mit Ihnen gegen die fehlende, so von Ihnen genannte „Sensibilität“).
Jetzt aber fängt das Problem erst an, nämlich bei der Einvernehmlichkeit. Sie gerade auch juridisch vorauszusetzen, bedeutet, auf Verführung zu verzichten, die ein wie immer auch gespieltes „Nein“ doch voraussetzt, übrigens (und selbstverständlich) bei beiden Geschlechtern. Nach einem (dito: wie auch immer gespieltem) „Nein“ darf nun nicht länger werben, wer nicht zumindest eine Ordnungsstrafe riskieren will, etwa stalkinghalber. Diese Verdrahtung der mit ordnungspolizeilichen Warnschildern gespickten Umgangswege zerstört das erotische Spiel und also auch die Künste.
@Jetzt aber fängt das Problem erst an Diese Ihre Trauer darüber, dass sich etwas verändert, verstehe ich sehr gut. Aber bedenken Sie doch einmal, dass einerseits das Leben gefährlich i s t, und diese Gefährlichkeit sich nun eben auch auf das Verhalten des Mannes bezieht – (nebenbei bemerkt: ich denke, wir stimmen darin überein, dass heutzutage eine fatale Tendenz besteht, zu glauben, man könne dem Leben alles „Gefährliche“ nehmen), und andererseits man die historische Leistung doch anerkennen, ich würde sogar sagen: f e i e r n – muss, dass die Zeiten, in denen Frauen Freiwild waren, endlich vorbei sind. Zu „verführen“ ist ja im Grund wirklich schön, kaschierte aber in der Vergangenheit oft genug brutales Ausnutzen einer Macht, die Männern nun mal qua Gesellschaftsnorm gegeben war. Und wenn heutzutage ein mächtiger Studioboss einen Job zu vergeben hat, und eine junge Schauspielerin diesen Job haben möchte, sind schlicht aufgrund des Machtgefälles „Leichtigkeit“ und „erotisches Spiel“ nicht zu haben. Einem Therapeuten würde man auch kein Verhältnis zu seiner Klientin durchgehen lassen, oder einem Erzieher eines zu einem Schutzbefohlenen. Da freue ich mich doch erst einmal darüber, dass die Zeiten, in denen Männer hier freies „Spiel“ hatten, vorbei sind. Und diesseits dieser Extreme gibt es halt alles an Übergängen. Juristisch sind diese Millionen ganz individueller persönlicher Interaktionen nicht wirklich gerecht zu fassen. Da ist einfach ein Dilemma! Dieses Dilemma heißt: LEBEN (Übrigens möchte ich Ihnen zu diesem Thema den Blog der Dame von Welt ans Herz legen, die hierüber überaus informiert und klug schreibt: https://dvwelt.wordpress.com/ )
kaschieren@dilettant. Na klar tat es das, und es ist nicht zu entschuldigen. Aber unsere bisherigen Rechtsnormen reichen imgrunde deutlich hin; was Sie meinen, läuft unter „Ausnutzung Abhängiger“, ja sogar unter „Nötigung“. Das ist alles ohnedies schon strafjustitiabel. Hingegen immer weitere und weitere Gesetze dazuzuschaffen, führt in ein, letztlich, Gefängnis und ständige Angst. Es ist ohnedies bezeichnend, daß Ängste umso mehr zuzunehmen scheinen, je gesicherter die Menschen tatsächlich sind. Und Sie haben recht: Juristisch sind diese Millionen ganz individueller persönlicher Interaktionen nicht wirklich gerecht zu fassen. Genau deshalb wehre ich mich gegen Normierung – und werde mich weiter dagegen wehren. Es geht hier tatsächlich um Politik.
Nebenbei, wenn ich an die Reinigung der Werke etwa Mark Twains denke, wird auch noch Geschichtsklitterung betrieben. Es wird keine schnitzlerschen Zwischentöne mehr geben, Eineindeutigkeit – selbst nur erstrebte – ist wirklich das Ende von Kunst.
Es gibt Zumutungen, die wir auch aushalten können müssen, seien wir Frauen oder Männer. Ich selbst muß damit leben, daß ich täglich von Autofahrern gesundheitlich wahrscheinlich sogar nachhaltig geschädigt werde, obwohl ich so gut wie n u r Fahrrad fahre. In Kaufhäusern oder anderen Mall werde ich unterdessen quasi permanent von schlechter Musik vergiftet und muß hindurch in ständigem Ekel. Auf die Idee, dagegen Gesetze erlassen zu wollen, käme ich aber nie, obwohl auch diese Kaufhausmusi eine schwere Vergiftung darstellt – nicht am Körper, aber an der Seele. Wenn ich Freiheit will, muß ich sie (er)tragen.
(Der „Geschmack“ der meisten, die es vielleicht sogar schön finden, ist kein Gegenargument, denn Geschmäcker werden gemacht.)
Ich verstehe Dein Problem nicht so wirklich. Eine Frau, die Dir ausweicht, auch ohne ein Nein, die will nichts von Dir. Das ist, wie der Mann, der nicht anruft. Mein Narziss ist auch schon mal gekränkt, aber ich glaube, ich checke sehr schnell, wann Rückzug angesagt ist. Diese Idee des Werbens stimmt doch schon nicht, als säßen auf der einen Seite immer Frauen, die sich zieren würden und erst noch überredet werden müssten und auf der anderen Männer, die einfach nicht fähig sind, ihre Gefühle zu formulieren und sich darum nicht melden. Was es schon gibt, eine Art Vorratshaltung, kein Ja, aber man weiß ja nicht, wofür es noch mal gut ist, darin üben sich viele, aber auch das checkt man relativ leicht, in der Grauzone ist dann auch weniger Übergriff zu vermuten, bzw wäre es nur dann, wenn einer zu sehr insistierte, passiert aber meist nicht. Es gibt ja auch eine Art leerlaufendes Flirten, selbst in der Tierwelt, da wird das Verhaltensrepertoire selbst vor Tretbootschwänen abgespult, das dreht völlig frei, ohne reales Objekt. Das ist doch interessant und der eigentliche Knackpunkt dabei, meint das alles überhaupt die andere Person, nicht wenig Kränkung und Übergriff rührt ja daher, dass man kapiert, nö, tut es gar nicht, das genügt sich alles vollkommen selbst.
@diadorim zu den Schwänen. „Es“ meint in erster Linie den Prozeß, also naturhaft-konditioniert Prozessuales, für das das Objekt des Begehrens geradezu eine Allegorie ist.
Liebst du denn wirklich mich?,
und wie naiv die Klage,
Du siehst nur immer dich in mir –
Denn wer, Béart, bist du, bin ich?
Was einer ist und war,
erschöpft sich an dem Wir;
wie wir in uns selber sehen,
ist zu verstehen nur | als unser eigener Blick,
doch eines Fremdesten auf sich
wie eines Objektes im Innern
auf das Ich –
Béart XIV
Aber in Deinen Versen ist ja mehr als das naturhaft Prozessuale. Und nach der Allegorie, vielleicht das für Dichter naturhaft Prozessuale, muss ja auch noch was kommen, wenn es mehr als Dichtung sein oder werden soll. Dichtung war immer ein Mittel der Werbung, ganz klar, nur die Beworbenen wissen davon meist nix und das ist auch ziemlich gut so, denke ich nicht selten. Denn, das hast Du selbst erlebt, es wird ja nie so verstanden, wie man es gern hätte und schlimmstenfalls wird man noch verklagt. Ich denk nur ganz oft, hey, ich bin gerade wieder der Tretbootschwan, oder such mir selber einen, aber vielleicht ist man immer irgendwessen Tretbootschwan, weil jedes anfängliche Werben noch gar nicht wissen kann, um wen es da eigentlich wirbt. Das ist ja die eigentlich wichtige Phase, der Moment der Desillusionierung, den man ja gern versucht hinauszuzögern, deshalb ist das dichterische Werben ja so schön, da kann es ihn nie geben! Oder vielleicht auch doch, so z B:
Friedrich Schiller:
Bittschrift
Dumm ist mein Kopf und schwer wie Blei,
Die Tobakdose ledig,
Mein Magen leer – der Himmel sei
Dem Trauerspiele gnädig.
Ich kratze mit dem Federkiel
Auf dem gewalkten Lumpen;
Wer kann Empfindung und Gefühl
Aus hohlem Herzen pumpen?
Feuer soll ich gießen aufs Papier
Mit angefrornem Finger? –
O Phöbus hassest du Geschmier,
So wärm auch deine Sänger.
Die Wäsche klatscht vor meiner Tür,
Es scharrt die Küchenzofe;
Und mich – mich ruft das Flügeltier
Nach König Philipps Hofe.
Ich steige mutig auf das Roß
In wenigen Sekunden
Seh ich Madrid – am Königsschloß
Hab ich es angebunden.
Ich eile durch die Galerie
Und – siehe da! – belausche
Die junge Fürstin Eboli
In süßem Liebesrausche.
Jetzt sinkt sie an des Prinzen Brust,
Mit wonnevollem Schauer,
In ihren Augen Götterlust,
Doch in den seinen Trauer.
Schon ruft das schöne Weib Triumph,
Schon hör ich – Tod und Hölle!
Was hör ich? – einen nassen Strumpf
Geworfen in die Welle.
Und weg ist Traum und Feerei,
Prinzessin, Gott befohlen!
Der Teufel soll die Dichterei
Beim Hemderwaschen holen.
gegeben in unserm jammervollem Lager ohnweit dem Keller,
F.Schiller, Haus- und Wirtschafts-Dichter
@diadorim:
https://pbs.twimg.com/media/DNE6iUrXcAEJBBS.jpg
Und bitte, ich glaube nicht, dass das lediglich ein Einzelfall ist.
@gewitterbogen. Als Frau freilich auch.
(Auch für Männer kann es übel ausgehen, wie wir von Schülerinnen und Lehrern wissen.)
Ja, es gibt so eine Finte, den Ball zurückzuspielen, weil mans nicht gewesen sein will. Als Frau jemanden, der echt interessiert ist, zurückzuweisen, ist ja oft auch nicht so ohne, aber gut, hier hat die Frau nachgefragt. Ich vertraue allerdings darauf, dass wirkliches und dringendes Interesse beiderseits die Menschen schon zusammenführt. Und die, die es nicht zusammenführt, wenn keine anderen Gründe hindern wie verschollen auf einer einsamen Insel, im Koma etc, die haben meist auch nicht so ein dringendes Interesse aneinander, oder seh ich da was völlig falsch?
Und, meine Devise, glaub dem Handy und Kurznachrichten nicht, wem es wichtig ist, der ruft an. Gilt unter Schriftsteller*innen ganz besonders. walk talk write. Zuerst face to face, dann anrufen, dann schreiben. Beim Schreiben hält man immer noch Distanz und Türen für Missverständnisse offen. Ich vertraue auf das gute alte: wir müssen mal reden. Wenn ich mich selbst beobachte, wickel ich unangenehme und heikle Dinge auch lieber mit Emails ab, völlig falsche Strategie, bei allem, was echt brandwichtig ist, muss Stimme her. Es ist vielleicht die gute alte Kluft zwischen reden und handeln und dass handeln kein performatives Verb ist. Ich hab vor allem Autor*innen immer viel zu viel geglaubt, die begreifen ja schreiben und reden als Handlung, dann hab ich mir gesagt, ok, schau Dir an, was sie tun, kongruiert das mit ihren Aussagen und dann musste ich feststellen, in seltenen Fällen mal und dann habe ich sie nach ihren Taten beurteilt, da hatte ich dann schneller raus, wem ich wichtig bin.
Auf diesen Dialog der Kurznachrichten bezogen, beide lügen sich eins in die Tasche, hätte die Frau Interesse gehabt, hätte sie angerufen und der Mann auch. Das ist nur eine Art so tun als ob Spiel, auf beiden Seiten, weil vielleicht gerade etwas Zeit ist und man rührt da ein kleines Experiment an, das aber eigentlich keine Auswirkung haben soll, beide balzen einen Tretbootschwan an, so lese ich es. Es ist ihnen nicht ernst, es ist ein Probelauf für austauschbare Protagonist*innen.
@Ende der Kunst und @ schlechte Musik Spät, aber jetzt doch diese Antwort: Keine Ahnung, wie es um den Fortgang der Kunst bestellt ist. Ich weiß aber, dass Kunst sich regelmäßig auch g e g e n herrschende Tendenzen der Zeit zu der Größe emporschwang, derer sie fähig ist. Die von Ihnen – nicht zu Unrecht – benannten Tendenzen unserer Zeit bis hin zu Geschichtsklitterung (und da bin ich völlig Ihrer Meinung!) wären daher für mich auch dann kein Anlass, um die Kunst zu fürchten, wenn sie vollumfänglich zuträfen. Zum zweiten: Ihr Fahrradfahrender Lebensstil ist mir sehr sympathisch, ich pflege ihn selbst. Und störe mich, wie Sie, an Muzak in der Öffentlichkeit. Fatal finde ich allerdings eine gewisse Haltung, mit der Sie „schlechter“ Musik gegenübertreten. Wenn, wie Sie schreiben, Geschmäcker gemacht werden, dann eben auch der Ihre. Und, ohne das Vorhandensein von gewissen Qualitätsunterschieden in Abrede stellen zu wollen, ist es für mich Ausdruck schieren Bildungsdünkels, gesteigert zu Ressentiment, sich im Bewußtsein, die „richtige“ Musik zu hören, über die „falsche“, und damit auch über die Menschen, die sie hören, zu erheben. Wo genau soll denn die Trennlinie zwischen E und U, wie man das früher nannte, verlaufen? Als regelmäßiger Leser der Dschungel kenne ich Ihre Einstellung zum „Pop“, und habe mich bereits einmal über Adorno ausgelassen, der in diesem Zusammenhang gerne als Gewährsmann herangezogen wird. (Für den von Ihnen so geschätzten Benjamin Britten übrigens hatte Adorno nichts als Verachtung übrig. Woran man schon sieht, dass ein jeder / eine jede ihre/seine Schere zwischen U und E woanders ansetzt.) Ganz gegen eine sich hartnäckig haltende märchenhafte Erzählung von der ethischen Läuterung des Menschen durch die Segnungen der bürgerlich-humanistisch Bildung diente sie seit Aufkommen ihrer Praxis im 19. Jahrhundert ausschließlich den Machtansprüchen einer bürgerlichen Elite und deren Bedürnis nach Ressentiment und Ausgrenzung. Dass U-Musik, oder meinetwegen „Pop“, ein Vehikel zur Durchsetzung kapitalistischer Interessen ist, hat hier überhaupt keine Relevanz, denn auch die „Klassik“ und der Betrieb, innerhalb dessen sie sich ereignet, unterliegt völlig den Marktmechanismen des Kapitalismus. Während ich dies schreibe, spielt Glenn Gould das fünfte Klavierkonzert von Beethoven. Große Musik, ein begandeter Pianist, unabhängig gegen den Klassikbetrieb wie wenige und doch sehr populär bis hin zum „Mainstream“. Ich bin aber per se weder ein „besserer“ Mensch, noch leuchtet mir die Erkenntnis besonders hell ins traute Heim, weil ich diese Musik höre. Und ein Karajan hat seine Fans nicht minder „manipuliert“ als es wer auch immer hinter Helene Fischer steht tut. An der Kunst, so viel steht fest, wird die Welt nicht genesen – allen anders lautenden Märchen zum Trotz. Beste Grüße!