Das Zitat der Woche
.
.
Von der Übereinstimmung der Musik mit dem Leben
.
Was ist nötig, damit ein Lied zum Hit wird? Die oft aufgestellte These, es sei allein eine Sache der Vermarktung, ist ebenso falsch wie der Glaube, eine reine, von jeder kommerziellen Absicht losgelöste Kunst sei die Voraussetzung dafür. Beides kann, muss aber nicht sein.
Lässt man kurzlebige Popacts und One Hit Wonders aussen vor und betrachtet nur Künstler, die über Jahre und Jahrzehnte kontinuierlichen Erfolg hatten, zeichnen sich Erfolgsfaktoren ab, die sich bis zu einem gewissen Grad verallgemeinern lassen. So haben z. B. Udo Jürgens, Madonna, Tina Turner oder Joe Cocker eins gemeinsam: Image und Musik bilden eine glaubhafte Einheit und die Biografie enthält bewegende Schicksalsmomente, die für Schlagzeilen sorgen.Maximale Authenzität von Musik und Leben: Gitarren-Legende Jimi Hendrix (1942-1970)
Wenn Frank Sinatra oder Harald Juhnke trotzig singen «I Did It My Way», nimmt man ihnen das ab, weil sie gesellschaftliche Konventionen immer ausser Acht liessen und trotzdem Erfolg hatten. Herbert Grönemeyer gestatten wir, über den «Mensch(en)» als solchen zu singen, denn jemand, der bekanntermassen so viel durchgemacht hat, kann das wohl beurteilen. Die Rolling Stones füllen selbst nach rund 40 Jahren im Musikgeschäft immer noch die grossen Stadien der Welt, weil sie wie keine andere Band über so lange Zeit hinweg das Lebensmotto «Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll» verkörpert haben. Jede Falte im Gesicht von Keith Richards und jedes uneheliche Kind von Mick Jagger zertifizieren das Image. Janis Joplin, Jimi Hendrix und Jim Morrison personifizierten das Lebensgefühl der 60er Jahre «Live fast – die young» in geradezu tödlicher Perfektion. Bei ihnen stimmten Musik, Biografie und Image bis in den Tod überein. Im HipHop gehören Tupac Shakur und Notorious BIG zu den am meisten verehrten Personen, denn ihr Tod im Kugelhagel zementiert ihre Street Credibility als Homies. ▀
Aus: «Wert der Kreativität», in der Zeitschrift «Musik & Bildung» (Musikpädagogik), Schott Verlag 2004
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über die Musik als Glücksverstärker
Nicolai Petrat
.
Diese Behauptung wirkt auf den ersten Blick etwas banal, lohnt aber die genauere Reflexion, insbesondere dann, wenn es darum geht, weitere Hintergründe zur Entstehung von Glücksgefühlen zu recherchieren. Beginnen wir zunächst weit vorn, bei unserer stammesgeschichtlichen Entwicklung. Denkbar ist nämlich, dass Glücksmomente schon seit langer Zeit durch die Beschäftigung mit Musikalischem im weiteren Sinne erzeugt werden. Der britische Rockmusiker Sting geht davon aus, dass die allerersten von Menschen gesungenen Lieder dem Ausdruck von Freude dienten.
Heute kennt es jeder: Wenn wir «unser» positiv gestimmtes Lieblingsstück hören, sind wir nicht nur besser gelaunt, wir sind gleich fröhlicher und fühlen uns dynamischer. Dahinter stecken bestimmte neurologisch ablaufende Prozesse. Tatsächlich hängen das Erleben von Musik und die Bildung von Glücksgefühlen neurophysiologisch eng zusammen.
Neurowissenschaftler können es z.B. daran erkennen, wenn auf Gehirnscans beim Musikhören gerade Bereiche des Belohnungssystems, vor allem im limbischen System, gewissermaßen «aufleuchten», dort also verstärkte Aktivität zu erkennen ist.Was aber passiert, bevor akustische Nervenimpulse das limbische System erreichen? Grundlegende neuronale Aktivitäten, die im weiteren Sinne etwas mit musikalischer Wahrnehmungsverarbeitung zu tun haben, beginnen bereits im Hirnstamm, dem ältesten Teil unseres Gehirns. Vor allem rhythmische Anteile werden schon dort registriert, zwar nicht bewusst, aber so intensiv, dass sie früh auf von der Evolution festgelegte Schaltkreise unserer Hörbahn geschickt werden. Die an der akustischen Wahrnehmungsverarbeitung beteiligten Neuronenverbände sind von Natur aus darauf angelegt, bereits auf ersten Stationen der Hörbahn Regelmäßigkeiten und Ordnungen zu erkennen. Hier werden frühzeitig laute Reize, dumpfe, tiefe sowie dissonante Klänge registriert. Diese signalisieren den übrigen Arealen im Gehirn mögliche Gefahren und treiben den Herzschlag, Blutdruck und die Atemfrequenz in die Höhe, verändern die Muskelspannung. Dies führt zu Impulsen für Abwehr- und Fluchtreaktionen. Umgekehrt wirken langsame und regelmäßige Rhythmen beruhigend. Unser Gehirn interpretiert sie als Anzeichen für ungefährliche Situationen. Wir spüren dies als ein besonderes Wohlgefühl. Je nach Art der Musik werden unterschiedliche Hormone abgegeben: Adrenalin bei schneller und aggressiver Musik, Noradrenalin bei sanften und ruhigen Klängen. Letztere können sogar die Ausschüttung von Stresshormonen verringern. Der Nucleus accumbens wird aktiviert. Umgekehrt wird der sogenannte «Mandelkern» im Limbischen System, der insbesondere bei Stress aktiv ist, regelrecht abgeschaltet, wenn wir etwas Angenehmes empfinden, beispielsweise unsere Lieblingsmusik hören. Es entsteht Freude, unser Glücksempfinden wird stimuliert, eventuelle Ängste verschwinden zumindest vorübergehend. […]
Nicolai Petrat
Musik erfordert eine Wahrnehmungskunst, die auf die Verarbeitung des Moments angewiesen ist. Trotz der immensen Vielfalt an zu verarbeitenden Informationen geht unser Gehirn hier sehr effektiv an die Arbeit, einerseits durch besondere Mechanismen der Wahrnehmungsverarbeitung,andererseits dadurch, dass es dabei recht zuversichtlich, ja optimistisch vorgeht. Denn «die Natur“ hat unser Gehirn auch im Hinblick auf die Musikverarbeitung mit einer Art «Belohnungsspirale» ausgestattet. Auch für unser Musikgehirn gilt: Umso besser die Neuronenverbände und neuronalen Netzwerke zusammenarbeiten, desto lern- und leistungsfähiger wird unser Gehirn. Im besten Fall geraten die Verarbeitungsprozesse in eine intern organisierte Belohnungsspirale.
Das Besondere: Sobald Neurotransmitter wie Dopamin, Noradrenalin, Serotonin oder Endorphine mit ins Spiel kommen, werden umfangreichere musikspezifische Netzwerke aktiviert, manche werden erweitert, manche sogar neu gebildet. Ohne Transmitter kann unser Gehirn keine Informationen verarbeiten, auch keine musikalischen. Ohne sie ist eine Kommunikation im Gehirn nicht möglich. Sie sind wesentlich daran beteiligt, unsere funktionelle neuronale Architektur aufzubauen, in Gang zu setzen, optimal zu aktivieren. Durch sie wird der Aktionsradius erweitert, es werden auch weiter entfernte Areale aktiviert. Diese sorgen dafür, dass wir uns besser konzentrieren können und motivierter, zuversichtlich sind, ein gesetztes Ziel zu erreichen. Durch Neurotransmitter werden wir leistungsfähiger, flexibler, kreativer. Im besten Fall aktiviert das Gehirn das Belohnungszentrum, macht weitere Energie frei. Wir empfinden ein Glücksgefühl. Es wird ein Kreislauf in Gang gesetzt, der unser Gehirn auf Hochtouren bringt.
Gerade im Hinblick auf musikspezifische Verarbeitungsprozesse ist unser Gehirn stets auf der Suche nach positiven Zusammenhängen, gerät geradezu in Euphorie, wenn es hier etwas Positives registriert. Erst wenn die Belohnungsspirale angesprungen ist, können wir dorthin kommen, wo das Künstlerische beginnt. Besondere Fähigkeiten werden freigesetzt, auch künstlerische. Das gilt nicht nur für das Musikhören, sondern auch für das Instrumentalspiel. Es wird musikalisch bewegter. Musikalische Energie ist regelrecht herauszuhören. Erst dann erreichen wir die Sphäre, wo wir musikalisch geradezu über uns hinauswachsen. ♦
Aus: Nicolai Petrat: Glückliche Schüler musizieren besser! – Neurodidaktische Perspektiven und Wege zum effektiven Musikmachen, Wißner Verlag – Forum Musikpädagogik (Band 121) 2014, 164 Seiten, ISBN 978-3-89639-934-2
.
.
Essay über Bildung und Schule von Karin Afshar
.
Bildung heute – Spiegel innerer Besitzlosigkeit?
Dr. Karin Afshar
.
Schule, Lehrer, Lernen – das ist in aller, und wenn nicht in aller, dann doch in vieler Leute Munde, und ständig in den Medien. Zu recht? Etliche Lehrer schreiben offene Briefe über die Unerzogenheit von Schülern, Eltern sind aufgebracht gegen Lehrer und das restrukturierte und rerestrukturierte System, und Buchautoren analysieren die Bildungsmisere ebenso vehement wie Mediziner konstatieren, dass die Kinder Konzentrationsdefizite und Lernstörungen haben, ja sogar z.T. mit 10 Jahren auf dem emotionalen Stand von 16 Monate alten Kleinkindern stünden. Ich tue einen Stoßseufzer: bin ich froh, dass meine Kinder aus der Schule sind, und ich heute nicht mehr zur Schule gehe! Ich meine nicht nur als Schülerin, sondern auch als Lehrerin. Und trotzdem mache ich mir immer wieder Gedanken zu meinem Lieblingsthema: Lernen und Bildung. Auf den nächsten Seiten gibt es etwas dazu, was Lernen mit den Menschen und mit Bildung zu tun hat.
.
1. Vom Wesen des Lernens
Menschen lernen. Kinder lernen krabbeln, laufen, sprechen. Sie lernen, wie man mit der Schere ausschneidet, wie man sich an- und auszieht; sie lernen selbständig zu essen und zur Toilette zu gehen… Sie lernen im Kindergarten, in der Schule, in der Lehre, auf der Universität … so geht es immer weiter. «Lernen» ist Entwicklung. Jede Entwicklung hat unterschiedliche Stufen, deren jede genommen werden muss, bevor es zur nächst höheren Stufe geht.
Je nach entwicklungspsychologischer Schule (z.B. Jean Piaget) oder kognitionspsychologischer Schule (z.B. Jerome Bruner) werden die Phasen/Stufen der ersten Jahre unterschiedlich benannt, sagen jedoch in der Essenz: Die Entwicklung geht vom Einfachen zum Komplexen, und (hauptsächlich Piagets Prämisse): keine spätere Phase kann ohne die vollständige Erlangung der früheren erreicht werden.
Im Einzelnen – weil es wichtig ist, uns das Wesen des Lernens zu veranschaulichen – können die Stadien wie folgt charakterisiert werden:
Ein Stadium umfasst einen Zeitraum, in dem ein bestimmtes Schema in seiner Struktur begriffen und schließlich angewendet wird.
Beispiel: Zwischen dem 4. und dem 8. Lebensmonat entdeckt ein Kind, dass es durch eigene Aktivitäten bestimmte Effekte in der Umwelt hervorrufen kann. Es wirft die Rassel aus dem Kinderwagen – die Mutter wird sich bücken, und sie ihm wieder in die Hand geben.
Im Kind wächst die Fähigkeit zwischen einem gewünschten Ziel/einer erwünschten Reaktion und dem angewandten Mittel zur Erreichung des Ziels zu unterscheiden.
Jedes Stadium geht aus einem vorangegangenen hervor, bezieht das Gelernte ein und wendet es in anderen Zusammenhängen an.
Beispiel: Zwischen dem 8. und dem 12. Lebensmonat probiert das Kind aus, wie und womit es die Aufmerksamkeit von Personen erwecken kann. Es wirft den Gegenstand vielleicht nicht mehr weg, sondern macht Lärm mit ihm. Weiterhin werden die bereits vorhandenen Schemata immer besser koordiniert und somit Bewegungsabläufe flüssiger.
Die Stadien laufen immer in der gleichen Reihenfolge ab. Zwar kann es leichte kulturelle Unterschiede in der Auskleidung der Operationen geben, auch können sie verschieden schnell oder langsam durchlaufen werden – aber dass sie in geänderter Abfolge auftreten, ist nicht möglich.
Alle Kinder durchlaufen die Stadien. Bleibt ein Kind in einem Stadium stecken, handelt es sich um eine Entwicklungsverzögerung oder Retardierung.
Jedes Stadium schreitet vom Werden zum Sein.
Die Stufen im Einzelnen: der Stufe der Entwicklung der sensumotorischen Intelligenz (0 bis 1,6/2,0 Jahre) folgt die Stufe des symbolischen oder vorbegrifflichen Denkens (ca. 1,6/2,0 – 4,0 Jahre), dann kommt die Stufe des anschaulichen Denkens (4,0-7,0/8,0), gefolgt von der Stufe des konkret-operativen Denkens (7,0/8,0-11,0/12,0 Jahre) und der Stufe des formalen Denkens (ab dem 12. Lebensalter).
Beispiel: Der bekannteste Versuch von Piaget zeigt anschaulich die «logischen Irrtümer» der unter 7-Jährigen: Zeigen Sie Ihrem Kind ein breites Gefäß (vielleicht eine Brotdose) mit Wasser und schütten Sie das Wasser vor seinen Augen in ein hohes schmales Glas um. Zu Beginn der präoperationalen Phase wird Ihr Kind meinen, dass im Glas viel mehr Wasser ist, als in der Brotdose war. Erst mit einem Alter von ca. 7 Jahren «wissen» Kinder, dass die Flüssigkeitsmenge sich beim Umschütten nicht verändert.
Beispiel: Ab ca. 4 Jahren, in der intuitiven, anschaulichen Phase, vermindern sich zwar einige «logische Irrtümer», dennoch ist das Denken der Kinder stark egozentrisch, d.h. sie betrachten die Welt ausschließlich von ihrer Warte aus: Das Kind hat seine Ansicht und hält seine Ansicht für die einzig mögliche und somit auch für die einzig akzeptable. Ein egozentrisches Kind kann sich die Sichtweise anderer nicht zu eigen zu machen, denn Egozentrismus bedeutet nicht etwa Ichbezogenheit, sondern ganz einfach nur die Schwierigkeit, sich eine Sache oder aus einer anderen Sicht anzusehen oder sich in eine andere Person hineinzuversetzen. (Dieser Satz wird später noch wichtig werden!)
Beispiel (nach Mönks & Knoers 1996):
– Peter, hast du einen Bruder?
– Ja.
– Wie heißt denn dein Bruder?
– Hans.
– Hat Hans auch einen Bruder?
– Nein.
Alles Lernen ist ein stetiger Prozess, in dem der Lernende – in unserem Beispiel das Kind – immer wieder ein Gleichgewicht herzustellen versucht. Die Anpassung vorhandener Schemata an eine aktuelle Situation geht in zwei Teilprozessen vor sich: Assimilation und Akkommodation.
Beispiel: Ein Kind hat bereits gelernt, einen Apfel zum Mund zu führen, den Mund zu öffnen und ein Stück abzubeißen. Jetzt bekommt es eine Birne – und wird in sie hineinbeißen. Es erkennt Apfel und Birne als ähnlich.
Assimilation bedeutet die Eingliederung neuer Situationen oder Erlebnisse in ein bereits bestehendes Schema (um in der Begriffswelt von Piaget zu bleiben). Die Wahrnehmung der Ähnlichkeit von Apfel und Birne führt dazu, dass das Schema «grün-annähernd rund-essbar» an-gewendet, bestätigt und um ein neues Element erweitert wird. Assimilation ist die Reaktion auf eine Situation, die auf bereits in uns abgebildetes Wissen oder Erfahrungen trifft.
Beispiel: Ein anderes Kind versucht, in einen Plastikapfel zu beißen. Auch sein Schema sagt: «grün-apfelförmig-essbar». Von einem Plastikapfel aber kann es nichts abbeißen – das Kind muss akkommodieren und sein Schema insofern differenzieren, als echte Äpfel und unechte Äpfel verschiedene Kategorien bilden.
Akkommodation tritt auf den Plan, wenn die Assimilation nicht ausreicht, eine wahrgenommene Situation mit den vorhandenen Schemata zu bewältigen. Diese werden erweitert und angepasst. Akkommodation ist die Reaktion auf eine Situation, die noch nicht in uns abgebildet ist.
Ich könnte viele weitere Beispiele für die phantastische Leistung der kindlichen Entwicklungswege anbringen, möchte aber nun doch vom Entwickeln zum Lernen kommen. Lernen als Gegensatz zum Erwerb können wir am Beispiel von Sprechen und Sprachen betrachten:
Eine erste Sprache erwirbt jeder Mensch als Kind. Manche Kinder erwerben zwei oder drei Sprachen1) gleichzeitig. Von Erwerb spricht man, wenn das Aneignen «ungesteuert» und ohne Anleitung geschieht. Die Entwicklung der Kognition2) ist bei einem Kind noch nicht abgeschlossen, was bedeutet, dass der kindliche Spracherwerb mit der Entwicklung des Denkens, des Wahrnehmens und des Bezeichnens einhergeht. Noch anders ausgedrückt: als «Erwerb» bezeichnet man einen unbewussten Prozess, der ohne Anleitung, durch Kontakte in einer natürlichen Umgebung in alltäglichen sozialen Zusammenhängen (z.B. beim Einkaufen oder auf der Straße) auskommt.
Sprachenlernen dagegen erfolgt bewusst, ist angeleitet, wird gesteuert. Jedes Lernen bzw. jeder Lernende bedient sich der Kognition. Lehrer innerhalb von Institutionen (Schulen) oder außerhalb dieser strukturieren den Lernfortgang und geben Anleitungen. Schulisches Lernen vor Erreichen einer bestimmten Kognitionsstufe (vergl. Piaget oder Bruner) macht keinen großen Sinn, sondern stört nachgerade. Die Aufgabe des Lehrers im Lernprozess des Schülers ist, den Stand seines Schülers einzuschätzen und nach einer bewältigten Unterrichtseinheit den nächsten Schritt vorzugeben.
Auch das Lernen folgt dem Prinzip «Vom Einfachen zum Komplexen», und bevor komplexe Strukturen verstanden werden, müssen die einfachen Operationen sitzen und hinreichend eingeübt sein. Es ist am Lehrer, die Anleitungen hilfreich und verständlich anzubringen. Unterricht ist dann am ergiebigsten und motivierendsten, wenn er mit dem Wesen der Schüler in Einklang steht. Ein Unterricht mit einem Lernstoff, der den Schüler erreicht, wird ihn bilden. Lehrer, die auf ihre Schüler eingehen, sind wie Hebammen, die heben, was bereits in jenen schlummert und Anleitungen geben, die die Gebärenden befolgen können. An das bereits Eigene können diese dann die Informationen der Welt knüpfen und assimilieren. Und was sie nicht in sich finden, sondern im Außen neu erkennen, hilft ihnen ihre Innenwelt zu erweitern. Ein Lehrer öffnet Augen, Ohren und Herzen und ist im Leben von Menschen, und nicht nur von jungen, enorm wichtig. Deshalb muss ein Lehrer ein Mensch sein, der sich selbst gut kennt. Denn wenn er sein Eigenes erkannt hat, kann er andere Menschen erkennen.
.
2. Bildung und das Höhlen-Gleichnis (Platon)

“Das Einzige, das schlimmer ist als zu erblinden, ist als Einzige zu sehen.“ (aus: Stadt der Blinden)
Illustrationen: K. Afshar
Die unterirdische Höhle ist bei den Griechen allgemein ein Bild für den Hades, das Reich der Toten. Platons Höhle steht für unsere alltägliche Welt, in der wir leben. Wir Menschen, so zeigt uns Pla-ton in seinem Gleichnis, sind Gefangene in unserer gewohnten Behausung.
Oberhalb von und hinter den Gefangenen brennt ein Feuer. Die Höhle wird von diesem Feuer beleuchtet. Die Gefangenen sitzen nun unbeweglich da, denn sie sind an ihre Sitze gefesselt. Das heißt nicht etwa, dass sie sich nicht bewegen, nein, sie sind sehr rege, was Verkehr, Wettstreit und anderes angeht. Nur sind sie unbeweglich, was ihre Einstellungen angeht. Sie haben eine unveränderliche Einstellung zu dem, was sie für das Wirkliche halten.
Außer den Gefangenen gibt es nun noch (Platon nennt sie die Gaukler) andere Gestalten. Sie bewegen sich vor dem Feuer hinter den Gefangenen, und ihre Schatten werfen sich auf die Wände der Höhle vor ihnen. Sie sind die (modernen) Intellektuellen, die Künstler, die Politiker, die Designer, die Psychologen, die Moderatoren, die Berater… Sie bestimmen den Hinblick, sie entwerfen die Bilder für die Menschen. Die Gefangenen halten ihre Schatten für das Wahre.
Überhaupt sehen die Menschen sich und ihre Mitgefangenen und die Gaukler als Schatten – sie sehen immer nur die Projektion. Bei Homer ist «Schatten» der Name für die Seelen der Toten.
Im Schattendasein der Menschen (in diesem Traum in einem Traum) wird nun einer der Gefangenen von seinen Fesseln erlöst. Er steht auf, geht einige Schritte, blickt hoch zum Licht, ist geblendet, wendet sich ab und blickt noch einmal hin … sieht, dass er bis jetzt lediglich das Abbild des wahren Lichts (von außerhalb der Höhle) gesehen hat und begreift unter Schmerzen sein Gefangensein.
Der, der ihn losgebunden hat, war ein Lehrer. Er hat dem Gefangenen eine neue Sichtweise ermöglicht, hat ihn «sehend» gemacht. Dem allerdings ist das helle Flimmern des Lichts zunächst ungewohnt, und er erkennt das Gesehene nicht, er findet es unheimlich und befremdlich. Der Gefangene steht ganz am Anfang seiner neuen Freiheit und muss lernen im Licht zu sehen. Seine Augen aber beginnen zu schmerzen. Bald will er nicht mehr ins Feuer des Lichts blicken, er will zurück zu den Schatten, und er wendet sich ab und flieht zurück.
Der Versuch einer Befreiung ist zunächst misslungen. Bildung – und das ist u.a. die wechselweise Anwendung von Assimilation und Akkomodation von Wahrgenommenem – ist Platon zufolge etwas, das Menschen nicht unbedingt wollen… Man muss sie zum Sehen zwingen, ansonsten ziehen sie es vor, blind für das Licht zu bleiben.
Sokrates, der unbequeme Lehrer, wurde wegen seines «schlechten Einflusses» auf die Jugend von den Athenern umgebracht. Platon seinerseits hat seine Akademie außerhalb der Polis errichtet. Und Aristoteles, der zehn Jahre lange Platons Schüler in der Akademie war, ergriff in ähnlicher Situation die Flucht aus Athen, als ihm der Asebie3)-Prozess gemacht werden sollte.
Lehrer zu sein bedeutet, nach oben zu gehen und den Weg wieder nach unten steigen zu müssen, um vom Gesehenen zu berichten… Wer jedoch von oben kommt, wird verlacht, wird nicht ernst genommen, denn er berichtet von merkwürdigen Dingen, die es gar nicht gibt. Bildung ist ein Prozess, der, je weiter er fortschreitet, umso mehr Distanz zu den Blinden bedeutet.
.
3. Das Bild vom Menschen
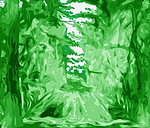
“Mich interessiert nicht wie du aussiehst.” – “Aber wie können wir uns dann erkennen?” – “Ich kenne den Teil in dir, der keinen Namen hat und das ist es doch was wir sind, richtig?” (aus: Stadt der Blinden)
Schauen wir uns den Begriff «Bildung» noch näher an, finden wir ihn als einen Schlüsselbegriff in der Epoche Goethes. Hier wie aber auch schon zuvor bei Meister Eckhart, Johannes Tauler oder Heinrich Seuse hat er seinen Ursprung in einem zentralen Gedanken der Mystik. Das Bild ist die Gestalt, das Wesen dessen, was ist (das griechische idea und eidos stecken darin). Die Mystik denkt die Wiedergeburt des Menschen in drei Stufen: Entbilden, Einbilden und Überbilden. Entbilden heißt frei werden von den Bildern dieser Welt als Voraussetzung für die nächsten Stufen. Ziel ist das Sich-Hinein-Verwandeln in Christus bzw. das Eins-Werden mit dem Göttlichen. Transformari haben die Mystiker mit «Überbilden» übersetzt. Das trans gibt das Ziel an: das reine Licht des Göttlichen. Die christliche mittelalterliche Mystik denkt das Sein als Herausbildung des im Menschen angelegten Bildes Gottes.
Aus der islamischen Mystik ist ein dem christlichen nicht unähnliches Bild dazu bekannt: Der Sufi Al-Halladsch hatte einen der 99 Namen Gottes für sich selber «beansprucht», indem er den Ausspruch anā al-haqq tat. Seine Lehre brachte ihm später eine Fatwa ein, seine in den Augen der damaligen Religionswächter häretische Aussage war mit dem Tode zu bestrafen. Niemand, kein lebender Mensch, konnte und kann nach exoterischer Lesart wie Gott sein, sondern immer nur durch Gott. In den Werken der Sufi-Dichter wie u.a. Yunus Emre, Rumi und Nezami trifft man auf Al-Halladschs Lehre der Eins-Werdung mit Gott bzw. der Auflösung des Ichs in Gott.
Der Hauptgedanke der Mystik – in modernen tagesverständlichen Worten ausgedrückt – besagt, dass der Mensch sich zum Menschen dadurch entwickelt, dass das in ihm angelegte Bild, sein Wesenskern, sich entfaltet. Ein Mensch kann werden, was er bereits ist – aber er kann nichts werden, das er nicht bereits in sich birgt. Was wie eine Begrenzung erscheinen könnte, kann als Bestimmung und Aufgabe umschrieben werden. Diese zu erkennen und zu erfahren ist die Eins-Werdung mit dem Göttlichen: das zu sein, als das man gedacht ist.
Unsere Zeiten sind säkulär-moralisch, ungern bezieht man sich auf diese Urbilder, aus denen unser heutiger Begriff aber nun einmal hervorgegangen ist. Heute denkt man Bildung als etwas, das dem Menschen «sozialgerecht» von außen angetragen wird, ohne dass sie auf den Einzelnen eingeht. Pädagogik ist ein Studienfach, das Lehrer unbedingt, Mystik eines, das sie ganz bestimmt nicht belegen müssen. Was die Mystik letztlich und paradoxerweise – und zwar unabhängig von der vordergründigen Religion – lehren kann, ist Demut.
Ein demütiger Lehrer wie auch ein demütiger Schüler haben Achtung vor dem Sein. Die Neugier des Schülers richtet sich auf ganz bestimmte Dinge, die ihn befähigen, sich selbst zu erkennen. Und selbst wenn der Schüler lernen muss, was in der Schule im Lehrplan vorgesehen ist, ohne dass es eine vordergründige Beziehung zu ihm hat, wird ein «mystischer» Lehrer es schaffen, dem Schüler das Wissen der Welt ehrfürchtig ans Herz zu legen.
.
4. Bildung und Humboldt

„Hast du Angst deine Augen zu schließen“ – „Nein, aber sie wieder zu öffnen.“ (aus: Stadt der Blinden)
Etwa um die Jahrhundertwende von 1800 herum bezog man sich auf den mystischen Bildungsbegriff – und aktualisierte ihn. Jetzt ging es nicht mehr so sehr um die Verwirklichung der Gottesgeburt in der eigenen Seele, als vielmehr um die allumfassende Ausbildung aller Fähigkeiten. – Diese Ausbildung wird in einem Mittelpunkt (Wissen um die Bestimmung des Menschen) zentriert. Der klassische Bildungsbegriff geht in Richtung Allgemeinbildung, und Wilhelm von Humboldt hatte ein Ideal vor Augen. Sein Bildungsideal entwickelte sich um die zwei Zentralbegriffe der bürgerlichen Aufklärung: den Begriff des autonomen Individuums und den Begriff des Weltbürgertums. Die Universität sollte ein Ort sein, an dem autonome Individuen und Weltbür-ger hervorgebracht werden bzw. sich selbst hervorbringen.
Wer ist man, wenn man Weltbürger ist? – Weltbürger sein heißt heute, sich mit den großen Menschheitsfragen auseinanderzusetzen. Der dahingehend Gebildete bemüht sich um Frieden, Gerechtigkeit, um den Austausch der Kulturen, andere Geschlechterverhältnisse oder eine neue Beziehung zur Natur.
Humboldt blickte auf den einzelnen Menschen als unverwechselbares, einzigartiges Individuum. In diesem Blick lag die Sehnsuchtsbewegung des menschlichen Lebens: fest verwurzelt sich bis an seine, ja, über seine Grenzen hinaus strecken zu können. Was tun junge Menschen? – Sie gehen in die Welt hinaus, nehmen sie in sich auf, entfalten die Fähigkeiten, die in der menschlichen Natur liegen, stärken und üben sie. Anschließend kehren sie zurück und nehmen ihren Platz dort ein, wo sie verwurzelt sind. Inwieweit ist dieses heute noch aktuell?
Ein zweiter Exkurs zum Lernen von (Fremd)Sprachen – immerhin ist Wilhelm von Humboldt auch «mein Ziehvater»: Das Erlernen fremder Sprachen hat nicht allein einen ökonomischen Nutzen (der durchaus in der Bildung von Menschen liegt), sondern einen Nutzen in einem emphatischen Sinn. Eine fremde Sprache zu lernen, heißt nämlich eine andere An-Sicht der Welt kennen zu lernen und eine andere Weise, sich in der Welt zu bewegen. Der Sprachlehrer kann als der Bringer eines neuen Selbstverständnisses, das das Eigene ergänzt und es bereichert, gesehen werden. Je mehr ich mir bewusst gemacht habe, desto mehr sehe ich in der Welt. Das, womit ich mich bekannt gemacht habe, ist mir nicht mehr fremd – ich muss es nicht mehr bekämpfen. Ein Lehrer, der vermag, dieses Feuer in seinem Schüler zu wecken, ist ein Brückenbauer, und der Schüler, der sein Feuer trägt, wird nicht mehr brandschatzen, sondern wertschätzen.
.
5. Bildung und der Einzelne
In unserer heutigen (westlichen) Welt brechen uns die Traditionen ein, ach, wir stellen sie derart in Frage, als gälte es, uns in selbstvernichtendem Bestreben für eine große Schuld zu bestrafen. Sinnstiftende Weltbilder sind auch in früheren Zeiten immer wieder zerbrochen, doch dann sind neue an ihre Stelle getreten. Jetzt scheint es, als seien die Menschen gewissermaßen experimentierend auf einem ziellosen Weg, auf dem das Individuum noch nicht einmal unterwegs erfährt, wer und was es ist. Da ist kaum Substanz, kaum Wesen, das in einer individuellen Lebensgeschichte zu entfalten wäre.
Um mit Sartre zu sprechen: Selbstverwirklichung heißt heute Verwirklichung von Nichts, nämlich von nichts Vorgegebenem. Es bleibt das Experiment, das der Mensch mit sich selber macht. Wir sind inzwischen sogar noch weiter, als Sartre beschrieb. Inzwischen erschöpft sich das Leben in nichts weniger als in aberwitzigen Vorgängen und Funktionen. Erlebnis und Selbsterfahrung, Selbstverwirklichung und Entfaltung der je eigenen Individualität sind heute unbedingte Werte, die alle anstreben – und paradoxerweise zeigt nachgerade das vehemente Bestreben, sie zu erreichen, ihre Abwesenheit. Psychotherapie wird zum Dauerzustand. Alle wollen mehr und anderes sein als die anderen, und als das, was sie in ihrem Kern wären, in ihren mitgebrachten Umständen sind. An die Stelle des Seins – wie gesagt – ist der Vorgang getreten. Wir leben, indem wir tun und in der Welt agieren.
Meistens tun wir das durch das Setzen von Regeln und verzeichnen dabei den Verlust realer Allgemeinheit. Das heißt, wir wissen nicht mehr, wer wir als Menschen sind, und was wir als Menschen zu sein hätten. Zusammen mit der Tradition haben wir das Wissen um die Bestimmung des Menschen und um die Menschheit in uns verloren.
Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem ich Ihnen von meinem Abstecher an eine Schule, einer Stätte modernen Lernens und von Bildung erzählen muss. Obwohl ich keine ausgebildete Pädagogin mit Staatsexamen und absolviertem Referendariat bin, unternahm ich vor sieben Jahren den Versuch, an einer öffentlichen Schule zu unterrichten. Ich bewarb mich an einem Gymnasium auf eine Stelle als Deutschlehrerin. Knapp 49 Jahre alt war ich, und sehr gespannt auf das, was mich erwartete: zwei zehnte und eine neunte Klasse. Zuvor hatte ich mir Gedanken gemacht. Hier sind einige von ihnen zusammengefasst, auf dass meine Sicht auf das Lernen und Unterrichten deutlicher werde.
Gedanke 1: Ein Mensch lernt dort, wo er sich konfrontieren kann, zu provozieren versucht oder Provokation erfährt. Widerspruch ist im Lernprozess sehr wichtig. Wo er nicht möglich ist, und eigene und fremde Erkenntnisse im Fragen nicht freigelegt werden können, versiegt das Lernen und ein Glaube muss her.
Gedanke 2: Lernen ist nur dann und dort möglich, wenn und wo Menschen frei sind, ihre Erkenntnisse zu haben, und sich diese Freiheit auch erlauben. Diesen Gedanken habe ich bei Konfuzius gefunden. – Die Möglichkeit, die sich uns in einem kleinen Zeitfenster bot, war die der Möglichkeit, sich zu dieser Freiheit zu entscheiden. Das Fenster in der Zeit ist wieder geschlossen, und die Errungenschaften der Menschwerdung scheinen im ewigen Kreislauf in einen neuen – vermutlich niederen – Zustand überzugehen.
Gedanke 3: Einer von Konfuzius‘ wesentlichen Gedanken war der der zweifachen Menschlichkeit. Diese besteht im Bewusstsein der persönlichen Mitte und der Fähigkeit, andere gerecht und unparteiisch zu behandeln. Nur ein Mensch, der mit sich selbst im Reinen ist, kann das Wesen anderer Menschen verstehen. Dann wird er im Umgang mit anderen keine Konflikte brauchen, keine Verwicklungen, weil er jene für etwas benutzt, das er ins Außen übertragen muss. Kämpfe zwischen Menschen entstehen aus falschen Gewohnheiten heraus; Menschen sind durch Konventionen, deren Bedeutungen sie nicht verstehen, schlimmer noch: durch Konventionen, die möglicherweise bar jeder Bedeutung sind, voneinander getrennt.
Ich fand mich drei Fronten gegenüber: die eine bestand aus den Eltern. Oh, da ist eine Lehrerin, die kein Referendariat durchlaufen hat. Ist sie in der Lage, mit unseren Kindern umzugehen? – Ich sage es gleich hier: ja, ich war in der Lage. Die Eltern hatte ich am Ende des ersten Halbjahres durchweg auf meiner Seite. Die zweite Front waren die Schüler. 75 an der Zahl, in einem Alter zwischen 13 und 16, geringfügig mehr Mädchen als Jungen, einige der Schüler mit einer anderen Erstsprache als Deutsch. Dies Alter ist bekannt als jenes, in dem junge Heranwachsende am allermeisten mit sich selbst beschäftigt sind, mit ihrem erwachsenden Körper und ihrem erwachenden Trieb in die Welt hinein. Sie haben Fragen und wollen Antworten.
Die ersten Wochen vergingen mit Annäherungen – an den Unterricht, an die verschiedenen Menschen, an den Lernstoff. Es kostete mich doppelt so viel und dreimal mehr Zeit, den Stoff vorzubereiten als es einen routinierten Lehrer gekostet hätte. Ich fing mit allem bei Null an, auch mit der Notengebung und überhaupt mit den Bewertungsrichtlinien. Es kostete viel Geduldenergie, die Tests der Schüler zu durchlaufen, um ihnen zu beweisen, dass ich sie ernst nehme. Es bedurfte – im Nachhinein besehen – großen Mutes, Dinge zu tun, die «man sich» nicht mehr im Unterricht leistete. Die ersten Streiche überstand ich, mit Rotwerden, mit Herzklopfen. Ich überstand die Unlustattacken, die sich im Lärmpegel niederließen, den offenen Widerstand mit Verweigerungen. Ich bestand die Nagelprobe mit Theaterbesuch, Besuch einer Zeitung und eines Kinos, und die ersten Zeugniskonferenzen. Danach hätten wir zur Normalität übergehen können, aber ich streckte die Segel.
Grund dafür war die Front Nummer 3 – die Lehrerkollegen. Dazu weiter unten mehr. Als die Schüler soweit Vertrauen gefasst hatten, dass sie offen mit mir redeten, kam ihr Frust zutage. Wir wissen nicht, warum wir das lernen sollen. Frau Deutschlehrerin stellte dann gleich etwas klar: ihr wisst sehr wohl, warum. Eure Frage ist: Wozu müssen wir das lernen? – Ihr fragt, was die aristotelische Poesie mit der Welt da draußen zu tun hat. Ihr fragt, was die rhetorischen Muster in Remarques «Im Westen nichts Neues» mit eurer Realität zu tun haben? – Ich sagte es ihnen. Ein Schüler fragte zweifelnd, warum er eine Zwei im Referat bekommen hatte, während der sonstige Klassenbeste eine Drei bekam: ob ich wüsste, dass es andersherum sein müsste. Ein anderer Schüler, sonst schriftlich auf Vier abonniert, bekam von mir eine Zwei. Einer, der kaum etwas sagte, ging mit einer Zwei nach Hause; eine Schülerin, die sich ständig mündlich äußerte, mit einer Drei. Ich erspare uns hier Einzelheiten. Um es zusammenzufassen: ich versuchte, den Lernstoff mit dem Lebensumfeld der Schüler in Zusammenklang zu bringen, ich stellte Tiefenverbindungen her und nahm mir dafür Zeit. Ich brachte unbekannte Komponisten via CD mit ins Klassenzimmer, und wir sahen uns gemeinsam einen Film an, bei dem die Schüler darauf gewettet hatten, ich würde ihn nicht kennen. Wir lasen eine ernsthafte Lektüre zu Faschismus und machten ein Drehbuch daraus, wir lasen Dürrenmatt und vertieften uns in Medea, kamen bei Christa Wolf und dem Geteilten Himmel heraus. Sie lernten nebenbei so viel, weil sie nicht merkten, dass sie lernten, sondern ihr gewecktes Interesse stillten. Die Klassenarbeiten, die wir schrieben, waren auf diese Art Lernen zuge-schnitten. Ich glaube, nach zwei Durchgängen brauchte keiner mehr Angst zu haben, er würde völligen Unsinn abliefern. Denn ich hatte gesagt: das gibt es gar nicht! Natürlich mussten wir in der Vergleichsarbeit scheitern! Ich scheiterte, weil mich die Kollegen nicht einbezogen, was die Wahl des Themas, seine Präsentation und die Aufgaben anging. Sie waren zu viert und sich einig, ich war alleine. Meine Schüler scheiterten, denn ich hatte ihnen in nur sieben Monaten eine Art zu arbeiten gezeigt, die sie aufgeweckt hatte, aber das war nicht vorgesehen. Ich hatte sie damit verdorben, und das ließ man mich spüren.
Als ich es merkte, war die erste Hälfte des zweiten Halbjahres fast vorbei. Ich beraumte eine Sitzung mit meinen Schülern ein und eröffnete ihnen, dass ich gehen würde. Nichts sagte ich von den Kollegen, wohl aber sagte ich, dass ich merkte, ich wäre am falschen Ort. Sie verraten uns! riefen sie zu Recht. Das sei nun mal so gelaufen – ich hatte das nicht erwartet. Weiterzumachen aber täte mir nicht gut, denn ich hätte immer das Gefühl, sie nicht auf das vorzubereiten, was von ihnen verlangt würde. Ich eigne mich nicht zu dieser Art von Ausbilder, und deshalb müsse ich gehen. Sie gingen heim, zwei Wochen später hatte der Schulleiter einen Brief aller Klassenvertreter mit der dringenden Bitte, meinen Vertrag zu verlängern und mich da zu behalten, auf dem Tisch. Meine Entscheidung aber war unumstößlich.
An dieser Schule ist mir klar geworden: es geht nicht mehr um Bildung, es geht, wenn überhaupt auch das noch, um Aus-Bildung. Schüler sammeln ein Wissen, das weit davon entfernt ist, in Zusammenhang mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stehen, das eingeatmet, und sobald die Klassenarbeit vorüber ist, wieder ausgeatmet wird.
.
6. Der Mensch in der Bildungswüste
Die Bildung des Menschen zu sich selbst, das Sehenlernen des wahren Lichtes, auf dass man sich und die anderen erkenne, die Vielfalt der Selbstverständnisse – alles das ist in einer Landschaft des Unterschiedlosen untergegangen. Es hat ganz schleichend angefangen. Vielleicht mit der französischen Revolution, vielleicht mit der Industrialisierung, vielleicht mit dem Kapitalismus, der als die andere Seite des Kommunismus nicht viel anders als jener ist. – Alle Menschen sind Funktion von etwas oder einem anderen. Alle Menschen sind gleich. Erst vor dem Recht und schließlich vor den Vielen. Gleichmacherei steht der Bildung des Eigenen entgegen. Da, wo nicht unterschieden wird, wird auch nicht geachtet, wert geschätzt. Dann haben wir die Einöde, die Wüste.
.
Exkurs

„Kein Araber liebt die Wüste. Wir lieben Wasser und grüne Bäume. In der Wüste ist nichts. Kein Mann braucht Nichts.“ (aus: Lawrence of Arabia)
In einem papiernen Aufschrei hatte ich vor langer Zeit einmal geschrieben, ich wolle nicht akzeptiert, sondern toleriert werden (etwa: «Du musst mich nicht mögen oder mir zustimmen, aber lass mich sein, wie ich bin!»). Anschließend hatte ich in einem öde langen Text versucht, zu definieren, was denn nun Toleranz und was Akzeptanz sei. Am Ende war alles – von Augen Dritter ungelesen – in einem der digitalen wie realen Ordner verschwunden. Und war vergessen worden.
Nun habe ich ihn wiedergefunden. Zu meinem Schrecken verstand ich meine eigenen Worte nicht mehr. – Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Ich sprach/schrieb sofort alarmiert mit etlichen Leuten und erfragte ihre Definition von Toleranz und Akzeptanz. Fragte dabei auch nach, welchem sie den Vorrang geben würden. In meiner Verwirrung hätte ich keine Prognose abgeben wollen, tendierte aber immer noch zur Toleranz, wie vor Jahren. Die Befragten allerdings legten den Schwerpunkt auf die Akzeptanz. Akzeptiert zu werden bedeute die Anerkennung der Meinung, die man vertrete, las ich da. Man werde mit den eigenen Ansichten und Taten in eine Gemeinschaft, die diese für gut befände, aufgenommen.
Toleranz, sagten sie, sei eine Einstellung der Nicht(be)achtung. Eine, die in sich trage, dem Toleranten sei das Gegenüber egal. Man interessiere sich nicht wirklich, sondern bleibe unverbindlich und beziehe keine Position. In einem Artikel, den ich im Internet fand, las ich, dass etwas aus der Position eines Herrschenden heraus zu akzeptieren etwas völlig anderes – sogar gegensätzliches – sei als zu tolerieren. Letzteres heiße, etwas zu dulden und zu erlauben (auch etwas, das falsch sei, was natürlich überhaupt nicht gehe!), während ersteres bedeute, etwas als wünschenswert anzunehmen und zu fördern. Toleranz sei eine Haltung des Verzichts auf ein bestimmtes, klar umrissenes Menschenbild, demgemäß man als Einzelner die Gesellschaft formen könne. Zwar habe eine tolerante Person eine ungefähre Ahnung, wie sich Menschen der eigenen Meinung nach verhalten sollten, doch ob sie das auch wirklich täten, würde dann nicht weiter beachtet. Das Führen des eigenen Lebens gehe jenen vor dem Einwirken auf das Leben der anderen, und das sei Gleichgültigkeit. Ich verstummte und ging in mich.
Meine Verwirrung weigerte sich beharrlich zu weichen, nein, sie vergrößerte sich: war nicht früher, vor nicht allzu vielen Jahren Toleranz der Wert in unserer Mitte, dem das größere Gewicht beigemessen wurde? Was war aus Nathan dem Weisen aus der Ringparabel Lessings geworden? Darin ging es doch um Toleranz, oder? Oder hatte ich alles falsch verstanden?
Mir fehlte ein entscheidender Baustein zum Verständnis des hausgemachten Unverständnisses, und ich entwickelte den Verdacht, dass hier eine Umgewichtung, eine Umdeutung der Begriffe, die mich in ihren Strudel gerissen hatte, im Gange war.
Der fehlende Baustein kam in Form einer Zigarette, die jemand vor der Tür eines Restaurants stehend rauchte, daher. Zigaretten sind gefährlich, d.h. Rauchen gefährdet die Gesundheit. Ist bekannt. Das hört und liest man allerorten, steht auch auf den Schachteln drauf. Also wird was dran sein. Wenn dem so ist, dann empfiehlt es sich, möglichst nicht zu rauchen, insofern man gesund bleiben will oder bleiben muss. Das könnte man als Dogma formulieren. Ihr Arzt vertritt möglicherweise dieses Dogma, d.h. er macht die Aussage der Gefährlichkeit der Zigaretten für sich zur ausschließlich gültigen Aussage. Wenn Sie ihn aufsuchen, wird er Ihnen nahelegen – eingedenk der später eintretenden Folgen – sofort mit dem Rauchen aufzuhören. Er wird sagen: Sie sollten aufhören zu rauchen, denn sonst… Und dann wird er Ihnen freistellen, ob Sie seinen Rat befolgen oder nicht. Der Mensch Arzt als Dogmatiker wird Sie nicht persönlich dafür abstrafen, dass Sie Raucher sind. Er wird Sie aber vielleicht durchaus interessiert fragen: Genießen Sie Ihre Zigaretten wenigstens? Und das meint er nicht ironisch.
Hat Ihr Arzt eine hohe Moral, dann wird er Ihnen ebenfalls sagen, dass Sie aufhören sollten zu rauchen. Er wird dies ebenfalls mit der Gefährlichkeit begründen, und er wird anführen, dass Rauchen auch die anderen Menschen gefährdet, jene, die in Ihrer Nähe leben, die Sie einnebeln, die passiv mitrauchen. Er ist ein Moralist, denn er wird eine bedrohliche Information in seiner Empfehlung mitschwingen lassen: Hör auf zu rauchen, sonst müssen wir dich ausschließen, sonst müssen wir uns überlegen, wie wir dich vom Gegenteil überzeugen. Die Moralisten haben es inzwischen geschafft, die Raucher draußen vor die Tür zu schicken.
Ein Dogmatiker kann tolerieren, dass jemand etwas für sich Falsches tut, wenn er nur die Konsequenzen seines Handelns übernimmt. Ein Moralist muss jemanden, der im Begriff ist, einen Fehler zu begehen, davon überzeugen, es anders zu machen, nämlich so, dass es mit der Mehrheitsgemeinschaft konform geht. Ein Moralist kann akzeptieren, was seinen Grundsätzen ähnlich ist. Es ist nicht so, dass ein Dogmatiker nicht weiß, was für den anderen gut wäre – nur: er wird es nicht einfordern. Das jedoch tut der Moralist.
In unseren Zeiten ist diese Begrifflichkeit verwischt. Weil Schwarz-Weiß ein Ideal ist und es dieses real nicht gibt und folglich auch nicht geben darf, dafür immer nur verschiedene Abstufungen von Grau, haben sich im Zuge der Relativierung und Neutralisierung Verwechslungen eingeschlichen. Das tut es immer, wenn man die Pole, zwischen denen sich das Leben abspielt, nicht mehr eindeutig benennen darf. Immer gibt es und hat es Mischtypen gegeben. Inzwischen allerdings kommen Dogmatiker moralisch verkleidet daher, und Moralisten wechseln auch schon mal ins dogmatische Lager, wenn eine angesagte Meinung in eine andere Phase tritt. Was zu beobachten ist: wir haben einen gewollten Überhang zum Moralischen. Die Werte an sich sind verloren gegangen (sage nicht nur ich), der Ethos ist futsch. Stattdessen haben wir Normierungen und Regelungen.
.
7. Rekonstruktion von Bildung
Fassen wir zusammen: Das Leben ist ein Traum oder ein Schattenspiel. Die Menschen darin – blind und ohnmächtig – jene, die das, was wirklich ist, nicht sehen, die das, was keineswegs wirklich ist, für wirklich halten. – Das war das Thema von Aischylos, damit sind wir wieder zurück bei den Griechen – und den Höhlenmenschen. Die Blinden, die Gefangenen könnten lernen zu sehen, und wollen es doch nicht.
Die Mystik mit dem Bild vom innewohnenden Wesen, das in einem Äußeren eingewickelt ist: die ganze Eiche ist bereits in der Eichel angelegt, der Baum wird sich von innen nach außen entfalten und entwickeln. Das ist im Groben das Wesen des mystischen Bildungsweges. So könnte es aussehen, doch die exoterischen Auslegungen haben der Mystik und den Menschen diesen Weg versperrt. Es bleib in heutiger Zeit ein Abklatsch – die kommerzielle Esoterik, die in Dualität zum Ursprung geht.
Humboldt zeigte an der Gestalt eines Baumes die Bewegung auf, die Sehnsuchtsbewegung, die das menschliche Leben voranzieht: Überhaupt liegt in den Bäumen ein unglaublicher Charakter der Sehnsucht, wenn sie so fest und beschränkt im Boden stehen, und sich mit den Wipfeln, so weit sie können, über die Grenzen der Wurzeln hinausbewegen. Ich kenne nichts in der Natur, was so gemacht wäre, Symbol der Sehnsucht zu sein. – In der Erde verwurzelt, wissend, wer wir sind, könnten wir die Welt erobern. Doch es ist etwas geschehen:
Statt Nächstenliebe haben wir den Sozialstaat. Nächstenliebe ist die Liebe zum Nächsten, den man in seinem Schicksal zu verstehen sucht. Wir mildern uns gegenseitig das Begreifen unserer Schicksale, d.h. unserer jeweiligen Bestimmungen, was uns nicht dessen enthebt, uns selbst und unser Leben eigenständig zu leben. Im Nächsten tolerieren wir sein je Eigenes. Mit «sozial» hat das nichts zu tun.
Wenn ich sozial bin, befinde ich mich von vorneherein, als mich bedingend und sichernd, in einem Kollektiv. In einem Kollektiv geht es nie um den Einzelnen, das Individuum. Da können sie reden, wie sie wollen: das geht nicht zusammen!
In der Nächstenliebe werden die Unterschiede zwischen den Menschen bewahrt und geachtet. Im Sozialen geht es darum, diese Unterschiede aufzuheben, so dass es keine Einzelnen, keine Individuen mehr gibt. In-dem wir die Unterschiede ausgleichen wollen und die Diskriminierung (das Bezeichnen der Unterschiede, und im Zuge dessen das Handeln, das diesem Bezeichnen folgt) zu vermeiden versuchen, geben wir die Möglichkeit zur Toleranz preis – und auch die Möglichkeit zur Entwicklung des Einzelnen zu dem Baum, der er ist. In einer sozialen Monokultur ohne Unterschiede gibt es keine Konkurrenz. Das könnte Frieden bedeuten, sollte man meinen. Es wird auch so kommuniziert. In Wirklichkeit bedeutet es den Tod.
Der moralische Überhang ist eine der Ursachen dafür, dass wir im Sozialrausch die Chance auf Eigenständigkeit unseres Seins verlieren und aufgeben, und damit die Bildung unseres Selbst. In der Ausübung und im Vorgang-Sein meinen wir, jederzeit einschreiten zu dürfen und setzen den Zwang zum Handeln an die Stelle des Geschehenlassens. Wir sind scheinbar überaus beweglich, dabei äußerlich getrieben und innerlich eingeschlossen und isoliert. Höhle – Sokrates!
Die meisten Lehrer in den Schulen, auf die unsere Kinder gehen, sind davon überzeugt, das Beste zum Besten der Kinder zu tun. Dass sie alles gelten lassen, dabei bewerten, und die Bewertungen sofort relativieren, weil niemand aufgrund eines Unterschieds Vorteile haben darf, ist tägliches Brot.
Dass aber heute die Menschen sich selbst gestohlen werden, wird keine Medizin richten können. Von derlei Dingen muss man sprechen, wenn man über Bildungspolitik spricht, und von noch anderen mehr, die ich hier überhaupt nicht angesprochen habe. ■
1)Sprache im weitesten Sinne, auch Dialekte
2)Kognition: Zu den kognitiven Fähigkeiten zählen: die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit, die Erinnerung, das Lernen, das Problemlösen, die Kreativität, das Planen, die Orientierung, die Imagination, die Argumentation, die Introspektion, der Wille, das Glauben und einige mehr. Es geht im Wesentlichen um Informationsverarbeitung. Der Begriff ist Gegenstand einiger Diskussion; ich verwende ihn in Anlehnung an die Arbeiten der kognitiven Psychologie, zusammengefasst in Oerter & Montada: Entwicklungspsychologie
3)Frevel gegen die Götter
..
___________________________________
Geb. 1958 in der Eifel/D, Studium der Sprachwissenschaft, Finn-Ugristik und Psychologie, Promotion, zahlreiche belletristische und fachwissenschaftliche Publikationen, lebt in Bornheim/D
.
.
Das Zitat der Woche
.
Vom ruhigen und guten Leben
Stéphane Hessel
.
 Wir sind alle zusammen verbunden in einer interdependenten Welt. Kein Problem kann nur mehr von einem Land geregelt werden, selbst die Schweiz kann das nicht tun. Man hat manchmal das Gefühl, jaja, die Schweiz, die kann sich schon allein organisieren. Sie braucht die anderen nicht, sie ist während der Kriege immer neutral gewesen, daher kann sie auch ihr gutes, ruhiges Leben weiterführen, ohne sich interessieren zu müssen, was außerhalb ihrer Grenzen vor sich geht. Das ist natürlich völlig falsch! Sei es noch so gut regiert oder noch so kraftvoll, es gibt keine Lösung nur für ein Land, egal ob es nun um die Vereinigten Staaten, Israel oder die Schweiz geht. Kein Land kann mehr hoffen, allein weiterzukommen, ohne mit der ganzen Weltgesellschaft verbunden zu sein. Das ist das Neue an unserer Epoche! Das müssen wir alle noch lernen, und dafür müssen wir uns gemeinsam einsetzen. ♦
Wir sind alle zusammen verbunden in einer interdependenten Welt. Kein Problem kann nur mehr von einem Land geregelt werden, selbst die Schweiz kann das nicht tun. Man hat manchmal das Gefühl, jaja, die Schweiz, die kann sich schon allein organisieren. Sie braucht die anderen nicht, sie ist während der Kriege immer neutral gewesen, daher kann sie auch ihr gutes, ruhiges Leben weiterführen, ohne sich interessieren zu müssen, was außerhalb ihrer Grenzen vor sich geht. Das ist natürlich völlig falsch! Sei es noch so gut regiert oder noch so kraftvoll, es gibt keine Lösung nur für ein Land, egal ob es nun um die Vereinigten Staaten, Israel oder die Schweiz geht. Kein Land kann mehr hoffen, allein weiterzukommen, ohne mit der ganzen Weltgesellschaft verbunden zu sein. Das ist das Neue an unserer Epoche! Das müssen wir alle noch lernen, und dafür müssen wir uns gemeinsam einsetzen. ♦
Aus: Stephane Hessel, An die Empörten dieser Erde – Vom Protest zum Handeln, Aufbau Verlag 2012
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Von der Wirtschaft und der Kultur
Egon Friedell
.
Den untersten Rang in der Hierarchie der menschlichen Betätigungen nimmt das Wirtschaftsleben ein, worunter alles zu begreifen ist, was der Befriedigung der materiellen Bedürfnisse dient. Es ist gewissermaßen der Rohstoff der Kultur, nicht mehr; als solcher freilich sehr wichtig. Es gibt allerdings eine allbekannte Theorie, nach der die »materiellen Produktionsverhältnisse« den »gesamten sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß« bestimmen sollen: die Kämpfe der Völker drehen sich nur scheinbar um Fragen des Verfassungsrechts, der Weltanschauung, der Religion, und diese ideologischen sekundären Motive verhüllen wie Mäntel das wirkliche primäre Grundmotiv der wirtschaftlichen Gegensätze.
Aber dieser extreme Materialismus ist selber eine größere Ideologie als die verstiegensten idealistischen Systeme, die jemals ersonnen worden sind. Das Wirtschaftsleben, weit entfernt davon, ein adäquater Ausdruck der jeweiligen Kultur zu sein, gehört, genau genommen, überhaupt noch gar nicht zur Kultur, bildet nur eine ihrer Vorbedingungen und nicht einmal die vitalste. Auf die tiefsten und stärksten Kulturgestaltungen, auf Religion, Kunst, Philosophie, hat es nur einen sehr geringen bestimmenden Einfluß. ■
Aus Egon Friedell: Kulturgeschichte der Neuzeit, Beck Verlag 1931
.
.
Das Zitat der Woche
.
Von der Freiheit im Kindergarten
Monika Seifert
.
Die umstandslose Einteilung der Eltern und Erzieher in einen konservativen und progressiven Flügel gilt nur so lange, wie es um die Durchsetzung besserer Bedingungen für die Kindergärten geht. Sobald die praktische Arbeit mit den Kindern beginnt, zeigt sich, daß in jedem von uns Widerstände stecken, den Kindern mehr Freiheit zu lassen.
Die Erfahrungen aus Einrichtungen, in denen die Träger bereits Veränderungen gestattet haben, zeigen allerdings, daß es eine Minderheit von Eltern gibt, die nicht bereit ist, ihre Kinder einen Kindergarten besuchen zu lassen, der ihnen mehr Freiheit läßt. Diese Eltern können unter den augenblicklichen Verhältnissen auch durch noch so gute Elternarbeit ihre Einstellung nicht verändern. Nun werden aber gerade diese Eltern sehr häufig zum Maßstab. Ihre Probleme bestimmen die Diskussion und verhindern damit, daß die konkreten Schwierigkeiten bearbeitet werden können. Solche Eltern sollte man in der gegenwärtigen Situation nicht zu halten versuchen. Ihre Schwierigkeiten treten sonst zu stark in den Vordergrund, gerade weil sie zugleich die mehr oder weniger unbewußten Ablehnungstendenzen in uns repräsentieren, die uns sowieso schwer zu schaffen machen. Uns unterscheidet von diesen Eltern nur, daß wir nicht ganz so total von unseren Bedürfnissen abgeschnitten sind, vielleicht weil wir nicht in gleichem Maße unterdrückt wurden. Die daraus resultierende Fähigkeit, weniger rigid zu Kindern zu sein, kann also von denen, die dazu in der Lage sind, als Glück gewertet werden, und nicht als Leistung. Es wäre jedoch gefährlich zu glauben, unsere Fähigkeit, eine andere Haltung zu Kindern einzunehmen, wäre unerschöpflich. Deshalb kann man die Warnung, sich nicht mit zu großen Schwierigkeiten zu belasten, nicht ernst genug nehmen.Im Umgang mit unsicheren, ambivalenten Eltern muß auf einen langsamen Lernprozeß gesetzt werden. Die Diskrepanz zwischen der Erziehung im Elternhaus und im Kindergarten muß erst einmal ausgehalten und gleichzeitig als Chance begriffen werden. Daß die Kinder an einem Ort, der ganz ihren Bedürfnissen entsprechend organisiert werden kann, mehr Möglichkeiten haben, kann für Eltern ja auch eine Erleichterung bedeuten. Die Erzieher müssen sich in diesem Prozeß sicher sein, daß sie die Interessen der Kinder, und langfristig auch die der Eltern, vertreten. Ein freierer Umgang mit Kindern, von weniger Tabus belastet, ist auch für die Eltern auf Dauer befriedigender. Aber gerade das erfahren sie erst gegen viele innere Widerstände. Fast alle von uns mobilisieren unbewußte Schuldgefühle, wenn wir Kindern gestatten, gegen die Verbote der eigenen Kindheit zu verstoßen. Aufgrund dieses Mechanismus gelingt es den Eltern sehr häufig, Erzieher und Lehrer langfristig doch wieder auf das von ihnen erwartete Erzieherverhalten festzulegen. Schuldgefühle sind mächtiger als intellektuelle Einsichten… ■
Aus Monika Seifert: Antiautoritäre Erziehung, in: Pädagogik und Ethik, Reclam Verlag 1996
.
.
Das Zitat der Woche
.
Von der Musik als einer selbstständigen Kunst
E. T. A. Hoffmann
.
Sollte, wenn von der Musik als einer selbständigen Kunst die Rede ist, nicht immer nur die Instrumentalmusik gemeint sein, welche, jede Hilfe, jede Beimischung einer andern Kunst (der Poesie) verschmähend, das eigentümliche, nur in ihr zu erkennende Wesen dieser Kunst rein ausspricht? – Sie ist die romantischste aller Künste, beinahe möchte man sagen, allein echt romantisch, denn nur das Unendliche ist ihr Vorwurf. – Orpheus’ Lyra öffnete die Tore des Orkus. Die Musik schließt dem Menschen ein unbekanntes Reich auf, eine Welt, die nichts gemein hat mit der äußern Sinnenwelt, die ihn umgibt und in der er alle bestimmten Gefühle zurückläßt, um sich einer unaussprechlichen Sehnsucht hinzugeben.
Habt ihr dies eigentümliche Wesen auch wohl nur geahnt, ihr armen Instrumentalkomponisten, die ihr euch mühsam abquältet, bestimmte Empfindungen, ja sogar Begebenheiten darzustellen? – Wie konnte es euch denn nur einfallen, die der Plastik geradezu entgegengesetzte Kunst plastisch zu behandeln? Eure Sonnaufgänge, eure Gewitter, eure Batailles des trois Empereurs usw. waren wohl gewiß gar lächerliche Verirrungen und sind wohlverdienterweise mit gänzlichem Vergessen bestraft.
In dem Gesange, wo die Poesie bestimmte Affekte durch Worte andeutet, wirkt die magische Kraft der Musik wie das wunderbare Elixier der Weisen, von dem etliche Tropfen jeden Trank köstlicher und herrlicher machen. Jede Leidenschaft – Liebe – Haß – Zorn – Verzweiflung etc., wie die Oper sie uns gibt, kleidet die Musik in den Purpurschimmer der Romantik, und selbst das im Leben Empfundene führt uns hinaus aus dem Leben in das Reich des Unendlichen.
So stark ist der Zauber der Musik, und, immer mächtiger werdend, mußte er jede Fessel einer andern Kunst zerreißen.
Gewiß nicht allein in der Erleichterung der Ausdrucksmittel (Vervollkommnung der Instrumente, größere Virtuosität der Spieler), sondern in dem tieferen, innigeren Erkennen des eigentümlichen Wesens der Musik liegt es, daß geniale Komponisten die Instrumentalmusik zu der jetzigen Höhe erhoben. ■
Aus E.T.A. Hoffmann: Beethovens Instrumentalmusik, Aufsatz (1814)
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Die falschen Argumente zur Buchpreisbindung
Wolfgang Böhler
.
Die Diskussionen um die Buchpreisbindung machen vor allem eines erschreckend offensichtlich: Wie innovationsfeindlich, strukturkonservativ und asozial unsere Kulturschaffenden sind. Dass Gewerkschaften in der Wirtschaftspolitik sich durch strukturelles Beharrungsvermögen und den Erhalt unzeitgemässer Privilegien hervortun, kann man ja verstehen. Dass aber die Kulturschaffenden, die sich selber als Speerspitze der gesellschaftlichen Erneuerung und Entdeckerlust definieren, dasselbe tun, ist deprimierend.
Verfolgt man die Diskussionen rund um die Abstimmung vom 11. März, scheinen Buchhändlern und Autoren (in Form des Autorenverbandes AdS und anderer) vor allem zwei Argumente wichtig: Das Buch sei ein Kulturgut und gehöre speziell geschützt. Und kleinere regionale Buchhandlungen seien wichtige kulturelle Begegnungszentren.
Dafür nimmt man unsoziale Strukturen in Kauf: Mit Hilfe der Buchpreisbindung sollen künstlich hochgehaltene Preise für Bestseller im Grunde genommen exklusivere Produktionen und die Buchhandlungen subventionieren. Bestseller sind per se das, was das Gros der Bevölkerung liest. Die breite Masse – das «Volk» – soll also die gehobenen Ansprüche exklusiverer Kulturkonsumenten finanzieren. Das ist nichts anderes als Umverteilung von unten nach oben und würde von den Kulturschaffenden lautstark als Skandal gebrandmarkt, ginge es nicht um ihre eigenen Pfründe.
Die Buchpreisbindung ist aber nicht nur unsozial. Die Sorge um das Buch als Kulturgut und die Existenz lokaler Buchhandlungen zielen an den eigentlichen Problemen vorbei. Das Buch ist kein Kulturgut, es ist einfach ein Stapel zwischen Karton gepapptes Papier. Ein wirklich schützenswertes Kulturgut ist die Fähigkeit zu lesen, sich in abstrakte Gedanken und Geschichten, die mittels Worten weitergegeben werden, zu versenken. Es geht um Kompetenzen, nicht um Dinge.Das Gros der Autoren hat nicht dank dem Verkauf von Büchern ein Einkommen, sondern dank Auftritten und Begegnungen. In Zukunft wird dies noch vermehrt so sein. Dazu braucht es Räume und Infrastrukturen. Es braucht deshalb dezentrale, vielfältige kleine Begegnungstätten, die einen entscheidenden Beitrag dazu leisten können, dass unsere ländlichen Gebiete und Randregionen als Lebensräume attraktiv bleiben.
Es geht vor allem darum, solche zu bewahren oder zu schaffen – Bibliotheken, Kleintheater, Dorfbeizen mit Theatersälen, Kirchgemeindehäuser, Klublokale von Harmoniemusiken, Chören und Sportvereinen und so weiter. Die Herausforderung ist nicht, auch im Quartier und Dorf Bücher über einen Ladentisch verkaufen zu können, sondern Begegnungen zu ermöglichen und Fachleute auszubilden, die wissen, wie man Programme solcher Begegnungstätten lebendig hält und wirklich breiten Bevölkerungskreisen zugute kommen lässt. Dies gälte es gezielt zu fördern. Die Fixierung auf Papier und Buchhandlungen behindern bloss Strukturwandel im Kulturleben.
Die Erosion der Buchhandlungslandschaft und der Bedeutung des Buches als Medium ist so oder so nicht aufzuhalten. Die wirklichen Herausforderungen sind die gesellschaftliche Kohäsion, die sich in einer kulturellen Vielfalt und Dezentralisierung äussert, und der Erhalt von intellektuellen Kompetenzen in Form von Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben. Kämpfe um tradierte Privilegien verhindern nur die politischen Diskussionen und Prozesse, die dazu in Gang kommen sollten. ♦
Wolfgang Böhler ist Musik-Philosoph und Chefredaktor des Online-Klassik-Magazins «Codex flores», aus dessen Editorial vom 10. Feb. 2012 dieser Beitrag stammt; Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Autors
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vergessene Bücher (3): «So grün war mein Tal» von Richard Llewellyn
.
Existentielle Fragen des Menschseins
Walter Ehrismann
.
 «So grün war mein Tal», 1939 im englischen Original erschienen, war das Hauptwerk des walisischen Autors Richard Llewellyn (Pseudonym von Richard Dafydd Vivian Llewellyn Lloyd), ein Roman über das Leben in einer Bergbausiedlung im Süden von Wales, 1942 von John Ford mit Maureen O’Hara und Walter Pidgeon verfilmt unter dem Titel «How Green Was My Valley». Der Streifen wurde für zehn Oscars nominiert, mit fünf Oscars prämiert, und gilt als einer der besten Filmwerke aller Zeiten – später, 1975, nochmals verfilmt als sechsteilige Fernsehserie. 1990 wurde der Film von John Ford ins Verzeichnis der National Film Registry aufgenommen, seiner kulturellen, historischen und ästhetischen Bedeutung wegen. Von Richard Llewellyn, 1906 in London geboren, ist dieser Roman das bekannteste seiner Werke. Der Schriftsteller verbrachte jedoch nur einen Teil seines Lebens in Wales. «Wie grün war mein Tal doch und das Tal jener, die nicht mehr sind» – so endet der Roman.
«So grün war mein Tal», 1939 im englischen Original erschienen, war das Hauptwerk des walisischen Autors Richard Llewellyn (Pseudonym von Richard Dafydd Vivian Llewellyn Lloyd), ein Roman über das Leben in einer Bergbausiedlung im Süden von Wales, 1942 von John Ford mit Maureen O’Hara und Walter Pidgeon verfilmt unter dem Titel «How Green Was My Valley». Der Streifen wurde für zehn Oscars nominiert, mit fünf Oscars prämiert, und gilt als einer der besten Filmwerke aller Zeiten – später, 1975, nochmals verfilmt als sechsteilige Fernsehserie. 1990 wurde der Film von John Ford ins Verzeichnis der National Film Registry aufgenommen, seiner kulturellen, historischen und ästhetischen Bedeutung wegen. Von Richard Llewellyn, 1906 in London geboren, ist dieser Roman das bekannteste seiner Werke. Der Schriftsteller verbrachte jedoch nur einen Teil seines Lebens in Wales. «Wie grün war mein Tal doch und das Tal jener, die nicht mehr sind» – so endet der Roman.
Im Mittelpunkt der beeindruckenden Familiensaga steht die Geschichte der Bergbau-Familie Morgan, die um 1880 ein einfaches, aber zufriedenes Leben führt. Geburt, Kindheit und Jugend, kirchliche Einsegnung, die ersten langen Hosen und der erste Kuss, Schule und Arbeit, Konflikte, Fussballspiel und Chorsingen, Diebstahl und Totschlag, Krankheit und Alter sind eingebettet in das Drama der kommenden Entfremdung. Die vordergründige Idylle findet ein jähes Ende, denn man hat im Tal neue Kohlevorkommen entdeckt, und schon bald entbrennt zwischen der Dorfgemeinschaft und den skrupellosen englischen Grubenbetreibern ein rücksichtsloser Interessenkampf um Gewinn und Arbeiterehre, um Privilegien und althergebrachtes Leben, um Modernisierung und Zerfall der bestehenden Gesellschaftsstrukturen. Es ist die Geschichte eines Tales und eines Städtchens, das vom Bergbau lebt und vom Bergbau zugrunde gerichtet wird, eines Ortes wie viele auf der Welt, die am Ende des vorletzten und zu Beginn des letzten Jahrhunderts durch die maßlose Industrialisierung verändert, ruiniert wurden und mit ihnen die ganze Lebensart. Am Ende wirft der Grosse Krieg (1. WK) seinen drohenden Schatten voraus.

Wenn der Industrie und der Wirtschaft ganze Landstriche geopfert werden: Szene aus dem s/w-Film «How green was my valley» (1941)
Wenn früh am Morgen die Männer aus den Häusern treten und zur Grube gehen, stehen die Frauen unter der Tür und schauen ihnen nach, wie sie die Strassen hinunter marschieren, einander grüssen, das Essenspaket in der einen Hand, die Pfeife in der andern. Links und rechts der Strasse die typischen Reihenhäuser, zweistöckig, weiss getüncht, die schmalen Vorgärten mit dem Sitzplatz und hinter den Häusern der Gemüsegarten, ein Bäumchen, Beerensträucher, ein Kaninchenstall oder ein Gehege für ein paar Hühner. Huw, der Jüngste der Familie Morgan, erzählt von seinen Eltern, die hart am Wandel der Zeit tragen, aber dennoch stets versuchen, die Familie zusammenzuhalten. Die ganze Familie Morgan ist mit darin verwickelt – der Vater Gwilym als Stollenmeister, die fünf älteren Söhne als Hauer oder Maschinisten. Die Brüder, stolze und leidenschaftliche Männer, machen sich für die Rechte der Arbeiter stark und gründen neu eine Gewerkschaft, während Angharad, eine der Schwestern, den Sohn eines Grubenbesitzers heiratet. Eine beginnende, zarte Romanze zwischen ihr und dem viel älteren Prediger hat sich nicht erfüllt. Und die Mutter? Sie verwaltet die Geldbüchse, die jeder am Schluss der Woche mit seinem Lohn füllt. Zu Bronwen, der Braut eines seiner Brüder, schaut Huw in jugendlicher Verehrung auf. Er himmelt sie an, denn sie ist es, die ihn in der langen Zeit seiner Krankheit pflegt und aufmuntert. Später wird sie zu seiner ersten grossen Liebe, und nur das gegenseitige Wissen um die Zugehörigkeit verhindert ein Abgleiten ins Unerlaubte.
In Rückblicken erzählt der Autor mit der Stimme des halb erwachsenen Huw die Geschichte. Er spürt den Ernst des drohenden Streiks, der den Streit entfachen wird zwischen dem Vater mit seinen althergebrachten Ansichten und Huws Brüdern. Huw Morgan, noch zu jung für den Einstieg in die Grube, ruft sich in Erinnerung, wie er als Knabe die dramatischen Ereignisse erlebte, die nicht nur das Leben seiner Eltern und der ganzen Familie, sondern auch sein eigenes und das aller Bewohner des Minenstädtchens radikal veränderte. Danach zieht er für immer weg von Cwn Rhondda, weg aus dem Tal wie alle, die versuchen, einen Platz an der Sonne, das heißt Arbeit und überhaupt eine Zukunft zu haben.
Im Verlaufe der Geschichte wird der Leser, die Leserin mit Fragen konfrontiert, die unser aller Zusammenleben betreffen: Was ist allgemein gültig? Was ist Moral, gibt es Sünde, und wie steht es mit der Strafe, der Rache? Darf der Vater eines geschändeten und ermordeten Mädchens den überführten Täter töten? Llewellyn meint dezidiert «Ja» – und als Leser/Leserin ist man hin- und hergerissen, wenn das eigene moralische Denkgebäude ins Wanken gerät, gerade wenn wir an die heutigen Fälle von Kinderschändung denken und unser Rachegefühl von der Justiz schlecht bedient wird, das Gesetzbuch Lücken aufweist oder die wankelhafte Auslegung durch Richter, Psychiater und zeitbedingte Ansichten uns unsere eigene Verantwortung abnimmt. Die ganze männliche Dorfgemeinschaft in dieser Tragödie eines «zurückgebliebenen» Bergbaugebiets in Wales am Ende des vorletzten Jahrhunderts beteiligt sich an der Suche nach dem Mörder, übergibt, als sie ihn findet, den jämmerlich um sein Leben flehenden Mann an der Stelle, wo das achtjährige Kind getötet wurde, dem Vater und überlässt den wimmernden Täter der Rache des Vaters. Es war ein «Ausländer», ein zugewanderter Engländer, der nicht zur Gemeinschaft der kleinen Stadt gehörte. Die Männer bilden einen Kreis um die beiden und schauen zu, die Frauen und Kinder sind im Dorf geblieben und hören die Schreie. Diese archaische Szene ungefähr in der Mitte des Buches bildet den Auftakt zu Huws endgültigem Erwachsenwerden. Rückblickend überschaut der Erzähler seine Kindheit und Jugend in diesem Städtchen im Süden von Wales, das unter den täglich größer werdenden Schlackebergen der Kohleförderung, die schleichend langsam bis zu den Hintergärten reichen, zu ersticken droht. Wo früher Wiesen und Weiden für Schafe waren, Obstgärten, Teiche, Wege und Plätze, überallhin stößt nun die Schlacke vor, die Reste der Kohle, die bei der Verhüttung übriggeblieben sind, oder der unverwertbare Teil des Aushubs aus den Bergwerken, der nicht allein die Landschaft verschandelt, sondern sich auch in den Lungen der Menschen festsetzt, sie krank macht. Dieser Verfallsprozess des Einzelnen und der Gemeinschaft ist der Inhalt des Romans, der uns in eindrücklichen Bildern zeigt, was Gier, Gewinnsucht, Aufhebung der innerlich verspürten Schranken in den Menschen anrichtet. Die Söhne entfremden sich dem Vater, die Frauen den Männern, die Tochter entfremdet sich der Mutter, der Einzelne dem gemeinsamen Wohl. Dazwischen schieben sich Erinnerungsstücke von umwerfender Komik, wenn ein Fussballmatch zwischen zwei Orten zu den damaligen Regeln ausgetragen wird, die Besäufnisse und Schlägereien nach dem Schlusspfiff, wenn der ortsansäßige Chor eingeladen wird, vor der Königin (Viktoria) zu singen, oder wenn Huw von einem Boxer, dem Freund eines seiner Brüder, auftrainiert wird, um in der Schule den ungerechten, verhassten Lehrer verprügeln zu können.
Huw Morgan wird das Bergbau-Städtchen und die wenigen Übriggebliebenen seiner Familie am Ende der Geschichte verlassen. Als Erinnerungsstück nimmt er das blaue Tuch, das seine Mutter jeweils als Schal um die Schultern gewickelt hat, mit auf den langen Weg. Als er geht, ist das Schicksal der kleinen Stadt und der Landschaft längst besiegelt: Alles wird zerstört werden wie so viele Städte und Dörfer dieser Gegend, der Kohleförderung, den Zechen, den Begleiterscheinungen des Bergbaus und den Hüttenwerken geopfert im Verlaufe der fortschreitenden Industrialisierung. Kaputtgemacht auch die Sitten, Bräuche und Bindungen der in Jahrzehnten gewachsenen Gemeinschaft, hingegeben dem Moloch Moderne.
Huws Erinnerungsarbeit beginnt dort, wo er und einer seiner Brüder heimlich die geheimen Versammlungen der Arbeiter nachts am Berg belauschen, die Rede des allgemein geachteten Vaters anhören, der den Leuten ins Gewissen redet und sie von der Nutzlosigkeit und Unrechtmässigkeit eines Streiks zu überzeugen versucht, wie sich die Mutter einmischt in das beginnende gewerkschaftliche Gebaren der Männer, wie sie auf dem Rückweg von der Versammlung auf dem Eis des Baches ausrutscht und Huw ihr das Leben rettet, indem er stundenlang ihren Körper mit dem seinen stützt im Eis. Er wird krank, bettlägrig, verpasst die Einschulung und wird zuhause vom Prediger der Gemeinde in Lesen, Schreiben und Rechnen unterrichtet. Bronwen, die junge Frau seines Bruders, päppelt ihn auf, verwöhnt ihn mit ihrer Kochkunst. Sie wird zum ersten Idol seiner Knabenjahre. Und als Huw endlich dem Unterricht der Primarschulstufe folgen kann, hat er Mühe, sich einzugliedern. Eine verarmte Frau, die ihren bei einem Eisenabstich verbrühten Mann pflegt, lehrt für ein paar Pences in ihrer Stube die Kinder der Bergleute das Einmaleins und die Buchstaben des Alphabets. Noch schwieriger wird’s für Huw auf der Mittel- und Oberstufe. Er muss ins benachbarte Städtchen, ist gut eine Stunde zu Fuss unterwegs. Es ist eine Tagesschule, jedes Kind bringt von daheim die Mittagsverpflegung mit. Walisisch, ihre ureigene Sprache, ist im Unterricht und auf dem Pausenplatz strikte verboten. So müssen sie halt Englisch parlieren, für die Jugendlichen eine Fremdsprache. Ihr Walisisch ist nahe dem Gälischen und dem Bretonischen verwandt und weist überhaupt keinen Bezug zur englischen Sprache auf. Wer gegen diese eiserne Schulregel verstößt, bezieht Prügelstrafe, damals an der Schule gang und gäbe, vom Prügelmeister mit dem Rohrstock vollzogen. Dieser «Sprachenstreit» gibt einen Einblick in die Distanz, die zwischen den ehemaligen Eroberern aus England und den walisischen Untertanen herrschte und immer noch herrscht. Erst in jüngerer Zeit ist an den Schulen Walisisch als Unterrichtssprache an der Unter- und Mittelstufe wieder eingeführt worden, zuerst den Behörden in der Thatcher-Ära abgetrotzt und dann rechtlich abgesichert.
Der Junge verliebt sich. Leider stammt das Mädchen, das mit ihm dieselbe Schulklasse der Oberstufe besucht, aus dem Nachbarort. Nachts auf dem Berg lässt er seine Angebetete den Klang der Nachtigal hören, in freier Natur unter dem Sternenhimmel. Sie schlüpfen, weil es gegen morgen kalt wird, unter die Decke und Huw erkundet die Geheimnisse des weiblichen Körpers. Plötzlich Lärm und Fackeln! Die Männer des andern Städtchens suchen die zwei, und nur mit knapper Not entkommen sie unerkannt der drohenden Strafe.
Im Gottesdienst ihrer Kirche muss Huw einmal mitansehen, wie es einer jungen Frau ergeht, die «gefallen» ist: Vor der Gemeinschaft der Gläubigen beichtet sie ihren Abfall vom rechten Glauben und von der gültigen Moral, und obwohl Huw weiß, dass der ältliche Pastor ein Verhältnis mit Huws junger Schwester hat, gelingt es ihm nicht, eine weniger rigide Denkart im Kreis der Diskutierenden einzubringen. Er muss in der Kirche schweigen, weil er unter den Gläubigen noch zu jung ist. Nachher aber, vor der Kirche, wagt er es, für die Gemassregelte Partei zu ergreifen. Sein Vater ist erschüttert über den unbotmäßigen Jungen, dass er ihn tagelang mit Schweigen bestraft.
So ist vieles in diesem Roman gezeichnet durch die Denkart einer längst entschwundenen Zeit, und doch, wenn man das Lokalkolorit weglässt, schälen sich die existentiellen Fragen des Menschseins heraus. Wer einen Vergleich herbeiziehen möchte, schaue sich den Film «Billy Elliot – I will dance» an. Auch diese Geschichte spielt im tristen Milieu einer Bergbau-Familie in Wales. Arbeit, Biertrinken, Boxen, Streik – all das ist in dieser Geschichte ebenfalls drin, vor realem Hintergrund der Thatcher-Ära hundert Jahre später als «So grün war mein Tal» – in der Zeit der grossen Arbeiteraufstände um 1980 wegen der angedrohten Schliessung der Gruben. Und auch in dieser Geschichte fällt der Junge aus der Reihe: Er will tanzen, nicht boxen! Billy wird in die Royal Dance Company aufgenommen, Huw Morgan, das alter ego des Schriftstellers Llewellyn, studiert in London. Beide verlassen ihren «Urgrund» und werden sich in der fernen Hauptstadt behaupten müssen. Bei beiden stellt sich die Familie anfangs quer. Bis der Vater stolz sein kann auf den Jungen, vergeht eine Zeit der Irrungen und Wirrungen. Huw erfährt die Unterstützung durch die Familie früher, er hat ja der Mutter das Leben gerettet. Außerdem gewinnt er den Schönschreibe-Wettbewerb einer Zeitung, sodass der Vater bereits früh stolz auf ihn sein kann.
Das alles entscheidende Ereignis aber ist der Streik. Huw erlebt die tiefe Spaltung zwischen Vater und Söhnen. Die Brüder Huws befürworten die Arbeitsniederlegung und verlassen im Streit die Familie und ihr Haus. Im Ort herrschen wegen des Streiks Hunger und Not, die letzten Reserven, das Geld der Gewerkschaft und die Nahrungsmittel, sind aufgebraucht, die Lohnbüchse der Mutter bleibt leer. Die Familien helfen einander, so gut es geht, aber zuletzt hat niemand mehr etwas. Obwohl Huws Vater lange gegen den Streik war und gar als Streikbrecher auftritt, stellt er sich zuletzt loyal hinter die Forderungen der Arbeiter und muss dafür bitter büssen. Der Streik misslingt und die Fabrikbesitzer nehmen Rache. Der Grubenbesitzer stellt ihn bei Kälte, Regen und Schnee als Eingangskontrolleur im Freien auf. Dann zerstört ein Wetter die Grube. Als Vater Gwilym auf Druck der Arbeiterkollegen nochmals als Retter zugelassen wird, gerät er auf der Suche nach Verschütteten in einen zusammenbrechenden Stollen. Unter den Toten ist auch er. Der Schaden ist immens, die Grube wird definitiv geschlossen. Die Ehe Angharads scheitert, ein Bruder stirbt an Depression, die andern sind weg, Vater und Mutter gestorben. So endet die Geschichte.

... ist eine Essay-Reihe, in der das Glarean Magazin Werke vorstellt, die vom kultur-medialen Mainstream links liegengelassen oder überhaupt von der «offiziellen» Literatur-Geschichte ignoriert werden, aber nichtsdestoweniger von literarischer Bedeutung sind über alle modische Aktualität hinaus. Die Autoren der Reihe pflegen einen betont subjektiven Zugang zu ihrem jeweiligen Gegenstand und wollen weniger belehren als vielmehr erinnern und interessieren.
Anhand der Inhaltsangabe ist man geneigt, das Buch als düster und traurig zu bezeichnen. Das ist es nicht, eher bittersüß, wenn es von Huws glücklicher Kindheit und Jugend erzählt. Die Tragödien, die die Familien und das Tal treffen und der schleichende Zerfall der Gemeinschaft wechseln sich ab mit fröhlichen Ereignissen, alles getragen von einer glücklichen, zusammenhaltenden und sich sehr liebenden Familie, auch wenn die schließlich auseinander gerissen wird. Bei der Sprache ist zu berücksichtigen, dass der Roman 1939 geschrieben wurde. Sie ist zwar «altmodisch», aber schön, das merkt man auch in der Übersetzung. Das Buch erreichte eine Weltauflage von weit mehr als zwei Millionen Exemplaren. An diesen Erfolg konnten die späteren Werke Llewellyns nicht anknüpfen. Die Fortsetzung der Morgan-Saga, unter dem Titel «Das neue Land der Hoffnung» erschienen, überzeugte literarisch nicht. Mangelnde Sachkenntnis im Flieger-Roman «Den Sternen nah» und schlicht Kitsch im Kibbuz-Buch «Und morgen blüht der Sand» wurde Llewellyn in der Kritik vorgeworfen. Der Autor verstarb im Dezember 1983 in Dublin.
Ich liebe Familiensagas, ihre Detailversessenheit, ihr autobiographisches Cachet, die Geschichten einer Epoche in ihrem historischen Rahmen. Oft verlege ich meine Ferien in das Gebiet eines Romans, den ich grad gelesen habe. So habe ich mal die ganze südliche Provence durchstreift auf der Suche nach den Orten aus dem Roman «Die Kinder der Finsternis». Oder ich lese Fachbücher, Geschichte, Reisebeschreibungen, sammle Zusätzliches. So bin ich vor kurzem auf einen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung gestossen: Phönix aus der Kohle – die Auferstehung von Cardiff (NZZ vom 7. Juli 2011). Zitat: «Eine knappe halbe Stunde dauert die Fahrt von Cardiff Richtung Norden, dann ist man im Grünen. Das war nicht immer so. Erst in den vergangenen Jahren wurden hier die Löcher aufgefüllt, welche durch den Kohleabbau in der Region seit 1880 entstanden waren. Aber die Zeit heile alle Wunden, heißt es, und so entstanden auf den ehemaligen Kohleminen schrittweise Landschaftsparks, die den Touristen zum Wandern, Biken oder auch einfach nur zum Verweilen einladen. Wer die Spuren der Kohleindustrie von nahem besichtigen möchte, ist in Blaenavon gut aufgehoben. Die einstige Boomtown der industriellen Revolution ist heute Unesco-Weltkulturerbe. Hier kann man sich von einem Guide 90 Meter unter der Erde durch die einstige Mine, den ‘Big Pit’, führen lassen. Auf der Rückfahrt präsentiert sich dann die Landschaft wieder so, wie man sie sich vorgestellt hat – Ortschaften, deren Namen geschrieben werden, als wäre eine Katze einmal quer über die Tastatur spaziert, wechseln sich ab mit saftigen Matten, auf denen Schafe weiden. Zwei bis vier Schafe pro Einwohner soll es in der Heimat von Dylan Thomas, Richard Llewellyn, Tom Jones und Ryan Giggs geben, je nachdem, wen man fragt». ■
.
____________________________________
Geb. 1943 in Chur/CH, Ausbildung zum Lehrer, Studium an der Zürcher Fachhochschule für Gestaltung, 1966 Unfall im südfranzösischen Meer, seither im Rollstuhl, zahlreiche malerische, bildhauerische und literarische Publikationen, lebt und arbeitet als Bildender Künstler und Schriftsteller in Urdorf/CH
.
.
.
.
.
Essay von Joanna Lisiak
.
Reife Männerstimmen
Joanna Lisiak
.
Man kann sich ihrer Faszination nicht entziehen, auch wenn man sie zunächst wahrnehmen, ja erst gewahren muss als ein isoliertes Ereignis. Denn tauchen sie auf, umgibt sie sogleich die Hülle eines ganzen Kosmos’, der reich an unterschiedlichen Assoziationen ist. Man muss nicht erst künstlich versessen sein auf die menschliche Stimme, deren Klang und Wirkung, um die durchdringende Aura dieser ganz besonderen Stimmen zu erkennen. Möglich, dass eine anachronistische Veranlagung oder die Erwartung, in einer Stimmfarbe zugleich auch auf einen vollen Körper zu treffen, dazu verleiten, reife Männerstimmen, von denen hier die Rede ist, als mehr als einen zufriedenstellenden Hörgenuss zu deklarieren.
Was aber ist der Körper dieser Stimmen, aus was setzt er sich zusammen, so dass die Sympathie beim Hörer alsbald hergestellt ist und die Anziehungskraft ihre Wirkung nicht verfehlt? Die Auslegung der Fragen in psychoanalytische Einzelteile oder gar die Annäherung an ödipale Konflikte würde die Betrachtungsweise verfehlen, weil sie allzu sehr auf die einzelnen Subjekte eingehen würde und die Stimme nichts weiter als ein Schlüssel diente, um die Charaktere beziehungsweise Beziehungen der Protagonisten offenzulegen. Von einer solchen Analyse ist man jedoch weit entfernt, wenn man vor allem untersuchen möchte, aus was sich die erquickende Wirkung speist, die eine solche Stimme auf den Hörer hat. 1)
Zunächst ist da der reine Klang. Ein Klang, der mindestens einem harmonischen Dreiklang gleichkommt, oder der ist wie ein guter Duft, welcher eine Basis-, eine Herz- und eine Kopfnote einschließt. Die menschliche Männerstimme ist mit einer Reife belegt, die das hörende Gemüt im Nu besänftigt. Die Stimme wirkt erfahren, doch ist dies kaum der Hauptgrund, weshalb sie vertrauenerweckend scheint. Ohne genau lokalisieren zu können, woher die Überzeugung herrührt, schreiben wir dieser stimmlichen Reife eine innere Reife zu, die uns ermöglicht, uns hineinzubegeben ins richtige Hören, sprich, ins Zuhören hinein. Dieses Zuhören findet auf einer tieferen Ebene statt als das rein akustische Wahrnehmen, das an das thematische Interesse gekoppelt ist. Zuhören aus einem vertrauten Punkt heraus bedeutet in erster Linie zu glauben, was der andere sagt, und es meint zudem, Vorbehalte abzubauen, sich nicht dagegen anzulehnen, was gesagt wird/werden könnte, dem wir uns mit unserer Meinung entgegensetzen könnten oder möchten.
Dies soll nicht bedeuten, dass wir durch diese reifen Männerstimmen sang- und klanglos manipuliert werden wollen, oder dass wir etwa unbewusst einem Mechanismus zum Opfer fallen, der unser eigenes Denken lähmt. Der kritische Punkt wird in der Konstellation des Zuhörens einer reifen Stimme allemal – und ist zunächst abhängig von einem selbst und nicht von der Person ausserhalb –, wohl aber etwas verzögert erreicht. Durch die gegebene Chronologie: 1. Vertrauen, 2. (mögliche) Kritik entsteht jedoch ein Denken, das von einem konzentrierten Punkt her stattfindet und erst noch aus einer entspannten, womöglich eher aus einer emotionalen denn einer kognitiven Haltung heraus. Eine von Anfang an misstrauische, kritische Haltung, zum Beispiel gegenüber einer weniger überzeugenden Stimme, beschäftigt das Gehirn von vornherein, was einerseits zu einer zusätzlichen Aktivität und somit Belastung, also auf Kosten der Konzentration geht, andererseits das Denken unnötig in eine vom Misstrauen, nicht aber vom Thema bestimmte Richtung lenkt. Das Naturell des Spielerischen und Kreativen ist jedoch in ein entkrampftes Umfeld zu betten. Nur so ist ein solches Denken flexibel und offen für jene anderen Einflüsse ausserhalb, die sich aus diesem Prozess erst ergeben.
Die stimmliche Reife überdies, erweckt das Vertrauen des Zuhörers auch deshalb, weil sie zweifellos eine Aura von Sympathie umgibt, die wiederum nicht auf einer sympathisch klingenden Stimmfarbe, sondern in allererster Linie auf Empathie aufbaut. Jener Empathie nämlich, sozusagen als «Voraus-Bonus» gegenüber dem Zuhörer, die der noch zu entstehenden Sympathie zugrunde liegt. Der vermittelte Inhalt geht mit dem Sprechenden auf dieser zeitlich nur gering und nur unbewusst verschobenen Grundlage entspannt und harmonisch einher und bewirkt, dass das Gesagte glaubwürdig daherkommt. Zweifelsohne gibt es auch andere, unreifere Stimmen, die überzeugend wirken können, uns zum Kern des Themas transportieren und unsere Reflexion vorbehaltlos ankurbeln. Der Unterschied liegt vermutlich darin, dass die reifen Männerstimmen auch dank dem Vorteil der Empathie immer ein Stück weit authentischer wirken und uns daher das Gefühl vermitteln, das Gesagte und Erzählte wirklich selbst erlebt zu haben.
Unsere Gesellschaft ist nicht darauf ausgerichtet, sich in erster Linie mit älteren Menschen zu identifizieren, noch weniger darauf, sie sich zum Vorbild zu machen. Ob junge Männer – insbesondere solche, die Berufe ausüben, in denen die Stimme ein wichtiges Element, ja auch Teil eines Erfolges ist – solchen reifen Stimmen (und nicht nur klangschönen, stimmgewaltigen) nacheifern, ist schwer zu beurteilen. Kann, wenn er es möchte, ein guter Schauspieler nicht auch eine Authentizität durch reine Arbeit erreichen? Er kann es bedingt. Empathie ist gewissermassen auch technisch herzustellen, indem man sich das Gegenüber vorstellt auf der einen Seite, und andererseits, indem man sich als Vortragender in den Text mit Frische, Begeisterung und einem Stück Reflexion auf das eigene Subjekt hin bezogen, das eben spricht, hineinbegibt. Ein ordentlich guter Schauspieler, der nicht mit der besagten reifen Männerstimme ausgestattet ist, hat durchaus die Aussicht, uns durch seine Kunst zu verführen, uns mit ihm fühlen zu lassen, ihn als Schauspieler vergessen zu machen, und er kann uns für sich gewinnen, indem wir ihm Glauben schenken, mit ihm sympathisieren usw. Doch wird er es sehr schwer haben, die Empathie, die er uns gegenüber hat, durch Bewusstsein, Absicht, Willen und Handwerk grundlegend und vom ersten Ton an herzustellen. Denn die Empathie der reifen Männerstimme dem Zuhörer gegenüber baut nicht nur zeitlich rascher, sondern auf einer universellen Sprache auf und meint nicht zwei einzelne Menschen – den Sprechenden und Zuhörenden plus den Inhalt -, sondern zwei Menschen, die sich erst durch die Menschheit, ja Menschlichkeit grundlegend definieren und auf diese Weise ganz ausserhalb des vermittelten Inhaltes zueinander finden.
Diese voller Wohlwollen empfundene Empathie örtlich aufzuspüren ist ebenso sinnlos, wie es unmöglich ist, die Worte zwischen den Zeilen ausfindig zu machen. Wie auch immer diese Stimmen entstehen und reifen: mit bewusst erlebtem, reich gelebtem Leben gefüllt scheinen sie allemal. Die pure Freude der zuweilen zarten, märchenhaft anmutenden Erzählweise des mit dieser Stimme Sprechenden schwingt immer über die Vermittlung des Textes, über den Sprechenden und über den Hörenden hinaus. Sie schwingt, glüht, steckt an. Sie ist gebend, auch wenn wir nicht erfassen können, was genau wir bekommen. Sie lässt einem gewiss die Freiheit und doch kaum die Wahl, sich irgendwie lebendig, substanziell zu fühlen, in dem Moment, wo sie zu uns spricht und etwas bei uns erreicht oder in uns bewirkt.
Die Empfänglichkeit für diesen Schwung und die Begeisterung für diese reifen Männerstimmen hat wohl kaum ihren Ursprung darin, dass wir in diese Stimmen das Organ des Wunschgrossvaters oder Vaters projizieren. Die Anziehungskraft des Fremden und doch stets so Vertrauten kann bisweilen bis zu den erotischen Gefilden führen, auch wenn diese Form von Erotik wohl weniger die Leidenschaft weckt, als dass sie ihr (künftiges, vergangenes, hier wie dort oder in der Menschheit selber verankertes) Vorhandensein unprätentiös und verständnisvoll offenbart.
Am Ende bleibt die fahle Befangenheit, dass diese Art von reifen Männerstimmen ausstirbt, da sie einer Männerart angehört, die es so bald nicht mehr gibt. Möglicherweise waren, salopp ausgedrückt, Menschen diesen Schlags schon immer rar, aber immerhin gab es genug derer, die diesen Stimmen einen festen Platz in der Gesellschaft einräumten, sie wertschätzten und sie für Tonaufnahmen, sei es in Hörspielen, Hörbüchern, Radiosendungen oder für Vertonungen von Dokumentar- oder anderen Filmproduktionen engagierten. Die Tonträger und ein paar nostalgische Zeugen werden bleiben, hoffentlich aber jene, die so zu leben verstehen, dass solche Stimmen überhaupt erst erzeugt und hervorgebracht werden können, sowie andere, die es verstehen diese zu fördern, um sie der Gesellschaft zugänglich zu machen. Mangels genügender Vorstellungsgabe ist es unmöglich, sich der in den Medien heute vertretenen Männerstimmen jene herauszupicken, die die Eigenschaften von dieser Art reifen Männerstimmen in gesetztem Alter erreichen könnten. ▀
1) Der Text ist im weitesten Sinne vielleicht eine persönliche Lobeshymne an die reifen Männerstimmen, kann jedoch durchaus auch als Beispiel für die reife menschliche Stimme und somit auch als Pendant mit dem Beispiel der weiblichen reifen Stimme gelesen werden. Um den Textfluss nicht unnötig mit Parallel-Beispielen aus der weiblichen Stimmwelt zu stören, wurde der Fokus einzig auf die maskuline Seite gelegt. Möglicherweise auch deswegen, weil mehr Beispiele unter Männern gefunden wurden.
____________________________
Geb. 1971 in Poznan/Polen, Lyrik- und Prosa-Veröffentlichungen in Büchern und Zeitschriften, schreibt auch Theaterstücke & Hörspiele, Mitglied u.a. des PEN, Jazz-Sängerin, lebt in Nürensdorf/Schweiz
.
.
.
.
Vergessene Bücher (2): «Die Offizierin» von Nadeschda Durowa
.
Aller «naturhaften» Determinierung entzogen
Marianne Figl
.
 In Österreich diskutiert man zur Zeit die Abschaffung der Wehrpflicht. Meine beiden Söhne haben ihre Pflicht im Zivildienst abgeleistet und damals noch viel Spott über sich ergehen lassen müssen – also: Was fasziniert mich an Nadeschda Durowa, dieser Frau, die vor ca. 200 Jahren ihr bequemes bürgerliches Leben gegen ein anstrengendes, gefahrvolles und sehr schlecht entlohntes Dasein als Kavallerist(in) eingetauscht hatte, dabei offiziell als Mann auftrat und schließlich für ihre großartigen Leistungen einen der höchsten Orden vom Zar erhielt? Was ist es, das diese Abenteurerin so anmutig erscheinen lässt, dass sie in ihrer Heimat fast wie eine Heilige verehrt wird? Wer war überhaupt die Autorin von «Die Offizierin» – einer Autobiographie, von der heute kaum jemand mehr redet?
In Österreich diskutiert man zur Zeit die Abschaffung der Wehrpflicht. Meine beiden Söhne haben ihre Pflicht im Zivildienst abgeleistet und damals noch viel Spott über sich ergehen lassen müssen – also: Was fasziniert mich an Nadeschda Durowa, dieser Frau, die vor ca. 200 Jahren ihr bequemes bürgerliches Leben gegen ein anstrengendes, gefahrvolles und sehr schlecht entlohntes Dasein als Kavallerist(in) eingetauscht hatte, dabei offiziell als Mann auftrat und schließlich für ihre großartigen Leistungen einen der höchsten Orden vom Zar erhielt? Was ist es, das diese Abenteurerin so anmutig erscheinen lässt, dass sie in ihrer Heimat fast wie eine Heilige verehrt wird? Wer war überhaupt die Autorin von «Die Offizierin» – einer Autobiographie, von der heute kaum jemand mehr redet?
2012 jährt sich die Schlacht bei Borodino zum zweihundertsten Mal; Russland zwang damals Napoleon endgültig zum Rückzug. Die Durowa hat sich auch in dieser Schlacht Lorbeeren geholt – die Autorin von «Die Offizierin» also eine blutrünstige Schlächterin, ein Mannweib, verbittert und gedankenleer? Nein, eben nicht, eben ganz anders.
Natürlich, sie verlässt nächtens ihren Mann und ihr Kind, reitet fast ohne Gepäck und Geld los in eine ungewisse Zukunft, um sich bei den durchziehenden Soldatenwerbern als Jung-Offizier rekrutieren zu lassen, eben zum Kampf gegen Napoleon. Die Frage also nochmals andersrum: Was trieb diese exzellente Reiterin, die schon früh auf Bäume kletterte, mit Pfeil und Bogen schoß, mit ihrem Vater lange Ritte ins wilde Gelände unternahm, was trieb die blutjunge Frau dazu, ihre weibliche Identität aufzugeben und fortan unter dem Namen Alexander Durow zu leben, nachdem sie ihr gesamte Familie ohne alle Verabschiedung fluchtartig hinter sich gelassen hatte?
Nadeschda Durowa hatte nie Schulbildung genossen, und doch brachte sie es im Selbststudium so weit, dass sie heimische, französische und polnische Literatur lesen konnte. 1994 brachte Rainer Schwarz beim Kiepenheuer Verlag eine erste deutsche Übersetzung ihrer Autobiographie heraus: «Die Offizierin – Das ungewöhnliche Leben einer Kavalleristin» (zwischenzeitlich auch im Insel-Taschenbuch-Verlag veröffentlicht). Darin ist zu lesen, dass Nadeschda bereits als Vierzehnjährige beschließt, ein Mann zu werden und zu den Soldaten zu gehen. Und wörtlich weiter: «Zwei Gefühle, die einander so widersprechen – die Liebe zu meinem Vater und die Abscheu vor meinem Geschlecht -, erregten meine junge Seele mit gleicher Stärke und mit einer Festigkeit und einer Ausdauer, wie sie einem Mädchen in meinem Alter selten zu eigen sind. Ich begann, einen Plan zu überlegen, um die Sphäre zu verlassen, die dem weiblichen Geschlecht von der Natur und den Sitten bestimmt ist.»

... ist eine Essay-Reihe, in der das Glarean Magazin Werke vorstellt, die vom kultur-medialen Mainstream links liegengelassen oder überhaupt von der «offiziellen» Literatur-Geschichte ignoriert werden, aber nichtsdestoweniger von literarischer Bedeutung sind über alle modische Aktualität hinaus. Die Autoren der Reihe pflegen einen betont subjektiven Zugang zu ihrem jeweiligen Gegenstand und wollen weniger belehren als vielmehr erinnern und interessieren.
Nadeschda Durowa nahm sich also die Freiheit, über ihr Leben selbst zu entscheiden, sie machte sich unabhängig – und zahlte für diese Freiheit den Preis der Einsamkeit, der Abgeschiedenheit zwischen den Schlachten und Einsätzen, die sie lesend und ihre Erinnerungen aufzeichnend verbrachte.
Zehn Jahre im Militärdienst, teilweise auch im Winter, bei Regen und Wind, oft auf offenem Felde, jedenfalls immer in ungeheizten Unterkünften nächtigend, doch nie wirklich krank werdend, obwohl ihre Ernährung kümmerlich war… Den ganzen Tag – oft auch mondhelle Nächte nutzend – jagte sie zuletzt als Ordonanz des Feldherrn Kutusow auf ihrem Pferd von Stellung zu Stellung, berühmt für ihren Mut, berüchtigt für ihre kühl distanzierte Haltung gegenüber ihren männlichen Kollegen…
Als ich von ihrer Lebensgeschichte hörte und las, hat Nadeshda mein Herz berührt – genau an der Stelle, wo der Kant`sche «Herzenskündiger» sitzt: Die Durowa hat gehandelt, und gehandelt nach ihrem eigenen Gewissen, um in der Freiheit sich nicht instrumentalisieren zu lassen, auch nicht durch Ehe und Mutterschaft, dieser «naturhaften Determinierung» hat sie sich entzogen, riskierend nicht verstanden zu werden, einsam zu bleiben – aber frei. ▀
____________________________________
Geb. 1946 in Wien, Studium Malerei&Graphik an der Hochschule für Angew. Kunst/Wien; Atelier in Salzburg & Online-Galerie, Literarische Texte in Anthologien, lebt in Salzburg/A
.
.
..
.
Das Wiener «Kollegium Kalksburg» feiert Jubiläum
.
15 Jahre Selbstzerstörung im Dienste des Wienerliedes
Stephan Urban
.
Es gibt ja verschiedenartige Theorien, warum Wien eine derartig lebendige Independent-Musikszene hat – die wahrscheinlichste ist wohl, dass diese Stadt im Herzen Europas liegt und sich die hier beheimateten Musiker in alle Richtungen frei orientieren können. In diesem Sinne heißt es auch wohl teilweise zu Recht, dass östlich von Wien der Balkan beginnt.
Das sogenannte Wienerlied – das sich bei genauerer Betrachtung einer präzisen Definition ebenso erfolgreich entziehen kann wie die Enden des Regenbogens einer Erreichbarkeit – passt wohl auch nur in diese Stadt. Sein Spektrum reicht vom Straßenlied über Couplets und Spottlieder bis hin zum Kunstlied, primär geht es inhaltlich um ein Besingen der (zum Teil vermeintlichen) Vorteile Wiens, um Weinseligkeit, alkoholisch begründete Aggressionen und natürlich um die Darstellung des Wieners als Raunzer, als schwermütigen Melancholiker und prophylaktischen Pessimisten.
Gemeinhin gilt das typische Wienerlied spätestens seit dem legendären Schrammelquartett als dahingestorben, und alle selbst- oder fremdernannten Erneuerer haben mittlerweile eine große Zukunft hinter oder eine große Vergangenheit vor sich.
.
Unbeugsame Gestalten aus dem Wiener Untergrund
Wir schreiben das Jahr 1996. Alle? Nein! Drei unbeugsame Gestalten aus dem Wiener Untergrund leisten erbitterten Widerstand und haben damit das Genre des Wienerliedes nicht nur wiederbelebt, sondern auch weiterentwickelt und außerdem völlig andere Musikrichtungen beinahe zappaesk und wie selbstverständlich integriert. Die Rede ist von Heinz Ditsch (Akkordeon, Singende Säge, Fagott, Gesang), Paul Skrepek (Kontragitarre, Schlagzeug, Gesang) und Wolfgang Vinzenz Wizlsperger (Gesang, Euphonium, Kammblasen und Moderation).
Gemeinsam mit dem umtriebigen Stefan Sterzinger bildeten Heinz Ditsch und Wolfgang Vinzenz Wizlsperger seit 1986 das nicht gerade erfolgsverwöhnte Blues-Trio «Franz Franz & the Melody Boys», welches 1992 durch Paul Skrepek am Schlagzeug verstärkt wurde. Aber zwei Jahre später war der Ofen aus, die Combo wurde einvernehmlich aufgelöst.
In diese trostlose Situation hinein platzte nun 1996 bei Paul Skrepek ein Anruf der Veranstalter des «Herz-Ton-Festivals», die jenen wohl mit dessen Cousin Peter Paul Skrepek, Gitarrist der legendären Band von Hans Hölzel, weltweit besser bekannt als Falco, verwechselt hatten. Angefragt wurde, ob Herr Skrepek nicht so etwas wie moderne Wienerlieder für dieses Festival kreieren und diese auch zur Aufführung bringen könnte. Paul Skrepek schaltete schnell, sagte zu und aktivierte seine alten Mitstreiter.
Der Gruppenname war schnell gefunden; Von Paul Skrepeks Wohnzimmerfenster fällt der Blick direkt auf das Kollegium Kalksburg, eine Eliteschule, welche in unmittelbarer Nähe einer Trinkerheilanstalt liegt. W.V. Wizlsperger schrieb dann sogleich sein erstes großes Lied «Ois junga Mensch» und einen eher unanständigen Text zu einem angedeuteten Beatles-Thema namens «Vier Jahreszeiten». Zusätzlich studierte man noch «A oides Wossabangl» von Karl Savara & Rudi Schipper sowie «A scheene Leich» von Leibinger und Frankowski ein.
Das war natürlich zu wenig, um ein einstündiges Programm zu gestalten, aber die Zeit war knapp. So wurden die Lieder humorig in die Länge gezogen, und der stegreifstarke Herr Wizlsperger unterhielt das Publikum zwischen den Liedern mit überaus heiteren Moderationen. Das Konzert war der Geburtsschrei einer großartigen Formation, ein voller Erfolg – und gilt heute noch bei allen, die dabei gewesen sind, als legendär. Leider gibt es bis dato keine Aufzeichnung davon, ein Umstand, der sich dem Vernehmen nach aber bald ändern wird. Doch dazu später. Jedenfalls wurde das Erfolgsrezept weiterentwickelt und verfeinert – der Rest ist Geschichte…
.
Eine Band voller Atmosphäre, Humor, Betroffenheit und Anmut
Nach weiteren erfolgreichen Auftritten erschien 1997 das erste Album «Bessa wiads nimma» (Besser wird es nicht mehr). Es wurde ein regionaler Erfolg und erntete hervorragende Kritiken. In der ursprünglichen Form ist es schon lange nicht mehr erhältlich, wurde aber kürzlich – aufgemascherlt durch viele, aber unverzichtbare Bonustracks – neu aufgelegt.
Auf diesen Lorbeeren ruhte man sich keineswegs aus, eine Zusammenarbeit mit dem Koehne String Quartet führte 1998 zu dem ebenfalls längst vergriffenen Album «Oid und blad» (Alt und dick), das nur 22 pralle Minuten lang war und 2005 neu aufgelegt wurde. Durch wertvolles Zusatzmaterial erreicht die CD nun eine Spielzeit von 48 Minuten.
1999 wurde das Album «Sis Wos Se Bittls» produziert, das unter anderem einige in Mundart übertragene Beatles-Covers enthielt (aber auch z.B. eine Live-Version des Gassenhauers «Hinz und Kunz»). Die Rechte-Inhaber einiger der darauf vertretenen Songs verweigerten allerdings die Freigabe, und so war dieses Album nie offiziell erhältlich, steht aber auf der Website der Künstler als Gratisdownload zur Verfügung. Wer einmal z.B. «Yesterday» als «Blosndee» (Blasentee) gehört hat, wird das Original nie mehr ohne Erheiterung hören können. 2000 erschien schließlich, ebenfalls sehr ambitioniert, «S spüt si o» (Es spielt sich ab), bei dem erstmals der großartige Klarinettist Martin Zrost mitwirkte.
Mit dem 2003 aufgelegten Konzeptalbum «A Höd is a Schiggsoi» (Ein Held zu sein ist ein Schicksal) legten die drei Musikanarchisten ihr wohl ambitioniertestes Werk vor – ein Album, das offenbar geboren werden wollte, das Homers Odyssee in die Wirtshäuser verlegte, ein dringliches Werk, das wie kein anderes zeigt, dass bei dieser Formation immer große Kunst entsteht, egal, was da herausgelassen wird. Martin Zrost steuerte ein entfesseltes Klarinettenspiel bei, und die japanische Performance-Künstlerin Yoshie Maruoka verzauberte mit verbindenden Texten die eigenartigen Gesamtstimmung des Albums.
2005 erschien «Imma des Söwe» (immer das Selbe), eine Platte, auf dem die drei Herren wieder mehr zu den wienerischen Wurzeln zurückkehren, das aber trotzdem mehr als nur einen Hauch von globalen Weltmusikeinflüssen beinhaltet.
2008 wurde das meiner Meinung nach zugänglichste Album «Wiad scho wean» (wird schon werden) veröffentlicht, das erstmals eine Georg-Danzer-Cover-Version (Ruaf mi net au) enthielt und in weitere – bisher leider nur live zu hörende – großartige Interpretationen von Liedern dieses zumeist völlig unterschätzten österreichischen Musikers ausarten sollte.

Die drei «Kalksburger» Heinz Ditsch, Paul Skrepek und Wolfgang Vinzenz Wizlsperger beim Wiener Heurigen
Im Herbst 2010 führte dann die Zusammenarbeit mit Martin Zrost und Oskar Aichinger (Piano) zu dem wohl bisher ehrgeizigsten Projekt des Klangkombinats Kalksburg, dessen musikalischer Output sich nunmehr weit vom Wienerlied entfernt. Verstärkt mit Thomas Berghammer (Trompete), Hannes Enzlberger (Bass), Christian Gonsior (Saxofon) und Clemens Hofer (Posaune) trat man z.B. mehrmals im Wiener Jazz-Club Porgy & Bess auf. Paul Skrepek bedient statt der Kontragitarre in dieser Formation das Schlagzeug und zeigt dabei, dass er ein absoluter Weltklasse-Drummer ist, der selbst in dieser «Big-Band» Akzente setzen kann.
Eigene Lieder aus der bisherigen glorreichen Vergangenheit werden ebenso verabreicht wie neues Material, völlig respektlos zeigt man dem «Buena Vista Social Club» vor, wie man sowas in Wahrheit herbläst und welche Texte da wirklich dazu gesungen werden müssen; «Arrivederci Roma» wird gespielt wie eine Schallplatte, die dauernd hängen bleibt und dann weiterspringt, das Original wird dadurch für alle Zeiten unanhörbar, und man kann nur staunen, wie spielerisch derart schwierige Aufgaben gelöst werden.
Zudem gibt’s Brachiales in jeder Form, dass es nur so kracht, und nicht mal vor Robert Stolz, Udo Jürgens oder Adamo wird halt gemacht. Eine Band also, die eine Fülle an Atmosphäre, Humor, Betroffenheit und musikalischer Anmut bereitstellt.

Das Trio verstärkt zum Klangkombinat mit Thomas Berghammer (Trompete), Hannes Enzlberger (Bass), Christian Gonsior (Saxofon) und Clemens Hofer (Posaune) im Radio-Kulturhaus des ORF
.
Dreitägige Band-Jubiläumsfeier im Spittelberg-Theater
Mitte September wird im Wiener «Theater am Spittelberg» drei Tage lang das Bandjubiläum gefeiert werden. Am ersten Tag wird in der Urformation gegeigt, am zweiten Tag wird «A Höd is a Schiggsoi» aufgeführt, am dritten Tag soll – chronologisch korrekt – das Klangkombinat aufspielen. Dem Hörensagen nach wird bei dieser Gelegenheit ein neues Album präsentiert, dem als Bonus-CD das legendäre erste Konzert beiliegen soll.
Wenn nun ein wenig der Eindruck entstanden ist, dass das Kollegium Kalksburg in erster Linie eine Cover-Band sei, so möchte ich diesen in aller Deutlichkeit zurechtrücken. Alle drei Musiker schreiben eigenständige Lieder, die einerseits der Wiener Tradition verpflichtet sind, andererseits einen unverkennbaren Stil aufweisen und durch den ganz eigenen Sound dieser Formation ein Eigenleben entwickeln, wie man das sonst nur bei den ganz Großen findet. Auch die Texte des Kollegiums, für die primär W.V. Wizlsperger verantwortlich zeichnet, führen dort weiter, wo z.B. ein Helmut Qualtinger aufhören musste – und das auch noch mit Riesenschritten: Sie sind Paradebeispiele dafür, wie sich hundsordinäre Ausdrücke, Weinerlichkeit und Weinseeligkeit, verkaterte Aggression, banale Einsichten, große Weisheiten und aussichtslose Tragödien zu großer Kunst ausformen können.
Nicht zuletzt durch die Tätigkeit dieser drei Gestalten hat das Wienerlied wieder in der österreichischen Musikkultur Fuß gefasst, und Formationen wie «Die Strottern» oder auch die «Mondscheinbrüder» zeigen mittlerweile auf, dass neues Publikum für diese Musikform interessiert werden kann. Auf die Entwicklungen der nächsten 15 Jahre darf man also gespannt sein. ▀
Discographie – Videos – Homepage
.
.
Lyrik-Essay von Bernd Giehl
.
Nachdenken über Luxus
Einige Anmerkungen zum Schreiben von Gedichten
.
Bernd Giehl
.
.
Das kleine Gesicht im Wintermantel:
Trauermund, Warteaugen, Schrittklein
in den Hof, den Stall, die Viehspuren
im Straßenschmutz schon lang verwischt.
Waldmeisteressenz und Brunnenwasser
gegen den großen Durst.
Neben der Wasserbank eine Schöpfkelle.
Sigfrid Gauch: «Morgentod»
.
I
32 Worte. So viel wie wir Normalsterblichen sonst für drei Sätze benötigen. 32 Worte nur, aber ein Text, an dem das Auge hängenbleibt, den man wieder und wieder liest, fast wie eine Offenbarung, den man wahrscheinlich nie mehr vergisst.
32 Worte. Gefunden in einer Spalte namens «ZEITmosaik» in der «ZEIT» vom 28. Juni 97. Eine Spalte, über die ich sonst schnell hinweglese; den Namen des Verfassers, Sigfrid Gauch, habe ich vorher noch nie gehört. Aber dieses Gedicht rührt mich an, wie nur weniges sonst. Fast möchte ich behaupten: es ist «vollkommen». Vollkommen wie eine Arie aus der «Matthäuspassion» von Bach. Oder wie ein Bild von Manet.
Und jetzt höre ich auch schon wieder das Wetzen der Messer. Darf man das, über «Schönheit» nachdenken, wenn doch allgemein eher «Hässlichkeit» angesagt ist? Seit Baudelaire seine «Fleurs du mal» schrieb, seit Rimbaud eine «Zeit in der Hölle» verbrachte, seit dem Beginn der «Moderne» also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, lebt die Kunst – Malerei, Literatur, Musik – doch eher von der Dissonanz, der Beschreibung des Hässlichen und Abstoßenden. Die Kunst reagierte damals auf die zunehmende Hässlichkeit, hervorgerufen vor allem durch die Industrialisierung. Dass es seither aufwärts gegangen wäre mit der Welt, kann man eigentlich nicht behaupten.
Wäre also nicht statt des Nachdenkens über Gedichte ein flammender Protest gegen den Afghanistan-Krieg oder die ewigen Streitereien der schwarzgelben Regierung angesagt? Das alles sind sicher wichtige Themen. Und doch will ich hier nur eins tun: über Gedichte nachdenken. Über das, was mich und sicher auch andere an ihnen fasziniert.
Vermutlich sind Gedichte unnötig. Wahrscheinlich brauchen wir viel eher Arbeitsplätze als Gedichte. Aber wer Brot hat, möchte womöglich irgendwann auch Butter dazu. Das ist unverschämt; ich weiß. Gut möglich, dass eines Tages der Genuss verboten wird, weil er unmoralisch ist; in Amerika sind sie ja schon so weit. Solange der Genuss jedoch noch nicht verboten ist, (solang man sogar noch in der Öffentlichkeit rauchen darf), solange kann man einstweilen noch über Gedichte nachdenken. Und was es eigentlich ist, das sie (oder jedenfalls manche von ihnen) über die Banalität all dessen erhebt, was täglich geredet und geschrieben wird.
.
II
Die Schönheit von Gedichten also. Und zwar nicht von Goethe- oder Eichendorff-Gedichten, sondern von moderner Lyrik. Auch ein Gedicht wie Goethes «Über allen Wipfeln ist Ruh» ist «schön», aber wer heute noch so schreiben würde, wäre ein hoffnungsloser Fall. Bilder von erhabenen Gipfeln, von rauschenden Bächen, das geht nicht mehr; an ihre Stelle muss anderes treten. Auch die Formen sind andere geworden; Hexameter und Jambus, das war einmal, obwohl es mittlerweile auch wieder Gedichte mit Endreim gibt. Überhaupt ist es schwieriger geworden, von «Form» zu sprechen, wo so viele Formen sich aufgelöst haben und neue Formen zwar entstanden, jedoch nur schwer abzugrenzen sind. Zwischen einem Rilke-Gedicht und einem Gedicht von Erich Fried stehen Welten, und wer das nicht glaubt, lege einmal Frieds «Maßnahmen» neben die «Duineser Elegien».
Und dennoch gibt es etwas, was Lyrik abgrenzt von Prosa, was sie erkennbar macht. Wo eine Geschichte oder ein Roman Zeit braucht, um sich zu entwickeln, Spannung zu erzeugen oder was immer auch den Leser daran hindert, zur Fernbedienung zu greifen, da muss das Gedicht in wenigen Zeilen das Gleiche leisten. Und das kann es nur durch seine besondere Sprache, die so schwer zu benennen ist: «leuchtend» vielleicht, oder «verdichtet». Dabei spielt der Rhythmus immer noch eine große Rolle, und auch die Bilder, die ein Gedicht verwendet, sind wichtig. Oft sind es ungewohnte, vielfach nur angedeutete Bilder, wie man an Gauchs Gedicht sehen kann. Dieses Gedicht besticht mit seiner Sprache. Ungeheuer konzentriert ist sie, fast möchte ich sagen: «sinnlich». Verkürzt gesagt: ein Roman kann notfalls auch mit einer schwächeren Form auskommen; für ein Gedicht ist das tödlich.
Fragen wir also ruhig einmal nach der Besonderheit der lyrischen Sprache. Und nehmen wir – pars pro toto – Gauchs Gedicht «Morgentod» dazu. Was wahrscheinlich als erstes bei diesem Gedicht ins Auge springt, sind die ungewöhnlichen Substantive in der zweiten Zeile: «Trauermund» – doch ja, das könnte man schon einmal gelesen haben; «Warteaugen» – schon schwieriger; aber «Schrittklein» – das sieht nun doch schon sehr nach Neuschöpfung der Sprache aus;. Was ja in der Lyrik nichts Ungewöhnliches ist, auch wenn das Überraschungsmoment sonst eher in der Zusammenstellung der Bilder liegt (unübertrefflich, auch hier, Paul Celan, z.B. in «Spät und Tief»: «Boshaft wie goldene Rede beginnt diese Nacht/ wir essen die Äpfel der Stummen …»)
Nun bringt der Vergleich mit Celan nicht allzu viel ein, denn dieses Gedicht ist eigentlich nicht «dunkel», auch wenn es sich gewiss nicht dem ersten flüchtigen Lesen erschließt. Wenn man genauer hinsieht, erkennt man, dass hier die Verben fehlen. Ein paar Adjektive und Präpositionen; ansonsten nur Substantive. Die Person, die hier «handelt» ist absichtlich im Unklaren gelassen. Beschrieben wird eigentlich nur ihr Gesicht: «Das kleine Gesicht im Wintermantel:/ Trauermund, Warteaugen, Schrittklein»; möglich dass es sich um ein Kind handelt, aber vielleicht ist es auch ein Erwachsener, der an einen Ort seiner Kindheit zurückkehrt. Dieser Ort ist ein Bauernhof. Der Brunnen, der hier (wiederum indirekt) erwähnt wird, läßt Vergangenes erahnen; möglich, dass dieser Hof schon lange nicht mehr bewirtschaftet wird. Allenfalls als Wohnung dient er noch, und doch ist er ein wichtiger Ort für den Sprecher, das «lyrische Ich». Durch das Gedicht bekommt dieser Ort eine Bedeutung, die der reale Hof nie gehabt hat. Die gewollte Unschärfe der Beschreibung – alles wird nur angedeutet – setzt die Phantasie des Lesers in Gang. Er ist es, der den Zwischenraum zwischen den Worten füllen muss mit eigenen Assoziationen. Seine Erinnerung wird gebraucht. Und das ist es wahrscheinlich, was den Leser schließlich in seinen Bann zieht.
.
III
Die Sprache ist es also, die ein Gedicht ausmacht. Eine Sprache, die eher andeutet als benennt, die Zwischenräume schafft, die es nötig macht, dass man zwischen den Zeilen liest. Sie kann feierlich sein, ungewohnt, sie kann mit ungewöhnlich zusammengesetzten Bildern arbeiten, aber sie muss es nicht. Es gibt auch (scheinbar) lakonische Gedichte; dafür ein Beispiel aus dem «Jahrbuch der Lyrik 97/98», (in dem ich später auch Gauchs Gedicht gefunden habe):
Seit ich hier bin
Seit ich hier bin trage ich Taschen
voller Papiere, fahre ich Fahrstuhl
telefoniere, trinke Kaffee wie ein Mann
mit Terminen , liege ich schlaflos,
interpretiere, huste und reime, traurige
Tiere, spende dem Geiger in der Passage
einen Gedanken, was ist das Leben,
wenn nicht ein Geigen in den Passagen,
was kann er tun und was soll ich sagen:
Pflege Kontakte und streue Asche auf
deine Akte. So ist das hier.
Hans Ulrich Treischel
.
Auch hier werden, wie in «Morgentod», Orte benannt. Aber im Gegensatz zu dem eingangs besprochenen Gedicht sind es Orte, die nicht viel bedeuten: ein Büro, der Fahrstuhl, eine Passage. Der Tonfall ist locker, ironisch. So ganz ernst scheint das «Ich» in diesem Gedicht sich nicht zu nehmen. Der, der hier spricht, ein Angestellter offensichtlich, schaut sich selbst über die Schulter. Natürlich muss er so tun, als ob er arbeite, aber er nimmt das alles nicht so eng; womöglich schreibt er sogar Gedichte in seiner Arbeitszeit.
Doch wenn man genauer hinschaut, ist die Lakonie, die einem förmlich entgegenspringt, nichts als eine Maske. Eine schwer greifbare Trauer spricht aus diesem Gedicht, eine Trauer über das mit Akten und Terminen vertane Leben. Das Leben ist ein «Geigen in den Passagen»; offensichtlich wird der Straßenmusikant zu einem Bild für das geschäftige Leben, das den armen Straßenmusikanten dort stehenlässt, wo er steht. Es gibt wohl kaum einen ungeeigneteren Ort für einen Musiker als die Straße. Leute bleiben kurz stehen und hören zu, aber sie haben keine Zeit, das ganze Stück anzuhören, also werfen sie eine Mark in den Geigenkasten und gehen weiter. Lieber als hier zu stehen würde man an der Met spielen oder bei den Wiener Philharmonikern, aber was will man machen, es gibt einfach zu viele Musiker, Künstler, Dichter, Menschen…
Es ist die Kunst dieses Gedichts, diese – doch eher schweren – Gedanken hinter der (scheinbaren) Leichtigkeit des Tons zu verbergen. Kunstvoll ist auch der Reim, der sich durchzieht, aber nicht als Endreim, sondern an den Zeilenanfängen, wo man ihn nicht beim ersten Lesen bemerkt. Überhaupt muss man auch dieses Gedicht mehrmals lesen, bis es sich einem erschließt. Aber davon sprachen wir schon.
.
IV
Und da kommt mir nun ein Begriff in den Sinn, der für mein Verständnis von Literatur eine große Rolle spielt, den man aber auch auf Lyrik im Besonderen anwenden kann. Es ist der Begriff des Spiels. Gedichte – so denke ich – «spielen» mit ihrem Gegenstand. Woraus auch immer sie entstehen – und das ursprüngliche Material kann so banal sein wie es will -, sie verwandeln dieses Material.
Gedichte spielen mit Bildern, Rhythmen, Reimen, mit Assoziationen, Klängen, Bedeutungen, mit allem, was ihnen zwischen die Buchstaben gerät. Es ist ein Spiel, dessen Regeln sich nicht von vornherein festlegen lassen; aber natürlich gibt es Regeln, weil sonst das Spiel aufhörte, Spiel zu sein. Gedichte schreiben ist ein hoch artifizielles Spiel; man kann es erlernen, wie man das Jonglieren erlernen kann; man braucht dazu Begabung und einiges an Übung.
Vor vielen Jahren hat der Literaturwissenschaftler Mario Andreotti in der Schweizer Literaturzeitschrift «Scriptum» die assoziative Verknüpfung ansonsten disparater Wortgruppen, das Weglassen von Verben und die Verknappung als Zeichen eines guten Gedichts genannt. («Was ist heute ein gutes Gedicht? Über einige Kriterien zeitgenössischer Lyrik», in: «Scriptum» 21/95) Dies können Kriterien für ein gutes Gedicht sein; sie haben aber keinen Ausschließlichkeitscharakter, wie man an dem Gedicht von Treischel, aber auch an vielen Gedichten von Brecht z.B. deutlich erkennen kann.
Sind Gedichte also Luxus? Für die Verleger ganz bestimmt; an einem Gedichtband verdienen sie nur in den wenigsten Fällen. Für die Leser wahrscheinlich auch: sie informieren weder über den Börsenkurs noch geben sie Hinweise, wie die politische Situation zu verändern sei. Womöglich sind sie nicht einmal unterhaltsam oder belehrend, wie ein Roman das sein kann.
Mag sein, dass sie einfach nur spielen: mit dem Klang, den Worten, den Bedeutungen, mit der Sprache. Dem «l’art pour l’art» stehen sie meist näher als ein Roman oder eine Geschichte. Romane müssen, Gedichte können Inhalte transportieren. Womöglich ist so manches Gedicht mehr dem schönen Klang geschuldet, als dass es wichtige Gedanken zu transportieren gehabt hätte, auch wenn ich natürlich nicht verrate, an welche Gedichte oder welchen Dichter ich denke. Auf die Klanggedichte z.B. eines Franz Mon, die allen Wert auf «Form» legen, denen die Worte nur Material sind und keine Botschaften transportieren, sei hier nur am Rande hingewiesen.
Aber warum soll ein Gedicht nicht einfach nur «Schönheit» vermitteln? Oder das Spiel mit der Sprache ins Extreme treiben, wie es die schon erwähnten Poeten tun? Sprache ist eben Bedeutung und Klang, und genau das ist es, was Gedichte sich zunutze machen. Oder andersherum: ohne diese Tatsache würden Gedichte gar nicht geschrieben werden können.
Doch ja, Gedichte sind Luxus. Und der Forderung nach Hässlichkeit kommen sie auch eher in seltenen Fällen nach. Man muss Luxus nicht mögen. Man kann durchaus auch auf ihn verzichten. Manchmal sprechen Gedichte – wie das eingangs zitierte von Gauch – von Dingen und Orten, die es (so) nicht mehr gibt.
Wer will, kann das für «reaktionär» halten. Ich für meinen Fall würde auf manches andere lieber verzichten wollen als auf Gedichte. ■
.
___________________________________________
Geb. 1951 in Marienberg/D, Studium der Theologie in Marburg, verschiedene literarische und theologische Publikationen, lebt als evang. Pfarrer in Nauheim
.
.
Themenverwandte Links
Dichten mit Google – Welttag der Poesie – PEN-Tagung – 175 Jahre deutsche Gedichte – Ein schönes Gedicht – Literarische Selbstkritik – Lyric Gallery – Explosive Poetin – Über allen Wipfeln ist Ruh
.
.
Sprach-Essay von Karin Afshar
.
Der Verlust der Herkunft
Dr. Karin Afshar
.
Davon, was Sprache ist, warum die Menschen die Fähigkeit zu sprechen haben und was sie mit dieser anstellen, gibt es unzählige Bücher. Deshalb ist es von mir recht vermessen, in einem kleinen Essay skizzieren zu wollen, warum Sprachen untergehen, und wie sich dies und mit welchen Konsequenzen vollzieht.
Der Auslöser für dieses Unterfangen war die Beobachtung, dass Menschen um mich herum mehr als sorglos mit ihrer Sprache umgehen. Es ist selten der Fall, dass schon vor dem Schreiben eines Artikels der Titel feststeht. Ich schrieb ihn tatsächlich gleich so, wie er oben steht, auf.
Aber ich muss von vorne anfangen, bei zwei Männern, die in den 30er und 60er Jahren um Worte rangen, das Verhältnis des Menschen zu seiner Sprache aufzuzeichnen. Benjamin Lee Whorf und Edward Sapir waren nicht die ersten und nicht die letzten, die herausarbeiteten und beschrieben, dass das linguistische System (und mit ihm die Struktur, die Grammatik) jeder Sprache nicht nur ein reproduktives Instrument zum Ausdruck von Gedanken ist, sondern vielmehr selbst die Gedanken formt.
Welche Sprache Menschen auch sprechen – jede ist Schema und Anleitung für die geistige Aktivität des Individuums, für die Analyse seiner Eindrücke und für die Synthese dessen, was ihm an Vorstellungen zur Verfügung steht. Die Formulierung von Gedanken ist kein unabhängiger Vorgang, sondern er ist von der jeweiligen Struktur beeinflußt. Der Vorgang des Ausdrückens von Gedanken ist daher für verschiedene Grammatiken als mehr oder weniger verschieden anzunehmen.
Das Denken ist nicht bloß abhängig von der Sprache überhaupt, sondern bis auf einen gewissen Grad, auch von jeder einzelnen bestimmten. (Wilhelm von Humboldt)
Als Sprachlehrerin, als die ich tätig bin, kann ich jeden Tag in meinem Unterricht beobachten, wie wirksam diese sprachliche Relativität ist. Wer Deutsch sprechen können will – und damit werden wir mit einer Sprache konkret -, muss Deutsch denken. Das bedeutet, dass er sich der Mittel, die das Deutsche zur Verfügung stellt, bedienen muss, um seine Gedanken oder Informationen so auszudrücken, dass er von anderen Deutsch-Sprechenden verstanden wird. Das gilt analog natürlich für jede Sprache, für Türkisch, Englisch, Japanisch, um nur drei Sprachen zu nennen. Kann der Sprecher dies nicht, findet der Angesprochene seine Welt nicht abgebildet. Wenn wir eine neue Sprache lernen, tun wir dies auf der Grundlage von bereits erworbenen Strukturen, die wir in den wenigsten Fällen hinterfragen, sondern eben einfach verwenden.
Grammatik – für viele Menschen mit unguten Erinnerungen behaftet – ist das System der Regelhaftigkeit einer Sprache. Regeln können in der einen so, in der anderen eben anders sein. Egal wie: beim Erlernen einer Sprache suchen wir nach Regeln bzw. immer wieder auftauchenden Mustern. Wenn wir sie entdecken, können wir sie anwenden, aber manchmal steht selbst dem noch etwas im Wege.
Grammatik ist nun nicht das einzige, was eine Sprache ausmacht – es geht auch um den Wortschatz, d.h. die Laute, die in einer bestimmten Abfolge artikuliert Ausdruck eines Inhalts sind, über den Übereinkunft besteht. Mehrere in bestimmter Reihenfolge geäußerte Laute erhalten eine Bedeutung, die ein Kenner derselben Laute versteht.
Sprache ist die Übereinkunft von Menschen und gewährleistet damit Kommunion.
Dinge, die in der Welt rund um eine (Sprach-)Gruppe herum vorkommen, wird diese alsbald benennen. Alles für den Alltag Relevante wird eine Bezeichnung bekommen. Jenes allerdings, was für den Alltag einer Sprachgemeinschaft – und von einer solchen sprechen wir hier – nicht relevant ist, wird weder benannt noch überhaupt gesehen.
Verschwinden Dinge des Alltags aus dem Blickfeld, verschwindet mit ihnen das alte Wort. Er- scheinen neue Gegenstände, auf welchem Wege auch immer, dann wird dafür ein neues Wort geschaffen. Sprache ist weder unveränderlich noch statisch, sie ist kein Werk, sondern eine immerwährende Tätigkeit.
Menschen begegnen Menschen, Sprachen begegnen sich in ihnen. Es kommt zum Austausch und zur Übernahme von Wörtern, auch wenn die «fremden» Wörter dasselbe Ding bezeichnen.
Ergon ist die laut- und formbezogene Grammatik einschließlich der Wortbildung, die als notwendiges Durchgangsstadium zu einer Energetischen Sprachauffassung angesehen werden kann.
In der deutschen Sprache gibt es eine Reihe neuer Wörter. Über die Flut der Anglizismen ist hinreichend geplärrt und es ist vor ihnen gewarnt worden. Die Anzahl nicht nur englischer Wörter in der Rahmensprache Deutsch nimmt stetig zu. Und die Übernahme von Wörtern hat natürlich eine Rückwirkung auf die Grammatik. Was für ein Prozess aber ist das, der immer tiefer in die Struktur des Deutschen eingreift?
Eine mir lieb gewordene Firma legte im letzten Monat ihren deutschen Namen ab und benennt sich nun Englisch. In der Computer-und in der Medienbranche tragen die technischen und medialen Errungenschaften englische Bezeichnungen. Berufsbezeichnungen (man schaue sich einmal die Stellenanzeigen an) und Studienabschlüsse sind angliziert. Versteht noch jemand, was damit eigentlich gemeint ist?
Nun gab es auch früher «Fremdwörter»; im Deutschen gibt es nicht wenige aus dem Französischen, aus dem Lateinischen, dem Griechischen – sie sind schon lange da und gehören «zu uns». Ich persönlich stecke mein Geld ins Portemonnaie, sitze gerne auf der Couch, beim Arbeitsamt ziehe ich eine Nummer und bin total frustriert, wenn ich lange warten muss.
Das so englisch klingende Wort Mobbing gibt es im Englischen nicht, und schon mal gar nicht in der Bedeutung, die es im Deutschen hat. Fitness ein anderes Beispiel, Handy ein nächstes. Fussball wird bei der hiesigen WM zum public viewing-Ereignis.
Neben der Unsitte, englischklingende Wörter zu erschaffen – was beinahe schon wieder ulkig anmutet -, geschieht mit den und durch die nichtdeutschen Wörtern jedoch noch anderes. Wir haben es mit Bedeutungserweiterungen einerseits und mit Bedeutungsverengungen andererseits zu tun.
Die neuen Wörter – sofern es Substantive sind – benötigen im Deutschen einen Artikel. Die Artikelwörter sind das Trauma jedes Deutschlernenden, der aus einer Sprache kommt, in der es kein grammatisches Geschlecht gibt. Die Regelhaftigkeit erschließt sich nur sehr schwer, da lernt man sie am besten gleich zusammen!
Welchen Artikel gibt man einem Fremdwort? Man hört die Mail und das Mail. Es ist auf Deutsch «die Post» – daraus folgt, dass die Tendenz zum femininen Artikel groß ist. Andererseits gilt: Fremdwörter sind grundsätzlich «das»: das Automobil, das Handy, das Mobile…
Weiterhin brauchen die neuen Wörter eine Pluralform. Im Deutschen gibt es – gewachsen aus der Sprachgeschichte – 8 Pluralformgruppen. «Typisch» für das Deutsche ist die Stammvokaländerung, die auch an anderen Stellen wirksam wird.
Die neuen Wörter bekommen überwiegend ein Plural-s, oder verbleiben in der Form des Singulars (der Computer, die Computer – immerhin in der Anwendung einer Regelmäßigkeit).
Verben sind ein nächster fruchtbarer Boden. Sie tragen im Deutschen im Infinitiv ein -en. to load down wird zunächst zu to download, (ist es ein trennbares Verb?), dann zu downloaden. Wohl dem, der der englischen Schriftkonvention mächtig ist, und das Wort englisch aussprechen kann, wenn er es liest.
Bei richtiger englischer Aussprache bleiben die neuen Wörter Fremdkörper im Deutschen: die offenkundig andere Aussprache passt sich nur störrisch in die deutsche Sprachmelodie ein, und was für ein Spagat, wenn dann auch noch ein Perfekt gebildet werden muss: das habe ich gedownloaded/ downgeloaded.
Der Einbruch des Englischen in das Deutsche ist gleichsam elitär gegenüber dem, was in anderen Teilen der Republik vor sich geht. Die Kanaksprak, Identifikationsmedium einer neuen Kultur, ist alles andere als lustig – sie ist ein Symptom. Wofür, fragen Sie?
Die englische Sprache ist der unseren vorausgegangen, und an ihr können wir etwas lernen. Englisch diente und dient als lingua franca und wurde in die entferntesten Winkel der Welt, als der Handel und nicht nur der begann, getragen. Englisch wird von weit mehr Menschen gesprochen als tatsächlich englische Muttersprachler sind. Es ist die zweite Sprache vieler Menschen, die sie lernen, um sie zu benutzen.
Das Stichwort hier lautet: benutzen. Eine lingua franca ist eine Verkehrssprache, die auf einzelnen Gebieten den Menschen den Verkehr miteinander ermöglicht.
Im Laufe der Kontakte und der Durchmischung mit immer anderen Muttersprachen wurde Englisch pidginiziert. Hervorstechendstes Kennzeichen von Pidginsprachen ist, dass sie eine reduzierte Sprachform darstellen. Als nächste Ausprägung haben wir es mit einer Kreolisierung zu tun:
Kreolsprachen sind Sprachen, die aus mehreren Sprachen entstanden sind. Dabei geht ein Großteil des Wortschatzes der neuen Sprache auf eine der beteiligten Kontaktsprachen zurück.
In manchen Fällen entwickelt sich eine Kreolsprache durch einen Prozess des Sprachausbaus zu einer Standardsprache. Im Unterschied zu den Pidgin-Sprachen sind Kreolsprachen sogar Muttersprachen.
Vor allem die Grammatik, aber auch das Lautsystem der neuen Sprachen sind von jenen der beteiligten Ausgangssprachen deutlich verschieden. Der Prozess dauert lange, und wir sprechen hier abstrakt von «Sprachen». Was macht es aber mit den Sprechern?
Bestandsaufnahme:
1. Neue, fremde Wörter und Begriffe werden nicht adäquat angewendet; 2. Die Wörter verändern die Strukur der Rahmensprache, nicht selten gehen Strukturelemente verloren; 3. Stehen bestimmte Strukturen nicht mehr zur Verfügung, wird nicht mehr in ihnen gedacht; 4. Was nicht gedacht werden kann, weil die Strukturen fehlen, bleibt ungesagt; 5. Der genaue Ausdruck geht verloren; 6. Man trifft sich im Unsagbaren.
Menschen, die eine Sprache nur als Ruine bewohnen, können auch nur ruinenhaft denken.
Und so gerät die Herkunft ins Wanken, wenn das Bewusstsein nicht nachkommt. Sprache ist – und war es immer – Heimat. Und wenn man seine Sprache verliert, verliert man die Heimat, und wenn man seine Heimat verliert, ist es um die Sprache hart bestellt.
Das hat übrigens nichts mit Denken in Nationalstaaten (deren Etablierung sogar nachgerade Sprachzugehörigkeiten ignoriert) oder Intoleranz zu tun, sondern ist die Frage eines Standortes. Nur wenn man den hat, kann man Schritte in das Andere, Fremde, Neue nehmen, und den Fremden für das Eigene, für ihn Neue begeistern. Gibt man seinen Standort auf, steht man im Nichts. ■
.
___________________________________
Geb. 1958 in der Eifel/D, Studium der Sprachwissenschaft, Finn-Ugristik und Psychologie, Promotion, zahlreiche belletristische und fachwissenschaftliche Publikationen, Geschäftsführerin des Korshid-Verlages, Herausgeberin und Lektorin
.
.
Essay von Mario Andreotti
.
Ist Dichten lernbar?
Über Sinn und Unsinn von Schreibseminarien
Prof. Dr. Mario Andreotti
.
In den letzten Jahrzehnten sind sie im deutschen Sprachraum, zunächst in Deutschland und dann auch in Österreich und in der Schweiz, wie Pilze aus dem Boden geschossen: Die verschiedenen, keineswegs immer billigen Schreibwerkstätten, Seminarien, Literaturkurse und Fernlehrinstitute für angehende Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Dazu kamen und kommen eine steigende Zahl von Büchern und Zeitschriften, die dem Leser mehr oder weniger deutlich suggerieren, sie enthielten «todsichere» Rezepte für ein gutes Schreiben. Das reicht dann von relativ neutralen Titeln, wie etwa dem «Verlegerbrief», über Titel, die wie «Grundlagen und Technik der Schreibkunst» schon handfester tönen, bis zu solchen, die unverhohlen versprechen, der Leser werde durch die Lektüre der betreffenden Publikation «garantiert schreiben lernen». Dieses zunehmende Angebot an Schreibhilfen, allen voran an Schreibwerkstätten und «Kursen für kreatives Schreiben», lässt einmal mehr die Frage aufkommen, ob sich denn das Dichten überhaupt lernen lasse. Es handelt sich um eine Frage, die fast so alt wie die Dichtung selber ist, und die im Verlaufe der Literaturgeschichte ganz unterschiedlich beantwortet wurde.
Ist Dichten also lernbar?

«Poetischer Trichter – Die Teutsche Dicht- und Reimkunst, ohne Behuf der lateinischen Sprache, in VI Stunden einzugießen» (Georg Philipp Harsdörffer, 17.Jh.)
Hätte man diese Frage einem Literaten etwa des 17.Jahrhunderts, also der Barockzeit gestellt, so hätte er sehr wahrscheinlich leicht verwundert zur Antwort gegeben, natürlich sei das Dichten lernbar, und dies genau so exakt wie beispielsweise das Malen oder das Musizieren. Wozu habe man denn die Poetik, wenn nicht dazu, dem Poeten die Regeln für sein literarisches Handwerk zu liefern. Man war damals nämlich der Überzeugung, ein Autor schreibe nur dann gut, wenn er bestimmte, durch literarische Autoritäten vorgegebene Regeln strikte beachte. So hatte beispielsweise ein Dramatiker, ob es ihm gefiel oder nicht, die berühmte Regel der drei Einheiten von Ort, Zeit und Handlung, die angeblich auf die Poetik des Aristoteles zurückging, zu befolgen. Tat er dies nicht, so war er literarisch, und nur allzu oft auch gesellschaftlich, geächtet. In der Literaturwissenschaft spricht man deshalb von einer normativen Poetik, von einer Poetik also, die glaubte, die Schriftstellerei sei ein Handwerk wie jedes andere, das man nach bestimmten Regeln zu betreiben habe. Ein extremes Beispiel für diese normative Auffassung der Poetik ist der vielzitierte Nürnberger Trichter von Philipp Harsdörffer, der als «Anweisung, die Teutsche Dicht- und Reimkunst in sechs Stunden einzugiessen» gedacht war. Noch heute erinnern gewisse Lehrbücher der Dichtung, die sich mit ihren handfesten Schreibezepten fast wie Kochbücher geben, an diesen Nürnberger Trichter.
Dichten als subjektives Geschäft
Gegen Ende des 18.Jahrhunderts, literaturgeschichtlich mit dem Beginn des Sturm und Drang, wandelt sich das Bild: Die überkommene Vorstellung, die Dichtung habe einem bestimmten Regelkanon zu gehorchen, wird zunehmend durch die Ansicht abgelöst, sie habe möglichst originell, möglichst schöpferisch zu sein. «Kreativität» und «Originalität» -man denke etwa an die für die Stürmer und Dränger typische Wortschöpfung des «Originalgenies»- werden zu den beiden Leitbegriffen, welche die Dichtung der folgenden zwei Jahrhunderte weithin bestimmen sollten. Womit dieser Wandel in der Auffassung von Kunst zusammenhängt, ist einigermaβen offensichtlich: Wo der abendländische Mensch, wie dies seit der Aufklärung der Fall ist, seine Individualität, aber auch seine Autonomie den «Dingen» gegenüber «entdeckt», da hat dies Rückwirkungen auf das Selbstverständnis der Autoren. Sie fühlen sich nun nicht mehr als jene, die literarische Texte nach einer bestimmten, vorgeformten «Regelpoetik» machen, sondern als Menschen, die sich von ihrer schöpferischen Intuition, von einer Art Inspiration – die Nähe zur alten, religiös fundierten Vorstellung des «poeta vates» ist offenkundig – leiten lassen. Noch ein Friedrich Dürrenmatt huldigte dieser gleichsam irrationalen Auffassung von Dichtung und vom Autor, wenn er im Hinblick auf seine Stücke immer wieder den «poetischen Einfall» betonte.
Der eben skizzierte Wandel im Dichtungsverständnis ist nun äuβerst folgenreich: Hatte vorher die Ansicht bestanden, Dichten sei lehr- und lernbar, so trat seit dem Sturm und Drang mehr und mehr die Meinung zutage, sie sei ein derart subjektives Geschäft, dass sich dafür kaum auch nur einigermaßen verbindliche Normen aufstellen lieβen. Damit war es auch mit der Vorstellung von der Lernbarkeit des literarischen Handwerks gründlich vorbei. Dies erklärt weitgehend, warum es im deutschen Sprachraum Schulen für Architekten, Bildhauer, Maler und Musiker, kaum aber solche für Schriftsteller gibt. In den USA und beispielsweise auch in Russland ist das bekanntlich ganz anders: Da existieren an den Universitäten neben den literaturwissenschaftlichen eigene Schriftstellerfakultäten, in denen angehende Autoren, angeleitet durch Praktiker ihres Faches, das Formwissen um alle dichterischen Gattungen im eigentlichen Sinne lernen. Bei uns aber hält man so etwas für eine Sünde wider den Heiligen Geist der Dichtung, warnt man in einer oftmals geradezu grotesk wirkenden Scheu vor Meistersinger-Dürre und Nürnberger Trichter.
Dichten doch lernbar?
Freilich hat sich in den letzten Jahren auch im deutschen Sprachraum ein gewisser Sinneswandel vollzogen: Neben Literaturhäusern, die regelmäßig Autorenkurse anbieten, sind vor allem in Deutschland und Österreich eigentliche Schreibschulen und Literaturinstitute, wie beispielsweise die «schule für dichtung» in Wien, die «Schreibschule Köln» und das Deutsche Literaturinstitut in Leipzig, entstanden. Autorenaus- und weiterbildung, Begriffe, die noch vor einigen Jahrzehnten völlig verpönt waren, sind plötzlich in. Selbst der Schweizerische Schriftstellerverband, der Verband der Autorinnen und Autoren der Schweiz, wie er neuerdings heißt, befasst sich inzwischen ernsthaft mit dem Gedanken, seinen Mitgliedern Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Form einer eigentlichen Schreibschule anzubieten.

«Ein Gedicht entsteht überhaupt sehr selten – ein Gedicht wird gemacht» (Gottfried Benn, Probleme der Lyrik, München 1959)
Diese jüngste Entwicklung hin zum Versuch, den Beruf des Schriftstellers zu professionalisieren, hängt unter anderem zweifellos mit dem veränderten Dichtungsverständnis der Moderne zusammen, wonach Poesie, anders als etwa in Klassik und Romantik, weniger Inspiration als vielmehr Machen bedeutet. Gottfried Benns berühmter Satz «Ein Gedicht entsteht überhaupt sehr selten – ein Gedicht wird gemacht» gilt nicht nur für die moderne Lyrik, sondern für die moderne Literatur, schon ihres betonten Kunstcharakters wegen, überhaupt. Das blieb nicht ohne Rückwirkung auf das Selbstverständnis der Autoren: Verstand sich der Autor seit dem ausgehenden 18.Jahrhundert als selbstmächtiger Schöpfer eines autonomen Werkes, bei dem Inspiration und Kreativität die zentrale Rolle spielten, so versteht er sich heute zunehmend als bloßer Arrangeur, der in harter Schreibtischarbeit Texte produziert, mit literarischen Formen und Techniken ‚experimentiert’. Daraus erklären sich die auffallend vielen intertextuellen Bezüge, wie sie gerade für moderne und postmoderne Werke typisch sind. Dies wiederum setzt voraus, dass sich die Schriftsteller unserer Tage gewisse Formen und Techniken lernend aneignen. Zu all dem hat sich bei der Mehrheit unter ihnen die Einsicht durchgesetzt, mit Begabung allein lasse sich heute den vielfältigen Kommunikationsanforderungen einer komplexen Gesellschaft nicht mehr ausreichend entsprechen. Stellen wir damit nochmals die unausweichliche Frage, die Gretchenfrage sozusagen, nach der Lehr- und Lernbarkeit des Dichtens und geben wir darauf, um jedes Missverständnis auszuschlieβen, gleich eine klare Antwort: Kein vernünftiger Autor, aber auch kein Literaturwissenschaftler glaubt heute im Ernst, dass Dichten ein bloβes, lernbares Handwerk sei. Allerdings finden sich, trotz dieser an sich unbestrittenen Erfahrung, noch und noch Schreibkurse und entsprechende Lehrmittel, die den Benützern weismachen wollen, jeder könne ein guter Schriftsteller werden, wenn er nur die richtige, vom betreffenden Institut oder Lehrmittel propagierte Methode verwende.
Was leisten Schreibseminarien wirklich?
Fragen wir zunächst nochmals, was sie nicht leisten. Alfred Döblin, einer unserer gröβten Epiker des 20.Jahrhunderts, hat auf diese Frage indirekt eine geradezu klassische Antwort gegeben, als er im Jahre 1926 in einem Essay schrieb: «Die guten Dichter haben ihre Intuitionen; die machen alle Anleihen überflüssig, und den schlechten ist so oder so nicht zu helfen.» Was Döblin damals in einem allgemeinen Sinne meinte, gilt gerade für Schreibseminarien in besonderem Maβe: sie vermögen – dies sei in aller Deutlichkeit gesagt – keine Begabungen, keine Genies zu züchten. Wer schriftstellerisch nun einmal untalentiert ist, den machen auch Kurse und Lehrmittel mit all ihren oftmals lautstark propagierten «technischen Kniffen» nicht zum Erfolgsautor. Wäre dem nicht so, dann müsste jeder Germanist ex officio ein guter Dichter sein, nur weil er während seines Studiums alle möglichen Formen literarischen Gestaltens zu lernen hat.
So lieβe sich denn am grundsätzlichen Sinn von Schreibseminarien zweifeln. Doch dann hätte man mich gründlich missverstanden. Schreibseminarien erfüllen durchaus ihren Zweck, wenn es darum geht, den Teilnehmern bestimmte handwerkliche Techniken des Schreibens zu vermitteln. Literarisch begabt zu sein, braucht nämlich noch lange nicht zu heißen, die verschiedenen literarischen Kunstmittel auch schon zu beherrschen. Das gilt schon für traditionelle Schreibweisen, deren Techniken, in der Lyrik etwa die einzelnen metrischen Formen, im Roman die unterschiedlichen Erzählhaltungen, sich der Autor, will er erfolgreich schreiben, bewusst werden muss. Das gilt vor allem aber in Bezug auf spezifisch moderne Kunstmittel, wie beispielsweise neue erzählerische Verfahren, die sich ohne ein gezieltes Lernen und Üben – dazu haben sich von Döblin über Brecht bis hin zu Günter Grass alle bedeutenden modernen Autoren immer wieder bekannt – kaum aneignen lassen. Und das gilt nicht weniger für Fragen, die sich rund um das Schreiben ergeben, auf solche der Schreibpsychologie, aber auch auf Fragen der Literaturkritik und des Verlagsvertrages. Man staunt diesbezüglich immer wieder, wie hilflos auch gestandene Autorinnen und Autoren wirken, wenn sie etwa mit verlags- oder mit urheberrechtlichen Problemen konfrontiert werden. Hier können Schreibseminarien zweifellos eine Art «Hilfestellung» leisten, vorausgesetzt freilich, dass ihre Leiterinnen und Leiter in den entsprechenden Bereichen ausgebildet sind. Damit allerdings hapert es noch weit herum: auf dem Gebiet der Schreibausbildung tummeln sich heute allzu viele, die über die notwendigen fachlichen Voraussetzungen nur in Ansätzen oder gar nicht verfügen. Das gilt häufig gerade auch für praktizierende Autorinnen und Autoren, wenn sie als Leiter von Schreibseminarien auftreten und dann, weil sie selber die verschiedenen Möglichkeiten literarischen Gestaltens nicht ausreichend kennen, ihre eigene Schreibweise zum einzigen Gradmesser literarischer Qualität machen.
Schreibseminarien als Orte der Begegnung
Neben der Funktion der «Hilfestellung» – mehr kann und darf es nicht sein – erfüllen Schreibseminarien selbstverständlich noch weitere Funktionen, die mit Blick auf die besondere schriftstellerische Situation nicht unterschätzt werden dürfen. Da besteht für die Autorinnen und Autoren zunächst einmal die Möglichkeit, ihr poetisches Talent, im Vergleich mit andern Teilnehmern, relativ objektiv einzuschätzen. Man erlebt immer wieder, dass Autoren nach dem Besuch eines Schreibseminars feststellen, dass sie ihre Begabung überschätzt haben, und dann konsequenterweise einen andern Weg als den der Schriftstellerei einschlagen. Aber man erlebt zum Glück auch das Gegenteil: die Tatsache nämlich, dass Autorinnen und Autoren durch «Hilfestellungen», ja durch gezielte Schreibtipps, ihre schriftstellerische Begabung erst richtig entdecken. Und schlieβlich darf der psychohygienische Wert von Schreibseminarien nicht vergessen werden, wenn man bedenkt, wie sehr Schreibende als klassische ‚Einzelkämpfer’ mit ihren Texten häufig nicht nur bis zu deren Fertigstellung allein, sich selbst überlassen sind. Schreibseminarien geben ihnen da für einmal die Möglichkeit, während ein paar Tagen aus ihrer schriftstellerischen «Einsamkeit» auszubrechen und mit Gleichgesinnten – dies im wahrsten Sinne des Wortes – über ihre vielfältigen Probleme, die sie mit ihren Texten, aber auch mit Verlegern, Lektoren und Kritikern haben, zu diskutieren. Allein der Umstand erfahren zu dürfen, dass diese Probleme von andern angehört und ernst genommen werden, ja, dass andere Autorinnen und Autoren mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, dass man mit seinen Texten zudem eine gewisse Öffentlichkeit erreicht, auch wenn es vorerst nur die eines Seminars ist, tut dann oftmals gut. Schreibseminarien – ja oder nein? Geht man von einem überkommenen, latent elitären Autorenverständnis aus (wer möchte nicht gerne zu den Auserwählten, den Begnadeten gehören!), so wird man die Frage ohne zu zögern mit «nein» beantworten. Ist man aber bereit einzugestehen, dass auch die Schriftstellerei ein Moment des Handwerklichen und damit des Lernbaren hat, dass sich beispielsweise eine ganze Reihe von Schreibtechniken rational aneignen lassen, dann wird man gerade heute, inmitten einer Welt des Wandels und spezialisierter Berufe, den Schreibseminarien eine gewisse Berechtigung kaum absprechen können. ■
__________________________________________
.
 Mario Andreotti Geb. 1947, Studium der Germanistik und Geschichte in Zürich, 1975 Promotion über Jeremias Gotthelf, Prof. Dr. phil., 1977 Diplom des höheren Lehramtes, danach Lehrtätigkeit am Gymnasium und als Lehrbeauftragter für Sprach- und Literaturwissenschaft an der Universität St. Gallen und an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg, langjähriger Referent in der Fortbildung für die Mittelschul-Lehrkräfte und Leiter von Schriftstellerseminarien, Verfasser mehrerer Publikationen und zahlreicher Beiträge zur modernen Dichtung, lebt in Eggersriet/CH
Mario Andreotti Geb. 1947, Studium der Germanistik und Geschichte in Zürich, 1975 Promotion über Jeremias Gotthelf, Prof. Dr. phil., 1977 Diplom des höheren Lehramtes, danach Lehrtätigkeit am Gymnasium und als Lehrbeauftragter für Sprach- und Literaturwissenschaft an der Universität St. Gallen und an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg, langjähriger Referent in der Fortbildung für die Mittelschul-Lehrkräfte und Leiter von Schriftstellerseminarien, Verfasser mehrerer Publikationen und zahlreicher Beiträge zur modernen Dichtung, lebt in Eggersriet/CH
.
.
Themenverwandte Blog-Links
Schreiben im Beruf – Schreiben lernen? – Paro-Schreibkurs Basel – Thalia-Schreibwerkstatt Linz –Donnas Schreibprojekt – Schreibwerkstatt Graz – Literarische Sommerakademie 2009 – Literarische Expeditionen
Zum 10. Todesjahr von Grete Weil
.
«Eine schlechte Hasserin»
Über die jüdische Schriftstellerin Grete Weil
Peter Ahrendt
.
«Je weiter Auschwitz entfernt ist, desto näher kommt es, die Jahre dazwischen sind weggewischt. Auschwitz ist Realität, alles andere Traum. Nicht Mauthausen, wo Waiki ermordet wurde und ich mit ihm. Das Entsetzen hat sich vom eigenen Schicksal verlagert auf das der vielen. Auschwitz ist Chiffre, kein Ort auf der Landkarte.
Meine Nerven reagieren auf jede Gewalt, Menschen, ihre Mörder, eine sadistische Meute beamteter, uniformierter Peiniger. Eltern, die ihre Kinder quälen, Eheleute, die sich langsam erwürgen, Gemetzel mit Bajonetten, Peitschen, Elektroden, Wörtern, in Folterkammern und guten Stuben. Es verfolgt mich.»
.
«Es verfolgt mich»
So steht es in einem Buch, das ich vor einigen Jahren, und mit dringlicher Leseempfehlung, geschenkt bekam: in Grete Weils Roman «Generationen».1
Dieses Buch beeindruckte und bewegte mich derart, dass ich daraufhin alle weiteren Bücher der Weil las und begann, mich mit Leben und Werk der Autorin zu beschäftigen, einer Autorin, die nur ein Lebensthema hat: Die Judenverfolgung (ihr eigenes Schicksal), den Faschismus und die Nichtaufarbeitung der Vergangenheit durch die Deutschen. Ein Thema, das sie immer erneut gestaltete, in einfacher, klarer, oft stakkatohafter Sprache, unbeschönigt, aber nicht unschön.
Grete Weil wurde 1906 in Rottach-Egern am Tegernsee als Margarete Elisabeth Dispeker geboren, Tochter einer großbürgerlichen jüdischen Familie, und verlebte nach ihren eigenen Worten eine unendlich glückliche Kindheit, verwöhnt und verhätschelt. Sie studierte Germanistik in Berlin, München und Frankfurt/M, begann zu schreiben, denn Schriftstellerin zu werden war ihr eigentliches Lebensziel schon früh, und heiratete 1932 den Dramaturgen der Münchner Kammerspiele Edgar Weil, dem sie 1936 nach Holland ins Exil folgte.
Dort arbeitete sie zunächst als Portrait-Photographin. Als die Niederlande kapitulierten (1940), versuchten sie und ihr Mann nach England zu fliehen, aber der Versuch misslang. 1941 wurde Edgar Weil auf der Straße verhaftet und im KZ Mauthausen ermordet. Grete Weil meldete sich zur Arbeit beim jüdischen Rat in der «Schouwburg» in Amsterdam, dem Sammellager für die zur Deportation bestimmten Juden, als Selbstrettung und um nach Kräften die Deportationen zu behindern und zu verzögern. Im Herbst 1943 tauchte sie jedoch bei Freunden unter und überlebte.
Das Vernichtungslager Auschwitz (BBC & NDR 2005 / Ausschnitt)
(Weitere Auschwitz-Filmdokumente bei Youtube)
.
Aussöhnung ohne Vergessen
Nachdem die Deutschen den Juden 1941 die Staatsbürgerschaft aberkannt hatten, war auch Grete Weil staatenlos geworden, und da die Alliierten nach dem Krieg keine Staatenlosen nach Deutschland ließen, ging sie 1947 heimlich über die grüne Grenze in die Heimat zurück, in das trotz allem geliebte Land. Immer hatte sie sich als Deutsche gefühlt, denn ihre Sprache und ihre Kultur waren deutsch. Sie söhnte sich aus mit diesem Land und diesem Volk, aber ohne zu vergessen oder zu verdrängen. Ihr Schicksal, das Schicksal ihrer Leidensgenossen blieb ihr gegenwärtig und wurde das Thema ihrer nun im fortgeschrittenen Alter wieder aufgenommenen literarischen Produktion: «Zwölf Jahre nicht geschrieben, in der Zeit, die entscheidet, in der man die besten Einfälle hat und die meiste Kraft. Nach dem Krieg schreibe ich ein paar Bücher. Sie handeln von Krieg und Deportation. Ich kann von nichts anderem erzählen. Der Angelpunkt meines Lebens.»2
.
Ans Ende der Welt
«Ans Ende der Welt»3 hieß ihr erstes Buch, das 1949 in Berlin erschien. Diese Erzählung ist eine Darstellung ihrer Erfahrungen in der Schouwburg. Hier sind hunderte von Menschen jeden Alters zusammengepfercht in Erwartung ihres Schicksals, so auch ein Universitätsprofessor mit Frau und Tochter, einer der nur sehr langsam begreift, dass den Nazis seine soziale Stellung, seine Verdienste nichts bedeuten, dass auch er nur eine Nummer in den Listen ist, einer von vielen, die sterben müssen. Beklemmend ist diese Schilderung der Atmosphäre von Angst, Verzweiflung, Hoffnung auch, an die sich die Verlorenen klammern, und anrührend die Begegnung der Tochter Annabeth mit dem Jungen Ben und ihre erste scheue Liebe im Angesicht des nahen Todes.
Dieses Buch wurde zwar von einem Albert Ehrenstein als «knappes Meisterwerk» bezeichnet, «eine einfache, herzergreifende Geschichte von Liebe und Tod, die viele kennen sollen, kennen müssen …»4, aber ein Erfolg war es nicht, kaum jemand wollte nach dem Krieg etwas wissen von diesen Dingen, man war beschäftigt damit Neues aufzubauen und das Alte zu verdrängen.
Aber die Weil schrieb weiter. Nachdem sie ihren Jugendfreund, den Opernregisseur Walter Jockisch wiedergefunden hatte, (den sie 1960 heiratete), entstand zunächst, zusammen mit ihm, das Libretto zu Hans Werner Henzes Oper «Boulevard Solitude», die 1952 in Hannover uraufgeführt wurde, sowie der Text zu Fortners Pantomime «Die Witwe von Ephesus» (Uraufführung in Berlin 1952). Sie übersetzte Bücher aus dem Englischen (Durrell, Aiken, Buchanan, Hawkes) und Holländischen (J. Brouwers), textete Kurzfilme, besprach Bücher im Funk, und bevor ihr nächstes Buch erschien, verging Zeit. Aber sie hatte sich keineswegs abgefunden mit der praktizierten «Vergangenheitsbewältigung» der Deutschen. Sie bestand weiter darauf, über die deutsche Schande nachzudenken, zu reden, zu schreiben.
.
Schonungslose Offenheit
Und sie tat es mit schonungsloser Offenheit in dem 1963 erschienen Roman «Tramhalte Beethovenstraat»5, in dem sie abermals ihre Holland-Erlebnisse zu verarbeiten sucht. Indem sie hier einen jungen deutschen Journalisten zum Protagonisten macht, der 1942 als Berichterstatter in Amsterdam Zeuge der Judendeportationen wurde, bemüht sie sich um etwas objektivierende Distanz.
Aber auch er will nach dem Krieg nicht vergessen, sich nicht arrangieren, sondern versucht auf einer Reise in die Vergangenheit mit sich und seinen Erinnerungen ins Reine zu kommen. Ein aufwühlendes Buch, das ergreift und angreift, keine gemütliche Lektüre, «in einer Prosa von großer Schlichtheit und Wärme, Direktheit und Kraft, wie man sie selten findet»,6 wie Martin Gregor-Dellin schrieb.
1968: «Happy, sagte der Onkel»7 – drei Impressionen aus Amerika, auch dort wieder das ständige Thema. Die Titelerzählung schildert einen Besuch bei Verwandten, die der Vernichtung im Dritten Reich entronnen, die Vergangenheit völlig verdrängt haben und als 150prozentige Amerikaner jede Erinnerung daran weit von sich weisen. Sie haben sich rührend in ein Ghetto aus Nichtwissenwollen, Nichtanrühren zurückgezogen, eine Haltung, die Grete Weil bitterem Spott anheimgibt. In der zweiten Skizze («Gloria Halleluja») besucht sie Harlem, ein Ghetto von heute, in dem sie mit Hass und Ablehnung konfrontiert wird. Es gibt keine Solidarität der Unterdrückten und Verfolgten, wenn sie verschiedener Hautfarbe sind. Schließlich eine Touristenreise nach Mexiko, ins aztekische Chichen-Itza, auch das eine Schädelstätte, für die Weil eine Parallele zu Auschwitz, und dort begegnet sie einem SS-Schergen wieder (oder glaubt ihm zu begegnen), der jetzt als Fremdenführer tätig ist. Anlass zu einer Selbstbefragung, einem nochmaligen Durchleben der schlimmen Vergangenheit («B sagen»). Später notiert sie: «Ich verstehe jeden, habe eine Geschichte geschrieben, in der ich mich mit einem SS-Mann identifiziere, wir haben beide überlebt, sind beide schuldig»8.
.
Schuld des Überlebens
In ihrem letzten Buch, mit dem bezeichnenden Titel «Spätfolgen» setzt sie sich in kleinen Erzählungen nochmals mit dem Weiterwirken des Entsetzlichen und mit der Scham des Überlebenden auseinander. Da ist jenes jüdische Mädchen, das dem Nazi-Morden entkommt, auf einer Reise durch das heutige Deutschland einen Autounfall erleidet und stirbt, weil sie sich von keinem deutschen Arzt anfassen lassen kann («Don’t touch me»). Oder jener Mann, der nach Italien zurückkehrt, an die Orte einstigen Glücks mit der in Sobibor vergasten Bella und sich dort erschießt, weil er sich als Überlebender schuldig fühlt. («Das Schönste der Welt»). Der Band enthält auch eine Neufassung von «Happy, sagte der Onkel» («Das Haus in der Wüste»), die im wesentlichen eine Straffung darstellt, eine strengere, knappere Form; diese Bearbeitung zeigt, dass Grete Weil auch gerade an dieser Geschichte über Verdrängung und Arrangierung viel gelegen war.
1970 starb auch Walter Jockisch, und Grete Weil, jetzt 64 Jahre alt, allein, nicht mehr gesund, noch heimgesucht von den Gespenstern der Vergangenheit, schrieb jenen Roman, der 1980 ihren künstlerischen Durchbrach brachte: «Meine Schwester Antigone».
In Aufzeichnungen einer alten Frau, die minuziös ihren Tagesablauf notiert, ihr Leben allein, ihr Leiden an der Einsamkeit, die sie doch auch braucht, ihr Leiden am Alter, das sie doch mit verbissenem Stolz trägt, und ihr Ringen mit dem unfertigen und nie vollendeten Antigone-Stoff.
Die sophokleische Heldin, die sie beschäftigt und verfolgt, sieht sie als Ebenbild, aber auch als Gegenpart, dessen Handlungen sie in unzähligen Gedankenspielen analysiert und interpretiert, immer in Bezug auf sich selbst. Antigone aber auch als rebellische Verkörperung einer Jugend, «die uns nicht die kleinste Ausflucht erlaubt, diese Welt noch in Ordnung zu finden»9, einer Jugend, für die die Autorin Verständnis und Zuneigung empfindet.
Immer wieder sind da auch die Erinnerungen an ihre toten Ehemänner, auch an ihren verschwundenen Hund, den einzigen verbliebenen Gefährten, vor allem aber an die furchtbare Vergangenheit, die Verfolgung, die Zeit im jüdischen Rat in Amsterdam, die unvermittelt in die Gegenwartsschilderungen eingefügt und damit selbst zur ständigen Gegenwart werden. Noch nie wurden zudem die Probleme des Alterns, die Einsamkeit wie der Kampf um eine würdiges sinnvolles Dasein so eindringlich beschworen.
.
Verschachtelte Zeitebenen
Am Ende werden die Zeitebenen immer stärker verschachtelt, durchdringen sich Erinnerungen der Autorin, die Identifizierung mit Antigone, die Gegenwart, die Kindheit, die hypothetischen Erlebnisse so stark, dass sie fast untrennbar werden. Letztlich wird die Erzählerin nicht damit fertig, dass sie hingenommen hat, nicht wie Antigone aufgestanden ist und um den Preis des Untergangs ein Zeichen der Revolte gegeben hat.
Eingefügt in dieses Buch ist ein furchtbares Dokument: 20 Seiten eines Augenzeugenberichts über die «Auflösung» des Juden-Ghettos Petrikau (Piotrkow) 1943, den Friedrich Hellmund geschrieben hatte, ein lettischer Autor, 1945 in Polen vermisst. Hier wird nüchtern-sachlich, aber mit brutaler Deutlichkeit vorgeführt, was sich hinter so leicht zu handhabenden Vokalen wie «Ghetto-Auflösung» und «Endlösung» verbirgt: die Bestie Mensch in geradezu unvorstellbarer Form. Dieses Dokument macht mit einem Schlag auch dem letzten Zweifler klar, warum die Weil nicht vergessen kann, nicht vergessen will, und warum sie das Erschießungskommando hinter sich spürt, wenn sie Erde im Garten aushebt, um Blumen zu pflanzen, warum sie Sympathie hat mit der verfolgten «Sympathisantin».
Das Buch war, wie gesagt, ein Erfolg. «Der späte Erfolg tut gut. Der späte Erfolg tut weh», schrieb sie, «der Preis war zu hoch. Ich bin Zeuge, und als Zeuge muss ich aussagen. Und dieser Zwang hat mir Kraft gegeben durchzuhalten. Viele Jahre wollte es niemand hören, aber das ist anders geworden.»10
Die Offenheit einer nachgewachsenen Generation für die längst überfällige Beschäftigung mit der jüngeren deutschen Geschichte trug sicher zum Erfolg auch des nächsten Buches bei, jene «Generationen» von 1983. Hier wird der Versuch einer Wohngemeinschaft dreier unterschiedlicher Frauen geschildert: Einer älteren, die Autorin mit der schweren Hypothek der Verfolgten und Gedemütigten, einer Jungen und einer Frau mittleren Alters, beide ohne diese Erfahrungen,aber mit eigenen Problemen und auch mit einem gewissen rücksichtslosen Egoismus. Der Versuch dieses Zusammenlebens verschiedener Generationen scheitert, an Missverständnissen, Empfindsamkeiten, Rivalitäten. Die Junge sucht ihren eigenen Weg, eine Arbeit, in der sie sich verwirklichen kann, die mittlere ist eine einzelgängerische Künstlerin, und alle führen in wechselnden Konstellationen einen Kampf um Wärme, Verstehen, Freundschaft, wozu letztlich keiner fähig ist, weil jeder mit seinem Geschick auf einer Insel lebt.
Auch dies wieder ein Tagebuch (in dem übrigens die Entstehung der «Antigone» verfolgt werden kann), und eigentlich ein sehr ähnliches Buch, doch neu aufgerollt, neu gespiegelt, der Einsamkeit dort ein Versuch von Gemeinschaft hier gegenübergestellt, stets im Schatten der Vergangenheit.
.
Keine Wehleidigkeit

Ohne Wehleidigkeit schreiben gegen das Vergessen: Grete Weil 1998 an der 10-Jahr-Feier der Stiftung «Weiße Rose»
Aber hier, wie immer bei der Weil, fehlt jede Wehleidigkeit, jede Larmoyanz, immer bleibt sie nüchtern, von großer, harter Aufrichtigkeit, schonungslos auch sich selbst gegenüber. Und nochmals, nach einem Herzinfarkt und einem schweren Schlaganfall schafft sie es, einen Roman, den «Brautpreis» zu schreiben. Hierin liest man: «Herrlich, dass du wenigstens schreiben kannst. Nein, es ist nicht herrlich, kein bisschen. Es ist eine gewaltige Anstrengung. Die dauernde Furcht, es nicht mehr zu können. »11
In diesem Buch entdeckt die Weil ein neues Thema für sich, steigt sie tief hinab in die jüdische Geschichte; sie, die niemals eine jüdische, nur eine deutsche Identität in sich entdecken konnte, wird hier zu Michal, Tochter des Königs Saul und erste Frau König Davids, auch sie nun eine alte Frau, die ihr langes kummervolles Leben berichtet. Dann aber spricht auch wieder die Autorin selbst: Ein Dialog über die Zeiten hinweg, zwischen einer Jüdin am Anfang und einer am Ende der Geschichte. «3000 Jahre liegen dazwischen. Eine lange Zeit zur Einsicht, doch geändert hat sich nicht viel.»12
.
Zum ersten Mal in Israel
Um ihr Buch schreiben zu können, ist sie, die immer gern und viel reiste (bis nach Ladakh und Nepal!), endlich auch nach Israel gefahren, zum ersten Mal in ihrem Leben, denn sie hatte bislang wohl immer Angst vor ihren Emotionen, eine Angst, die sich dann als unbegründet erwies. Das Land erschien ihr fremd, vermittelte ihr nicht das Gefühl nach Hause zu kommen; wohl aber empfand sie eine Zärtlichkeit für Land und Bewohner und hoffte, wenn auch zweifelnd, dass es gut gehen möge mit ihnen.
Eine Skepsis, geboren aus leidvoller Erfahrung und aus einer leidvollen Geschichte voll Blut und Gewalt, wie sie auch in dieser Erzählung berichtet wird. Aber Michal, diese Stimme aus ferner Vergangenheit setzte die Hoffnung auf eine künftig bessere, menschlichere Welt und ahnte doch nicht, welches Schicksal ihrem Volk noch bevorstand. Grete, die andere Stimme, hat dieses Schicksal durchlebt und überlebt und muss mit dieser Wunde leben; dennoch ist sie bereit zu vergeben. Ein Buch von großer Trauer und großer Menschlichkeit.
In den «Spätfolgen» wird dann ein resignierter Ton hörbar: «Über vierzig Jahre lang habe ich mir eingebildet ein Zeuge zu sein, und das hat mich befähigt so zu leben wie ich es getan habe. Ich bin kein Zeuge mehr. Ich habe nichts gewusst. Wenn ich Primo Levi lese, weiß ich, dass ich mir ein KZ nicht wirklich vorstellen konnte. Meine Phantasie war nicht krank genug.»13
Primo Levi hat sich wie andere, die das KZ überlebten: Jean Améry, Bruno Bettelheim, Paul Celan später das Leben genommen, und was schon zuvor gelegentlich bei Grete Weil anklang, wird hier nochmals sehr deutlich: das Schuldgefühl der Davongekommenen gegenüber den Opfern des Nazi-Terrors.
Für den «Brautpreis» und für ihr Lebenswerk erhielt Grete Weil 1988 den mit 20’000 DM dotierten Geschwister-Scholl-Preis. In ihrer Dankrede erklärte sie, dieser Preis sei der einzige, den sie sich immer gewünscht habe, denn er gelte nicht nur der Literatur, sondern auch der Gesinnung, und da glaube sie ihn im Sinne von Hans und Sophie Scholl mit Recht annehmen zu dürfen.
«Ich, die Spätgeborene», schreibt sie in dem Roman, «muss mit dem Wissen um Auschwitz mein Leben zu Ende bringen, es wird mich quälen bis zum letzten Atemzug.»14
Aber, auch das sagte sie einmal in einem Interview, hassen könne sie nicht: «Ich bin wohl eine schlechte Hasserin.» ■
1 Grete Weil, Generationen, Roman, Berlin: Volk und Welt, 1985
2 Grete Weil, Meine Schwester Antigone, Roman, Zürich/Köln: Benziger, 1980
3 Grete Weil, Ans Ende der Welt, Erzählung, Berlin: Volk und Welt, 1949
4 zitiert nach G. Weil, Ans Ende der Welt
5 Grete Weil, Tramhalte Beethovenstraat, Roman, Wiesbaden: Limes, 1963
6 zitiert nach G. Weil, Tramhalte Beethovenstraat
7 Grete Weil, Happy sagte der Onkel, Wiesbaden: Limes, 1968
8 G. Weil, Antigone
9 G. Weil, Antigone
10 G. Weil, Generationen
11 Grete Weil, Der Brautpreis, Roman, Zürich/Frauenfeld: Nagel&Kimche, 1988
12 G. Weil, Der Brautpreis
13 Grete Weil, Spätfolgen, Erzählungen, Zürich/Frauenfeld: Nagel&Kimche, 1992
14 G. Weil, Der Brautpreis
(Dieser Beitrag von Peter Ahrendt stammt aus dem Jahre 1994)
_______________________________
 Peter Ahrendt
Peter Ahrendt
Geb 1940 in Penzlin/D, bis 2005 Konzern-Betriebsprüfer, Prosa-, Lyrik- und essayistische Publikationen in Büchern und Zeitschriften, Mitglied der Gesellschaft der Arno-Schmidt-Leser GASL und der Fritz-Reuter-Gesellschaft, lebt in Norderstedt/D
.
.
.
.
.
Themenverwandte Links
Weiße Rose – Boulevard Solitude – Jugendliche erinnern an Auschwitz-Opfer – Was hatte Gott in Auschwitz verloren – Auschwitz: Nie wieder – Weshalb Oswiecim nicht Auschwitz ist – Auschwitz war auch meine Stadt – Sima Vaisman: In Auschwitz – Erziehung nach Auschwitz
Rolf Stolz über die Kultur-Utopie Europa
.
Neue Kultur – Volkskultur?
Über die kulturelle Selbstbestimmung in einem anderen Europa
.
Rolf Stolz
..
Vorbemerkung
Schon die im Titel dieses Textes verwendeten Begriffe wird man als vage und mehrdeutig bezeichnen. Sie sind es, und dass sie es sind, ist notwendig, um die Bedeutungen und Spielarten hinlänglich beschreiben zu können, in denen sich Kultur heute ereignet – in diesem Kontinent, der unfreiwillig der internationalste, der am wenigsten regional und provinziell geprägte, der verflochtenste und trotz seiner ökonomischen Potenz und relativen politischen Stärke der kulturell am wenigsten selbstbestimmte der fünf bewohnten Kontinente ist.
«Neue Kultur» bezeichnet nicht einfach das gerade eben mit kulturellem Anspruch ins Werk Gesetzte. «Volkskultur» bezieht sich nicht auf die touristisch inspirierten Darbietungen alter Leute in alten Kostümen. «Neue Kultur» umschließt all die vielgestaltigen, tastenden Versuche einer neuen Bewegung, ihre eigenen Erfahrungen und ihr momentanes Bild einer anderen Weltordnung zu vergegenständlichen. Diese unverbrauchte, in vielem noch unentwickelte und gestaltlose Kultur findet ihr Gegenstück – halb Spiegelbild, halb Antagonismus – in einer Volkskultur, die aus zerstörten Resten aufscheint oder sich neu entzündet an populären Gefühlen, an Kämpfen und Identifikationen.
.
Alternativ und avantgardistisch
Eine alternative Kultur kann sich nicht damit abgeben, den Menschen zu sagen, was sie längst wissen und tun. Sie muß avantgardistisch sein, sie muß einen Schritt voraus sein oder auch einige Schritte, und sie darf nicht gemessen werden am sogenannten gesunden Menschenverstand.
Eine der erbärmlichsten Sachen ist es, wenn sogenannte Linke sich nicht zu schade sind, das auf den Hund gekommene Volksempfinden zu Hilfe zu rufen gegen all das, was sie nicht verstehen können und nicht verstehen wollen. Natürlich gibt es auch Pseudo-Avantgardismus, gibt es Scharlatanerie und serielles Kunstgewerbe, wo ein Otto Herbert Hajek so impotent ist wie einstmals ein Bernard Buffet. Natürlich ist nicht die Haltung der kritiklosen Bewunderung – platt auf den Bauch, die Augen fest geschlossen – gefordert, also jene servile Museumswächter-Mentalität, die schon aufschreit, wenn jemand unerlaubterweise eine Beuyssche Stahlrohrkonstruktion berührt.
Aber es ist eben einfach daran festzuhalten, dass ein Vostell in seinen Fluxus-Containern mehr transportiert an Gegenwart und an Zukunft als ganze Güterzüge voller Spätimpressionismus und «sozialistischem Realismus». Die bleiern schweren Grabfiguren, der messergespickte Hund im roten Pfefferstaub – das ist viel näher dran an unseren wirklichen Problemen als all die Ehedramen und Kleine-Leute-Geschichten, als all die engagierte Künstlichkeit der Arbeitnehmer-Reportagen.
Überhaupt sollten wir uns lösen von der Doktrin, dass der Künstler gefälligst als zugleich genialer und brav progressiver Kulturschaffender ein wackerer Gewerkschafter, ein zuverlässiger Parteimann, ein konsequenter Revolutionsasket zu sein habe. Wir müssen uns freimachen von diesen Fiktionen, wir müssen den Künstlern und der Kunst die Freiheit lassen, so zu sein, wie sie sind – eine totale, schrankenlose Freiheit, nicht eine halbe und kastrierte im Sinne einer regierungsoffiziellen sowjetischen Broschüre aus der Breschnew-Ära, in der es heißt: «Schriftsteller, Maler oder Regisseure sind in ihrem Schaffen frei. Es gibt weder verbotene Formen noch verbotene Themen. Das Prinzip der Schaffensfreiheit ist jedoch mit Anschlägen auf die Lebensinteressen der Gesellschaft und der Werktätigen unvereinbar. Die Gesellschaft läßt weder die Propaganda des Krieges zu noch das Schüren von rassistischer oder religiöser Feindschaft, sie verbietet die Verbreitung von Pornographie oder Werken, die von antihumanem, antisozialistischem Geist durchdrungen sind.» (Presseagentur Nowosti «Jahrbuch UdSSR 1984», APN-Verlag, Moskau 1984).
.
Die Kunst zu widersprechen – die Widersprüche der Kunst
Man wird akzeptieren müssen, dass Künstler nicht immer Heroen sind, sondern alles und jedes: Klerikale Spinner die einen, ängstliche Psychopathen die anderen, brutale Saufbolde oder prosaische Buchhalter, geldgierige Bonvivants oder rachsüchtige Menschenfeinde. Man wird akzeptieren müssen, dass Künstler keine Vorbilder sind. Man wird akzeptieren müssen, dass etliche Künstler nicht «»links, wo das Herz ist«, ihren Platz gehabt haben, sondern auf der anderen Seite der Frontlinie.
Dass Ezra Pound ein Sympathisant der italienischen Faschisten war, hat nicht verhindert, dass er einer der größten Lyriker dieses Jahrhunderts war und blieb. Gerade in Deutschland ist ein nationaler Konsens nötig darüber, welche der in den Faschismus verstrickten Künstler wir auf den Sperrmüll der Geschichte werfen sollten und welche nicht.
.
Unwissenheit und Ohnmacht
In einer längst nicht mehr europäisch zentrierten und sich rapide wandelnden Welt wäre es notwendig, dass bei einer Pflichtschulzeit von zwölf oder dreizehn Jahren jeder, der nicht lernbehindert ist, also auch jeder heutige «Hauptschüler» am Ende zwei Weltsprachen fließend spricht, geschichtliche, politische und geographische Zusammenhänge kennt, die Grundzüge mathematischen und philosophischen Denkens begreift, die elementaren Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften zumindest in metaphorischer Form nachvollzogen hat, das Handwerkliche der Kunst kennengelernt und in kreativer, selbstbestimmter Arbeit zu eigenständiger Gestaltung gefunden hat, mehrere Sportarten beherrscht, sowie gelernt hat, wie in Fabriken und Labors, in Handwerksbetrieben und in der Landwirtschaft die Hände und der Kopf gebraucht werden.
Natürlich, das ist eine Utopie. Aber eine vom Gang der Geschichte diktierte, der die europäischen Länder nur um den Preis ihres kulturellen und wirtschaftlichen Zurückbleibens ausweichen können. Diese Utopie zu verwirklichen wird nicht nur große Geldsummen, sondern auch Schweiß und Tränen und den Verzicht auf liebgewordene Vorurteile kosten.
.
Für das, was anders ist
Wir müssen die Verschiedenartigkeit, die Eigenartigkeit, die Einzigartigkeit, das besondere Gesicht unserer eigenen Kultur verteidigen – die in aller Vermischung unvertauschbare und unübertragbare Einzelexistenz, das Phänotypische. Es ist eine Entscheidung, die wir zu treffen haben: Wollen wir eine von allen nationalen Exzentrizitäten gereinigte, jeden Bezug auf das eigene Land ängstlich vermeidende Kultur, die in Melbourne und in München, in Vancouver und in Frankfurt die eine, ewig gleiche, unterschiedslose Weltkunst (oder ihre europäisch-abendländische Variante) inszeniert? Wollen wir eine Kultur, die den Charakter ihrer Charakterlosigkeit bezieht aus der fröhlichen Befolgung von globalen Marktgesetzen und international gültigen Sebstverstümmelungs-Mechanismen – oder wollen wir eine aus den nur begrenzt miteinander verbundenen, nur begrenzt vermittelbaren Sonderkulturen all der vielen Völker entstehende Weltkultur, in der das einigende Band sehr lose und sehr äußerlich ist und so verschwindet wie ein Faden, der unter den vielen bunten Blumen fast unsichtbar bleibt und doch das Gebinde zusammenbringt? Ich plädiere für eine bei aller wechselseitigen Beeinflussung und Befruchtung unaufhebbare Schranke zwischen den Kulturen, für eine deutsche und eine spanische und eine französische Kultur statt eines Einheitsbreis nach Europa-Norm.

«Spanier=hochmütig, wunderlich, ehrbar; Deutsche=offenherzig, witzig, unüberwindlich»: Die Europäische Völkertafel, Ölgemälde Steiermark, frühes 18. Jh.
Dies bedeutet natürlich ein Abkoppeln von einer als unaufhaltsam dargestellten «allgemeinen Entwicklung», von der zwanghaft auf Uniformität und Verflachung abgerichteten Wanderbühnenkunst, deren Heimat das Nirgendwo und deren letzter Grund das Geschäftemachen ist. Dies bedeutet ein Ausklinken aus den aktuellen «Sachzwängen», mit denen das allseitige Angleichen, Abschleifen und Verflachen erreicht werden soll. Die Zerstörung des Besonderen jeder Kultur im heutigen freien Westen hat ihre unübersehbare Parallele in der Zerstörung der vielgestaltigen natürlichen Ökotope wie in der Zerstörung gewachsener Stadtteilstrukturen. Das triste Einerlei der durch Emissionen, Kultivierung und freizeitgerechte Abnutzung sterbenden Wälder, die todtraurige Langweiligkeit der wuchernden Hochhaus- und Reihenhausgeschwulste – all das wächst auf demselben Boden wie die Vermarktung der Kultur und ihre industrielle Verarbeitung zu geschmacksneutralen Appetithappen. Die Macht, die die Natur und die Menschen zugrunde richtet, ist dieselbe, die die menschlichen Schöpfungen zu vernichten sucht: Eine zentralistische, monopolistische, industrialistische Lebens- und Arbeitsstruktur, die sich in Herrschaftsordnungen und Wirtschaftsformen, in Denkgewohnheiten und Herrscherfiguren verkörpert, welche – je mehr sie miteinander in Verteilungskämpfe geraten – sich um so ähnlicher werden.
.
Was Europa sein könnte

«Kleineuropa der Bürokraten und ihres parlamentarischen Begleitorchesters»: Die EU-Kommission in Brüssel
Wir wollen eine regionalistische Kultur der Völker in einem Europa, das nicht das Kleineuropa der Euro-Bürokraten und ihres parlamentarischen Begleitorchesters ist, sondern jenes große und großartige Gesamteuropa, das vom Bosporus bis Spitzbergen, von Gibraltar bis zum Ural reicht, zu dem all die kleinen, von den Großmachtpolitikern ebenso unterschätzten wie unterdrückten Völker gehören, ob heute in einem eigenen Staat lebend wie Albaner und Finnen oder noch in einem fremden Staatsverband eingepfercht wie Basken und Korsen, ein Gesamteuropa, das all die in einen anderen Kontinent hinüberreichenden halbeuropäischen Brücken- und Zwischen-Länder (die Sowjetunion, die Türkei, Zypern, Malta, Grönland) – zu Austausch und enger Kooperation aufruft und den außereuropäischen Mächten USA und Kanada den kostenlosen Heimtransport ihrer Soldaten und Vernichtungswaffen spendiert.
Ein solches Europa wird sich freimachen von der engstirnigen Fixierung auf ein christkatholisches Abendländertum, es wird die widersprüchliche Vermischung der Ethnien, und Kulturen in der europäischen Geschichte bewußt aufgreifen als Chance für Vielgestaltigkeit und Formenreichtum. Es wird weder romanisch noch germanisch sein, weder slawisch noch «nordisch», es wird ebenso eine Balance seiner kulturellen Bildungselemente ermöglichen wie ein politisches Gleichgewicht der Mächtegruppierungen. Europa hat eine Chance zu überleben, wenn es sich politisch, wirtschaftlich und militärisch abkoppelt von den USA, wenn es aus der Distanz der Nicht-Paktgebundenheit heraus eine Mittlerrolle einnimmt – zwischen Westen und Osten, zwischen Nordamerika und Asien, zwischen «erster» und «dritter» Welt.
Zu dieser Unabhängigkeit gehört aber auch, dass Europa nicht länger sich der amerikanischen kulturellen Hegemonie beugt, die – ohne dass politischer Druck und militärische Erpressung hinzutreten müßten – allein durch den Selbstlauf der technologischen Entwicklung immer weiter anwächst: Als Kommerzialisierung, als Trivialisierung, als Schablonisierung, von den Werbemythen bis hin zu den Schnellrestaurants, von den Seifenopern bis hin zur elektronischen Kinderstube.
.
Was verteidigen wir, was geben wir auf?
Was heißt das konkret, für viele Einzelkulturen der europäischen Völker statt für die Chimäre einer einheitlichen «Europa-Kultur» einzutreten? Es bedeutet zunächst einmal, nichts, was lebensfähig ist, aufzugeben aus den lokalen, regionalen und nationalen Traditionen, sondern es zu bewahren und zu erneuern: Die bunten Häuser Portugals und die weißen Andalusiens, die Fachwerk-, Schiefer- und Bruchsteinhäuser Deutschlands, das »unmögliche« zungenbrecherische Walisisch, die griechische und die kyrillische Schrift, Trachten und Tänze und Volksmusik, bayrisches Brauchtum und die Riten der unchristlichen Abendländer (der Mohammedaner auf dem Balkan), die eigene Literatur der baltischen Völker oder der albanischen Minderheit in Italien, die den Zentralisten verhaßte und als Separatismus verdächtige Wiederbelebung einer elsässischen oder katalanischen oder sowjetischen Identität…
Aber es geht um mehr als um ein Konservieren und Restaurieren. Notwendig sind Kulturen, die neue Schöpfungen hervorbringen und neue Traditionen begründen, die das moderne Leben der Völker zum Leben bringen in Kunstwerken, die mehr sind als Kopien oder späte Nachklänge der alten Meister. Eine solche Kunst muß notwendig avantgardistisch sein, sie kann nicht spekulieren auf unmittelbare Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit. So wie wir in der Pädagogik die Doktrinen des Laisser faire und der Anpassung ans jeweils niedrigste Niveau, die Anbetung der spontanen Ignoranz und die Orientierung am Flachkopf und am Faulpelz endlich überwinden und der verdienten Lächerlichkeit preisgeben sollten, so ist auch auf kulturellem Gebiet ein fundamentales Umdenken an der Zeit. Es muß in die Köpfe hinein, dass ein Kunstwerk sich immer wieder der Vereinnahmung und Vereindeutigung entzieht, dass Ehrfurcht und Schweigen angebrachter sind als interpretierendes Gefasel, dass das Verstehen eines Kunstwerkes nur aus der Distanz möglich ist, dass dieses Verstehen mit geistigen Anstrengungen, mit Arbeit, mit inneren Kämpfen und Schmerzen, mit Risiken und mit Sich-Bewähren zu tun hat.
.
Das Feuer auf die Erde!
Dort, wo sich wirklich etwas abspielt, wo Bücher mehr sind als Papierkram, wo Maler mehr vollbringen als gehobene Anstreicherei, wo die Musik die Dämonen und die Götter beschwört, dort ist eine Chance für den schöpferischen Menschen, sich vom Wiederkäuen der Realität zu lösen, sich aus den Zwangsgedanken des Foto-Realismus zu befreien und das Feuer auf die Erde zu bringen, das ebenso gemeingefährlich wie schön ist.
So wie die modernen Abenteurer aus dem Bannkreis der begradigten Flüsse, möblierten Wälder und seilbahnerschlossenen Berge flüchten, das Unkalkulierbare, den Tanz auf dem Seil suchen und den möglichen Tod der sicheren Langeweile vorziehen, so steigen die Künstler aus dem vermarkteten, reglementierten, korrumpierten und keimfreien Kulturbetrieb aus – across the river and into the trees.
Natürlich ist dies eine romantische Attitüde, natürlich ist dies Flucht und Verweigerung, aber es ist überlebensnotwendig, wenn man der geistigen Verödung, Versteppung und Verwüstung, der Plattwalzung und Ruhigstellung entgehen will. Ob stiller Rückzug in ein Reich, das nicht von dieser Welt ist, ob aggressive Aufkündigung des Mitspiel-Engagements, ob Gegen-Offensive oder autistische Abkehr – in jedem Fall geht es darum, sich nicht als Quisling der kulturellen Nivellierung und Verblödung zur Verfügung zu stellen. Es geht darum, frei zu bleiben, unbestechlich und souverän. ■
__________________
 Rolf Stolz
Rolf Stolz
Geb. 1949 in Mühlheim/D, Studium der Psychologie in Tübingen und Köln, zahlreiche fachwissenschaftliche und belletristische Publikationen in Büchern und Zeitschriften, früher SDS-Aktivist, Mitbegründer der Grünen Deutschland, umfangreiche fotokünstlerische Arbeit, lebt in Köln
.
.
.
Themenverwandte Links
Europapolitik über Grenzen hinweg – Der Multikulturalismus und seine Gegner – Nichtinteresse der Bürger an Europapolitik – Nachhilfe in Europa-Politik – Die Entdeckung Europas – Es ist Zeit für Europa zu handeln – Türkei passt nicht in die EU – Living Together in Europe – Das Land in guten wie in schlechten Zeiten – Multikulti: Die Vivisektion einer Nation – Einbürgerungsstatistik und das Integrationsverständnis
Das Zitat der Woche
.
Über die großen Frauen
Simone de Beauvoir
.
Männer, die wir groß nennen, sind jene, die – auf die eine oder andere Weise – das Gewicht der Welt auf ihre Schultern genommen haben: Sie sind mehr oder weniger damit fertig geworden, es ist ihnen geglückt, sie neu zu schaffen, oder sie sind gescheitert. Aber zunächst haben sie diese ungeheure Last auf sich genommen. Das hat noch keine Frau getan, aber auch noch nicht tun können. Im Mann und nicht in der Frau hat sich bis jetzt der Mensch «an sich» verkörpern können. Die Individuen nun aber, die uns beispielhaft erscheinen, die man mit dem Namen Genie auszeichnet, sind es, die behauptet haben, in ihrer einzelnen Existenz spiele sich das Schicksal der gesamten Menschheit ab. Keine Frau hat sich dazu für berechtigt gehalten. Wie hätte Van Gogh als Frau auf die Welt kommen können? Eine Frau wäre nicht in Mission nach dem nordfranzösischen Kohlenrevier geschickt worden, sie hätte nicht das Elend der Menschen als ihr eigenes Verbrechen empfunden, sie hätte keine Wiedergutmachung gesucht. Sie hätte auch keine Van Goghschen Sonnenblumen gemalt. Eine Frau hätte nie ein Kafka werden können: In ihren Zweifeln und ihrer Unruhe hätte sie nie die Angst des Menschen wiederempfunden, der aus dem Paradies vertrieben worden ist. Eigentlich hat nur die Heilige Therese auf eigene Kosten, in einer völligen Verlassenheit die menschliche Seinsbedingung durchlebt. Da sie sich jenseits der irdischen Hierarchien stellte, fühlte sie ebensowenig wie der Hl. Johannes vom Kreuz ein beruhigendes Dach über ihrem Haupt. Für alle beide war es dieselbe Nacht, dasselbe Aufleuchten des Lichts, dasselbe Nichts des «Ansich», dieselbe Erfüllung in Gott.
Wenn es so einmal für jedes Menschenwesen möglich sein wird, seinen Stolz jenseits der geschlechtlichen Differenzierung in die schwierige Glorie seiner freien Existenz zu setzen, erst dann wird die Frau ihre Geschichte, ihre Probleme, ihre Zweifel, ihre Hoffnungen mit denen der Menschheit vereinen können. Erst dann wird sie in ihrem Leben wie in ihren Werken versuchen können, die ganze Wirklichkeit und nicht nur ihre Person zu enthüllen. Solange sie noch damit zu kämpfen hat, ein Menschenwesen zu werden, kann sie nicht schöpferisch sein.
Erst kürzlich noch hat das alte Europa die barbarischen Amerikaner mit Verachtung gestraft, die weder Künstler noch Schriftsteller besäßen: «Laßt uns erst existieren, bevor ihr von uns verlangt, daß wir unsere Existenz rechtfertigen», antwortete im wesentlichen Jefferson. Dieselbe Antwort erteilen die Neger den Weißen, die ihnen vorwerfen, sie hätten keinen Whitman und auch keinen Melville hervorgebracht. Das französische Proletariat hat auch keinen Namen, den es einem Rousseau und Mallarmé entgegenstellen könnte. Die freie Frau wird eben erst geboren. Wenn sie sich selbst erobert haben wird, rechtfertigt sie vielleicht die Prophezeiung Rimbeauds: «Die Frau wird das Unbekannte finden! Wird ihre Ideenwelt von unserer verschieden sein? Sie wird seltsame, unergründliche, abstoßende, entzückende Dinge finden, wir werden sie entgegennehmen, sie begreifen.»
Um zu wissen, inwieweit sie eine Sonderheit bleibt, inwieweit ihre Sonderheiten ihre Bedeutung behalten, müßte man recht kühne Voraussagen wagen.
Die Zukunft steht weit offen.Aus Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht, Eine Deutung der Frau, Rowohlt Verlag Hamburg 1960
.
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über «triviale» Literatur
Volker Klotz
.
Was ist dran, ungeachtet germanistischer Gütestempel, an jenen Werken, die wieder und wieder durch Seminare und Schulen geflößt werden, als müßt’s so sein? Die Fragen wie die Antworten werden ganz sicher oft daneben gehen oder zehn Jahre später neu zu stellen sein. Aber sie sind unerläßlich. Wie in früheren, unbefangenen Jahrhunderten auch. Also: Was geht uns derzeit der geschwätzige Schiller an? Mir scheint: wenig. Desto mehr der wilde Kleist. Wer zöge, unbefleckt von feierlichen Exegeten, die harschen göttermurmelnden Verse von Hölderlin den klingenden wassermurmelnden Versen von Mörike vor? Falls doch: warum wohl? Wie kommt’s, daß man Hartmann von Aue für besser weil tiefer hält als Chrestien? Lohnt es, ein zusammengeschustertes Erzeugnis wie die Wanderjahre zu lesen oder gar zu interpretieren – wenn daneben Manzonis Verlobte liegen bleiben? Was kommt dabei heraus, wenn man seit gut hundert Jahren dem sogenannten Bildungsroman nachsinnt und seine Nöte zu Tugenden erklärt? Statt an Dickens, Balzac, Stendhal, Gogol, Turgenjew, Galdos zu zeigen, was Erzählen vermag? Warum nicht eine verdiente lange Weile Stifter, Raabe, Storm bis zu ihrem zierlichen Nachzehrer Handke in die Quarantäne schicken? Was gibt die deutsche Aufklärungskomödie her, verglichen mit Marivaux und Holberg, mit der englischen Restauration Comedy und mit Goldopi? Kaum mehr als den Befund, daß und warum es hierzulande nicht geklappt hat. Muß man sich mit Gryphius’ und Lohensteins verrenkten Trauerspielen abquälen oder auch mit den minder steifen, aber bläßlichen Stücken Grillparzers – wo es Shakespeare, Calderon, Lope gibt?
Solche Fragen kommen freilich dann nur auf, wenn wir uns nicht eingrenzen auf ein paar Provinzen innerhalb der deutschen Dichtung und Denkung, sondern ausgreifen auf andere Literaturen. Hierzu braucht’s keine eigens bestallte Komparatistik. Es genügt eine ausgeprägte, aber auch wählerische Lesevöllerei. Denn das Handwerk, mit poetischen Texten umzugehen, das beherrschen wir ja. Bisher war nur von offiziell anerkannter Literatur die Rede. Plebiszitäre Literaturwissenschaft hat aber auch mit populären Werken zu tun, ohne sie priesterlich abzukanzeln als »trivial«. Wenn ich über Abenteuer-Romane und über Operetten geschrieben habe, dann gerade nicht, um ideologiekritisch allerlei falsches Bewußtsein aufzuspüren und anzukreiden. Denn das ließe sich auch bei feinsinniger Literatur besorgen. Es ging vielmehr darum, die Faszination dieser landläufigen Künste (auch auf mich) zu durchschauen und durchschaubar zu machen. Nicht etwa, um sie zu entzaubern, sondern um sie daraufhin potenziert auskosten zu können.
Dabei hat sich gezeigt, falls ich nicht ungewollt gemogelt habe: Abenteuer-Romane wie auch Operetten – üblicherweise von jenen, die sie kaum kennen, abgetan als Beschwichtigungsfutter für Zukurzgekommene – entfachen mehr lustvoll kritische Energien als beispielsweise Romane von Thomas Mann oder Tragödien von Hebbel. Wer unverkrampft und intensiv auf derlei Künste eingeht, kann an und mit ihnen überraschende Entdeckungen machen. Nur gradweis, aber nicht qualitativ ist ihre poetische Sensation eine andere als etwa die von Leopardi-Gedichten, von Goethes Iphigenie oder von Faulkners Romanen.Aus Volker Klotz, Interpretieren? Zugänglich machen! – in: Literatur und Lernen, Zur berufsmäßigen Aneignung von Literatur, Luchterhand Verlag 1985
Das Zitat der Woche
.
Das hol’ ich mir
Max Nyffeler
.
Im April fällte ein Gericht in Stockholm ein Urteil, das weltweit Beachtung fand. Die vier Betreiber der schwedischen Internet-Musiktauschbörse Pirate Bay wurden wegen «Komplizenschaft bei der Bereitstellung von Raubkopien» zu harten Strafen verurteilt: Je ein Jahr Gefängnis und eine Schadenersatzzahlung von insgesamt 2,7 Millionen Euro. Da Pirate Bay das weitweit größte Netzwerk für den illegalen Austausch von Musikfiles darstellt, wird das Verfahren international als Musterprozess eingestuft. Die Verurteilten haben Berufung eingelegt; sollte das Urteil Bestand haben, wird es in anderen Ländern wohl zu ähnlichen Prozessen kommen.
Im Vorfeld gaben sich die vier Piraten noch siegessicher: Sie versuchten sich als Robin Hood im Kampf gegen die internationalen Konzerne darzustellen und gaben sich als idealistische Musikfreunde aus: Ihr Netzwerk sei eine gemeinnützige Plattform und diene kulturellen Zwecken. Juristisch gesehen täten sie ohnehin nichts Böses; ihr Server stelle bloß die Kontakte zwischen den Tauschwilligen her, aber Musik sei darauf keine gespeichert. Wenn man nach Schuldigen suchen wolle, dann bitte sehr bei den weltweit verstreuten, einzelnen Usern.
Auf solche formaljuristischen Spitzfindigkeiten ging das Gericht nicht ein, zumal die Webseite offenbar auch stattliche Werbeeinnahmen generiert; die schwedische Polizei schätzt sie auf rund 1,7 Millionen Euro jährlich. Von Gemeinnützigkeit kann also keine Rede sein. Auch über ihre Absichten herrscht Klarheit. Sie ist ein Ableger der schwedischen Organisation «Piratbyrån», über die es bei Wikipedia heißt, sie unterstütze «den individuellen Kampf gegen Copyright und geistiges Eigentum durch das Tauschen von Informationen und Kulturaspekten».Dass dieser Prozess ein so heftiges Pro und Contra ausgelöst hat, liegt nicht nur an der juristischen Grauzone, in der er sich bewegte, sondern auch an der altbekannten Tatsache, dass sich das antihierarchisch strukturierte Internet nicht unter Kontrolle bringen lässt. Es ist ein weitgehend rechtsfreier Raum. Von den Anhängern der großen Cyber-Freiheit wurden Fakten geschaffen, die kaum rückgängig zu machen sind. Dazu gehört auch die Aneignung fremden geistigen Eigentums in großem Stil. Ein Unrechtsbewusstsein gibt es dabei kaum, denn es machen ja alle mit bei diesem munteren Versteckspiel, in dem Millionen Jugendlicher dazu angeleitet werden, den bösen Musikkonzernen durch den Austausch von Schwarzkopien eine Streich zu spielen.
«Das hol’ ich mir»: Diese rücksichtslose Selbstbedienungsmentalität wird mit einem dumpfen antikapitalistischen Gerede legitimiert. Dass dabei die Interessen der Autoren und der sie vertretenden Institutionen massiv geschädigt werden, ist den Tätern offensichtlich egal. Die Verhältnisse sind pervertiert: Ein schwedischer Schriftsteller, der den Diebstahl öffentlich beklagte, wurde von der Meute im Netz als «gieriger Autor» beschimpft.
Vielleicht trägt das jetzige Urteil ein klein wenig zur Bewusstseinsbildung bei. Viel Hoffnung sollte man sich nicht machen, denn wird im Internet an einem Ort ein Loch gestopft, tut sich gleich daneben das nächste auf. Doch vielleicht dämmert es langsam auch denen, die bisher schmunzelnd zugeschaut haben, dass diese Räuberpraxis nichts mit Freiheitsrechten und Jugendkultur und schon gar nichts mit Demokratie zu tun hat, sondern schlicht und einfach eine Enteignung der geistig Arbeitenden durch einen anonymen Pöbel darstellt, der sich bei seiner Beschaffungskriminalität an die Grundsätze der Bonusjäger aus der Finanzwelt hält: Raffe, was du kannst, sonst nimmt’s ein Anderer.Aus Max Nyffeler, Beckmesser-Kolumne Mai 2009, in: Beckmesser – Die Seite für neue Musik und Musikkritik
Das Zitat der Woche
.
Über den Schein der Wahrheit
Friedrich Nietzsche
.
Auf welchen Standpunkt der Philosophie man sich heute auch stellen mag: von jeder Stelle aus gesehn ist die Irrtümlichkeit der Welt, in der wir zu leben glauben, das Sicherste und Festeste, dessen unser Auge noch habhaft werden kann – wir finden Gründe über Gründe dafür, die uns zu Mutmaßungen über ein betrügerisches Prinzip im »Wesen der Dinge« verlocken möchten. Wer aber unser Denken selbst, also »den Geist« für die Falschheit der Welt verantwortlich macht – ein ehrenhafter Ausweg, den jeder bewußte oder unbewußte advocatus dei geht –: wer diese Welt samt Raum, Zeit, Gestalt, Bewegung, als falsch erschlossen nimmt: ein solcher hätte mindestens guten Anlaß, gegen alles Denken selbst endlich Mißtrauen zu lernen: hätte es uns nicht bisher den allergrößten Schabernack gespielt? und welche Bürgschaft dafür gäbe es, daß es nicht fortführe, zu tun, was es immer getan hat? In allem Ernste: die Unschuld der Denker hat etwas Rührendes und Ehrfurcht Einflößendes, welche ihnen erlaubt, sich auch heute noch vor das Bewußtsein hinzustellen, mit der Bitte, daß es ihnen ehrliche Antworten gebe: zum Beispiel ob es »real« sei, und warum es eigentlich die äußere Welt sich so entschlossen vom Halse halte, und was dergleichen Fragen mehr sind.
Der Glaube an »unmittelbare Gewißheiten« ist eine moralische Naivität, welche uns Philosophen Ehre macht: aber – wir sollen nun einmal nicht »nur moralische« Menschen sein! Von der Moral abgesehn, ist jener Glaube eine Dummheit, die uns wenig Ehre macht! Mag im bürgerlichen Leben das allzeit bereite Mißtrauen als Zeichen des »schlechten Charakters« gelten und folglich unter die Unklugheiten gehören: hier unter uns, jenseits der bürgerlichen Welt und ihres Jas und Neins – was sollte uns hindern, unklug zu sein und zu sagen: der Philosoph hat nachgerade ein Recht auf »schlechten Charakter«, als das Wesen, welches bisher auf Erden immer am besten genarrt worden ist – er hat heute die Pflicht zum Mißtrauen, zum boshaftesten Schielen aus jedem Abgrunde des Verdachts heraus. – Man vergebe mir den Scherz dieser düsteren Fratze und Wendung: denn ich selbst gerade habe längst über Betrügen und Betrogenwerden anders denken, anders schätzen gelernt und halte mindestens ein paar Rippenstöße für die blinde Wut bereit, mit der die Philosophen sich dagegen sträuben, betrogen zu werden. Warum nicht? Es ist nicht mehr als ein moralisches Vorurteil, daß Wahrheit mehr wert ist als Schein; es ist sogar die schlechtest bewiesene Annahme, die es in der Welt gibt. Man gestehe sich doch so viel ein: es bestünde gar kein Leben, wenn nicht auf dem Grunde perspektivischer Schätzungen und Scheinbarkeiten; und wollte man, mit der tugendhaften Begeisterung und Tölpelei mancher Philosophen, die »scheinbare Welt« ganz abschaffen, nun, gesetzt ihr könntet das – so bliebe mindestens dabei auch von eurer »Wahrheit« nichts mehr übrig! Ja, was zwingt uns überhaupt zur Annahme, daß es einen wesenhaften Gegensatz von »wahr« und »falsch« gibt? Genügt es nicht, Stufen der Scheinbarkeit anzunehmen und gleichsam hellere und dunklere Schatten und Gesamttöne des Scheins – verschiedene valeurs, um die Sprache der Maler zu reden? Warum dürfte die Welt, die uns etwas angeht – nicht eine Fiktion sein? Und wer da fragt: »aber zur Fiktion gehört ein Urheber?« – dürfte dem nicht rund geantwortet werden: Warum? Gehört dieses »Gehört« nicht vielleicht mit zur Fiktion? Ist es denn nicht erlaubt, gegen Subjekt, wie gegen Prädikat und Objekt, nachgerade ein wenig ironisch zu sein? Dürfte sich der Philosoph nicht über die Gläubigkeit an die Grammatik erheben? Alle Achtung vor den Gouvernanten: aber wäre es nicht an der Zeit, daß die Philosophie dem Gouvernanten-Glauben absagte?
Aus Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, darin: Der freie Geist, Sils-Maria/Schweiz 1885
Das Zitat der Woche
.
Über das Menschenleben
Max Stirner
.
Von dem Augenblicke an, wo er das Licht der Welt erblickt, sucht ein Mensch aus ihrem Wirrwarr, in welchem auch er mit allem Andern bunt durcheinander herumgewürfelt wird, sich herauszufinden und sich zu gewinnen.
Doch wehrt sich wiederum Alles, was mit dem Kinde in Berührung kommt, gegen dessen Eingriffe und behauptet sein eigenes Bestehen.
Mithin ist, weil Jegliches auf sich hält, und zugleich mit Anderem in stete Kollision gerät, der Kampf der Selbstbehauptung unvermeidlich.
Siegen oder Unterliegen, – zwischen beiden Wechselfällen schwankt das Kampfgeschick. Der Sieger wird der Herr, der Unterliegende der Untertan: jener übt die Hoheit und «Hoheitsrechte», dieser erfüllt in Ehrfurcht und Respekt die «Untertanenpflichten».
Aber Feinde bleiben beide und liegen immer auf der Lauer: sie lauern einer auf die Schwäche des andern, Kinder auf die der Eltern, und Eltern auf die der Kinder (z.B. ihre Furcht), der Stock überwindet entweder den Menschen oder der Mensch überwindet den Stock.
Im Kindheitsalter nimmt die Befreiung den Verlauf, daß Wir auf den Grund der Dinge oder «hinter die Dinge» zu kommen suchen: daher lauschen Wir Allen ihre Schwächen ab, wofür bekanntlich Kinder einen sichern Instinkt haben, daher zerbrechen Wir gerne, durchstöbern gern verborgene Winkel, spähen nach dem Verhüllten und Entzogenen, und versuchen Uns an Allem. Sind Wir erst dahinter gekommen, so wissen Wir Uns sicher; sind Wir z.B. dahinter gekommen, daß die Rute zu schwach ist gegen Unsern Trotz, so fürchten Wir sie nicht mehr, «sind ihr entwachsen». Hinter der Rute steht, mächtiger als sie, unser – Trotz, unser trotziger Mut. Wir kommen gemach hinter alles, was Uns unheimlich und nicht geheuer war, hinter die unheimlich gefürchtete Macht der Rute, der strengen Miene des Vaters usw., und hinter allem finden Wir Unsere – Ataraxie, d.h. Unerschütterlichkeit, Unerschrockenheit, unsere Gegengewalt, Übermacht, Unbezwingbarkeit. Was Uns erst Furcht und Respekt einflößte, davor ziehen Wir Uns nicht mehr scheu zurück, sondern fassen Mut. Hinter allem finden Wir Unsern Mut, Unsere Überlegenheit; hinter dem barschen Befehl der Vorgesetzten und Eltern steht doch Unser mutiges Belieben oder Unsere überlistende Klugheit. Und je mehr Wir Uns fühlen, desto kleiner erscheint, was zuvor unüberwindlich dünkte. Und was ist Unsere List, Klugheit, Mut, Trotz? Was sonst als – Geist!Eine geraume Zeit hindurch bleiben Wir mit einem Kampfe, der später Uns so sehr in Atem setzt, verschont, mit dem Kampfe gegen die Vernunft. Die schönste Kindheit geht vorüber, ohne daß Wir nötig hätten, Uns mit der Vernunft herumzuschlagen. Wir kümmern Uns gar nicht um sie, lassen Uns mit ihr nicht ein, nehmen keine Vernunft an. Durch Überzeugung bringt man Uns zu nichts, und gegen die guten Gründe, Grundsätze usw. sind Wir taub; Liebkosungen, Züchtigungen und Ähnlichem widerstehen Wir dagegen schwer.
Dieser saure Lebenskampf mit der Vernunft tritt erst später auf, und beginnt eine neue Phase: in der Kindheit tummeln Wir Uns, ohne viel zu grübeln.
Geist heißt die erste Selbstfindung, die erste Entgötterung des Göttlichen, d.h. des Unheimlichen, des Spuks, der «oberen Mächte». Unserem frischen Jugendgefühl, diesem Selbstgefühl, imponiert nun nichts mehr: die Welt ist in Verruf erklärt, denn Wir sind über ihr, sind Geist.
Jetzt erst sehen Wir, daß Wir die Welt bisher gar nicht mit Geist angeschaut haben, sondern nur angestiert.
An Naturgewalten üben Wir Unsere ersten Kräfte. Eltern imponieren Uns als Naturgewalt; später heißt es: Vater und Mutter sei zu verlassen, alle Naturgewalt für gesprengt zu erachten. Sie sind überwunden. Für den Vernünftigen, d.h. «Geistigen Menschen», gibt es keine Familie als Naturgewalt: es zeigt sich eine Absagung von Eltern, Geschwistern usw. Werden diese als geistige, vernünftige Gewalten «wiedergeboren», so sind sie durchaus nicht mehr das, was sie vorher waren.
Und nicht bloß die Eltern, sondern die Menschen überhaupt werden von dem jungen Menschen besiegt: sie sind ihm kein Hindernis, und werden nicht berücksichtigt: denn, heißt es nun: Man muß Gott mehr gehorchen, als den Menschen.
Alles «Irdische» weicht unter diesem hohen Standpunkte in verächtliche Ferne zurück: denn der Standpunkt ist der – himmlische.
Die Haltung hat sich nun durchaus umgekehrt, der Jüngling nimmt ein geistiges Verhalten an, während der Knabe, der sich noch nicht als Geist fühlte, in einem geistlosen Lernen aufwuchs. Jener sucht nicht der Dinge habhaft zu werden, z.B. nicht die Geschichtsdata in seinen Kopf zu bringen, sondern der Gedanken, die in den Dingen verborgen liegen, also z.B. des Geistes der Geschichte; der Knabe hingegen versteht wohl Zusammenhänge, aber nicht Ideen, den Geist; daher reiht er Lernbares an Lernbares, ohne apriorisch und theoretisch zu verfahren, d.h. ohne nach Ideen zu suchen.
Hatte man in der Kindheit den Widerstand der Weltgesetze zu bewältigen, so stößt man nun bei Allem, was man vorhat, auf eine Einrede des Geistes, der Vernunft, des eigenen Gewissens. «Das ist unvernünftig, unchristlich, unpatriotisch» u. dergl., ruft Uns das Gewissen zu, und – schreckt Uns davon ab. – Nicht die Macht der rächenden Eumeniden, nicht den Zorn des Poseidon, nicht den Gott, so fern er auch das Verborgene sieht, nicht die Strafrute des Vaters fürchten Wir, sondern das – Gewissen.
Wir «hängen nun Unsern Gedanken nach» und folgen ebenso ihren Geboten, wie Wir vorher den elterlichen, menschlichen folgten. Unsere Taten richten sich nach Unseren Gedanken (Ideen, Vorstellungen, Glauben), wie in der Kindheit nach den Befehlen der Eltern.
Indes gedacht haben Wir auch schon als Kinder, und waren unsere Gedanken keine fleischlosen abstrakten, absoluten, d.h. nichts als Gedanken, ein Himmel für sich, eine reine Gedankenwelt, logische Gedanken.
Im Gegenteil waren es nur Gedanken gewesen, die Wir Uns über eine Sache machten: Wir dachten Uns das Ding so oder so. Wir dachten also wohl: die Welt, die Wir da sehen, hat Gott gemacht; aber Wir dachten («erforschten») nicht die «Tiefen der Gottheit selber»; Wir dachten wohl: «das ist das Wahre an der Sache», aber Wir dachten nicht das Wahre oder die Wahrheit selbst, und verbanden nicht zu Einem Satze «Gott ist die Wahrheit». Die «Tiefen der Gottheit, welche die Wahrheit ist», berührten Wir nicht. Bei solchen rein logischen, d.h. theologischen Fragen: «Was ist Wahrheit» hält sich Pilatus nicht auf, wenngleich er im einzelnen Falle darum nicht zweifelt, zu ermitteln, «was Wahres an der Sache ist», d.h. ob die Sache wahr ist.
Jeder an eine Sache gebundene Gedanke ist noch nicht nichts als Gedanke, absoluter Gedanke.
Den reinen Gedanken zu Tage zu fördern, oder ihm anzuhängen, das ist Jugendlust, und alle Lichtgestalten der Gedankenwelt, wie Wahrheit, Freiheit, Menschentum, der Mensch usw. erleuchten und begeistern die jugendliche Seele.
Ist aber der Geist als das Wesentliche erkannt, so macht es doch einen Unterschied, ob der Geist arm oder reich ist, und man sucht deshalb reich an Geist zu werden: es will der Geist sich ausbreiten, sein Reich zu gründen, ein Reich, das nicht von dieser Welt ist, der eben überwundenen. So sehnt er sich denn alles in allem zu werden, d.h. obgleich Ich Geist bin, bin Ich doch nicht vollendeter Geist, und muß den vollkommenen Geist erst suchen.
Damit verliere Ich aber, der Ich Mich soeben als Geist gefunden hatte, sogleich Mich wieder, indem Ich vor dem vollkommenen Geiste, als einem Mir nicht eigenen, sondern jenseitigen Mich beuge und meine Leerheit fühle.Aus Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, Leipzig 1844
Das Zitat der Woche
.
Über die Abstammung des Menschen
Charles Darwin
.
Viele der Ansichten, die ich ausgesprochen habe, sind sehr spekulativ, und manche werden sich zweifellos als irrig erweisen; aber ich habe in jedem einzelnen Fall die Gründe angegeben, die mir die eine Ansicht annehmbarer machten als eine andere. Es schien mir der Mühe wert, zu versuchen, wieweit das Prinzip der Entwicklung einige der kompliziertesten Probleme in der Naturgeschichte des Menschen aufklären könne. Falsche Tatsachen sind äußerst schädlich für den Fortschritt der Wissenschaft, denn sie erhalten sich oft lange; falsche Theorien dagegen, die einigermaßen durch Beweise gestützt werden, tun keinen Schaden; denn jedermann bestrebt sich mit löblichem Eifer, ihre Unrichtigkeit zu beweisen. Und wenn diese Arbeit getan ist, so ist ein Weg zum Irrtum gesperrt, und der Weg zur Wahrheit ist oft in demselben Moment eröffnet.
Die wichtigste Schlußfolgerung, zu der wir hier gekommen sind und die jetzt von vielen kompetenten und urteilsfähigen Naturforschern angenommen wird, ist der Satz, daß der Mensch von einer weniger hoch organisierten Form abstammt. Die Gründe, auf denen diese Schlußfolgerung ruht, werden niemals erschüttert werden. Die große Ähnlichkeit zwischen dem Menschen und den unter ihm stehenden Tieren sowohl in der Embryonalentwicklung als auch in unzähligen bedeutungsvollen oder auch bedeutungslosen Punkten der Struktur und der Konstitution, die Rudimente, die er noch bewahrt, und die abnormen Rückschläge, denen er zuweilen unterworfen ist – das sind Tatsachen, die nicht bestritten werden können. Man hat sie schon lange gekannt, aber bis vor kurzem haben sie uns nichts über den Ursprung des Menschen zu sagen gewußt. Wenn man sie jetzt im Lichte unserer Kenntnisse über die ganze organische Welt betrachtet, ist ihre Bedeutung unverkennbar. Das große Prinzip der Entwicklung steht da klar und fest, wenn diese Tatsachengruppen betrachtet werden in Verbindung mit anderen, wie den wechselseitigen Verwandtschaftsbeziehungen der Glieder einer Gruppe, ihrer geographischen Verbreitung in Vergangenheit und Gegenwart und ihrer geologischen Aufeinanderfolge. Es ist nicht anzunehmen, daß alle diese Tatsachen eine falsche Sprache reden sollten. Wer nicht gleich einem Wilden damit zufrieden ist, die Naturerscheinungen als unzusammenhängende Geschehnisse zu betrachten, der kann nicht länger mehr glauben, daß der Mensch seinen Ursprung einem separaten Schöpfungsakt verdanke. Er wird sich zur Erkenntnis gezwungen sehen, daß die große Ähnlichkeit eines Menschenembryos mit dem Embryo z. B. eines Hundes, der Bau seines Schädels, seiner Gliedmaßen und seines ganzen Körpers nach demselben Plan wie bei den anderen Säugetieren, unabhängig von dem Gebrauch, zu dem die Teile bestimmt sind, das gelegentliche Wiedererscheinen verschiedener Strukturen, z.B. verschiedener Muskeln, die der Mensch normalerweise nicht besitzt, die jedoch bei den Quadrumanen gewöhnlich sind, und eine Menge analoger Tatsachen in der deutlichsten Weise zu dem Schluß führen, daß der Mensch und die anderen Säugetiere von derselben Stammform abstammen.Wir haben gesehen, daß der Mensch beständig individuelle Verschiedenheiten in allen Teilen seines Körpers wie in seinen geistigen Fähigkeiten aufweist. Diese Verschiedenheiten oder Variationen scheinen auf denselben allgemeinen Ursachen zu beruhen und denselben Gesetzen zu gehorchen wie bei den tiefer stehenden Tieren. Bei beiden herrschen die gleichen Gesetze der Vererbung. Der Mensch vermehrt sich in einem stärkeren Maße als seine Existenzmittel; infolgedessen ist er gelegentlich einem harten Kampf um die Existenz ausgesetzt, und die natürliche Zuchtwahl wird getan haben, was in ihrer Macht steht. Eine Aufeinanderfolge gut ausgeprägter Variationen von ähnlichem Charakter ist durchaus nicht erforderlich; geringe fluktuierende individuelle Verschiedenheiten genügen für die Betätigung der natürlichen Zuchtwahl; anzunehmen, daß in derselben Spezies alle Teile des Körpers der Variation in demselben Grade unterliegen, haben wir keinen Grund. Wir können versichert sein, daß die vererbten Wirkungen des lange andauernden Gebrauchs oder Nichtgebrauchs der Teile viel getan haben und in derselben Richtung wie die natürliche Zuchtwahl. Vormals bedeutungsvolle Modifikationen werden immer wieder vererbt, wenn sie gleich keinen speziellen Nutzen mehr haben. Wird der eine Teil modifiziert, so ändern sich andere Teile nach dem Prinzip der Korrelation, von dem wir Beispiele in vielen merkwürdigen Fällen von korrelativen Monstrositäten besitzen. Etwas kann auch der direkten und bestimmten Wirkung der umgebenden Lebensbedingungen zugeschrieben werden, wie z.B. reichlicher Nahrung, Wärme oder Feuchtigkeit; und schließlich sind auch viele Eigenschaften von geringer, einige von beträchtlicher physiologischer Bedeutung durch sexuelle Zuchtwahl erworben worden.
Es ist kein Zweifel, daß der Mensch ebenso wie jedes andere Tier Strukturen aufweist, die nach unserer beschränkten Kenntnis durchaus keinen Nutzen für ihn haben noch jemals gehabt haben, sei es im Hinblick auf die allgemeinen Lebensbedingungen oder sei es für die Beziehungen des einen Geschlechtes zum anderen. Solche Strukturen können durch keine Art von Selektion, auch nicht durch die vererbten Wirkungen des Gebrauchs oder Nichtgebrauchs, erklärt werden. Wir wissen, daß viele seltsame und ausgeprägte Besonderheiten der Struktur gelegentlich bei unseren domestizierten Erzeugnissen erscheinen, und wenn ihre unbekannten Ursachen gleichmäßig wirken würden, so würden sie wahrscheinlich bei allen Individuen einer Art gemein werden. Wir können hoffen, daß wir künftig etwas von den Ursachen solcher gelegentlicher Modifikationen wissen werden, besonders durch das Studium der Monstrositäten; hier versprechen die Arbeiten der Experimentatoren, wie eines Camille Dareste, viel für die Zukunft. Im allgemeinen können wir nur sagen, daß die Ursachen jeder geringen Modifikation wie jeder Monstrosität mehr in der Konstitution des Organismus als in der Natur der umgebenden Bedingungen liegen, wenn auch neue und veränderte Bedingungen für die Anregung organischer Veränderungen von mancherlei Art sicherlich eine bedeutende Rolle spielen.
Durch die angeführten Mittel, unterstützt vielleicht durch andere, noch unentdeckte, hat sich der Mensch auf seine gegenwärtige Stellung erhoben. Seitdem er aber die Würde der Menschheit erreicht hat, hat er sich in verschiedene Rassen, oder, wie sie passender genannt werden können, in Sub-Spezies gespalten. Einige von diesen, wie die Neger und Europäer, sind so verschiedenartig, daß, wenn einem Naturforscher einige Exemplare ohne weitere Information übergeben würden, dieser sie unzweifelhaft als gute und echte Arten betrachten würde. Es stimmen aber alle Rassen in so vielen unbedeutenden Details der Strukt rund in so vielen geistigen Besonderhetien überein, daß sie nur durch Vererbung von einer gemeinsamen Stammform erklärt werden können; und eine so charakterisierte Stammform würde wahrscheinlich als Mensch bezeichnet werden müssen.Aus Charles Darwin, Die Abstammung des Menschen, Stuttgart 1871
Das Zitat der Woche
.
Über das Buch
Roger Willemsen
.
Das Buch ist ein Produkt, und es ist nichts so wenig wie ein Produkt, nämlich intelligibles, sensibles, moralisches Massiv. Deshalb hat der Bertelsmann-Manager, der mal von einem Roman zu mir sagte: «Das Buch wird auch vom Lesen nicht besser», nicht nur unrecht: Das Buch ist im Leser, bevor es gelesen wird. Es wird historisch ganz anders notiert als Gebrauchswaren oder selbst andere Kulturträger, es hat sich technisch nicht erneuert, und bleibt umgeben von der Aura der historischen Kulturleistung. Es braucht deshalb mehr Versprechen, mehr Charisma als andere Waren, und es verlangt, dass der Warencharakter an ihm möglichst unfühlbar sei.
Bücher wollen auch deshalb wie Unikate behandelt werden. Sie sollen Individuen sein und individuelle Begegnungen ermöglichen. In dieser Hinsicht bilden sich rund um das Buch Geheimgesellschaften und Solidargemeinschaften. Man muss es folglich entweder anbieten wie eine Pforte eben zu diesen oder, sofern es sich um Bestseller handelt, wie ein Tor zu jener Massen-Gemeinschaft, an der man partizipieren will wie an «Wetten dass», ungeachtet, wie einfältig sie unter Umständen ist. Man reist also auf Büchern immer entweder in die Vereinzelung oder in die Masse und möchte mit dem Mehrwert des Einen oder des Anderen beschenkt werden.Leser suchen im Buch (ich rede nicht von Unterhaltung und nicht vom Sachbuch) den von ihnen, nur von ihnen zu entziffernden Satz, sie suchen das Original, die erste Begegnung. Will man in ein Buch einführen oder auf es aufmerksam machen, orientiere man sich also weniger am Stoff als vielmehr am Satz, an der Situation, dem Versprechen des Einzigartigen, selbst am Atmosphärischen oder Klimatischen, das Epische allein trägt ausschließlich Unterhaltungsromane.
Lesen ist anachronistisch durch das Zeitmaß und durch die Konzentration, die es fordert. Das Versprechen, das zum Buch führt, muss also substantieller sein als bei anderen Produkten. Es muss die Mühe und den Zeitverlust, samt dem Gefühl kompensieren, lesend an der gegenwärtigen Welt nicht teilzunehmen. Der Akt des Lesens bleibt deshalb ein Akt der Besonderung, den man entweder durch Wissensvorsprünge aller Art honoriert oder durch das Versprechen überwundener Einsamkeit. Weil es sich hier uni eine produzierte Rezeption handelt, nicht um eine automatische, steht sie gegen die Beliebigkeit, mit der Bilder oder musikalische Einheiten sich vermitteln.Aus Roger Willemsen, 20 Thesen zu Buch und Buchmarkt heute, Vortrag an der Jahrestagung der Deutschen Publikumsverlage, München 2007
Das Zitat der Woche
.
Über die drei Forderungen an den Menschen
Friedrich Schiller
.
Ebenso wie der griechische Bildhauer die unnütze und hinderliche Last der Gewänder hinweg wirft, um der menschlichen Natur mehr Platz zu machen, so entbindet der griechische Dichter seine Menschen von dem ebenso unnützen und ebenso hinderlichen Zwang der Konvenienz und von allen frostigen Anstandsgesetzen, die an dem Menschen nur künsteln und die Natur an ihm verbergen. Die leidende Natur spricht wahr, aufrichtig und tief eindringend zu unserm Herzen in der Homerischen Dichtung und in den Tragikern; alle Leidenschaften haben ein freies Spiel und die Regel des Schicklichen hält kein Gefühl zurück. Die Helden sind für alle Leiden der Menschheit so gut empfindlich als andere und eben das macht sie zu Helden, dass sie das Leiden stark und innig fühlen, und doch nicht davon überwältigt werden. Sie lieben das Leben so feurig wie wir andern, aber diese Empfindung beherrscht sie nicht so sehr, dass sie es nicht hingeben können, wenn die Pflichten der Ehre oder der Menschlichkeit es fordern. Philoktet erfüllt die griechische Bühne mit seinen Klagen; selbst der wütende Herkules unterdrückt seinen Schmerz nicht. Die zum Opfer bestimmte Iphigenia gesteht mit rührender Offenheit, dass sie von dem Licht der Sonne mit Schmerzen scheide. Nirgends sucht der Grieche in der Abstumpfung und Gleichgültigkeit gegen das Leiden seinen Ruhm, sondern in Ertragung desselben bei allem Gefühl für dasselbe. Selbst die Götter der Griechen müssen der Natur einen Tribut entrichten, sobald sie der Dichter der Menschheit näher bringen will. Der verwundete Mars schreit vor Schmerz so laut auf, wie zehntausend Mann und die von einer Lanze geritzte Venus steigt weinend zum Olymp und verschwört alle Gefechte.
Diese zarte Empfindlichkeit für das Leiden, diese warme, aufrichtige, wahr und offen daliegende Natur, welche uns in den griechischen Kunstwerken so tief und lebendig rührt, ist ein Muster der Nachahmung für alle Künstler und ein Gesetz, das der griechische Genius der Kunst vorgeschrieben hat. Die erste Forderung an den Menschen macht immer und ewig die Natur, welche niemals darf abgewiesen werden; denn der Mensch ist – ehe er etwas anderes ist – ein empfindendes Wesen. Die zweite Forderung an ihn macht die Vernunft, denn er ist ein vernünftig empfindendes Wesen, eine moralische Person und für diese ist es Pflicht, die Natur nicht über sich herrschen zu lassen, sondern sie zu beherrschen. Erst alsdann, wenn erstlich der Natur ihr Recht ist angetan worden und wenn zweitens die Vernunft das ihrige behauptet hat, ist es dem Anstand erlaubt, die dritte Forderung an den Menschen zu machen und ihm, im Ausdruck sowohl seiner Empfindungen als seiner Gesinnungen, Rücksicht gegen die Gesellschaft aufzulegen und sich als ein zivilisiertes Wesen zu zeigen.
Aus Friedrich Schiller, Über das Pathetische, Leipzig 1801
Das Zitat der Woche
.
Von der Evidenz der Werte
Friedrich Waismann
.
Gibt es wirklich eine Evidenz, die uns mit untrüglicher Sicherheit verkündet, wo ein Wert vorliegt? – Die Anrufung der Evidenz als letzten Ankergrund der Erkenntnis muß heute jeden redlichen Denker mit einem gewissen Mißtrauen erfüllen. Auf keinem Gebiet hat man der Evidenz eine solche Bedeutung beigemessen wie in der Mathematik und Logik. Aber gerade auf diesem Gebiet hat sich gezeigt, daß vermeintlich absolut evidente Wahrheiten Irrtümer sind, die durch eine feinere (logische) Kritik ans Licht gezogen werden. Hier ein paar Beispiele:
Es scheint erstens evident zu sein, daß das Ganze größer ist als der Teil. Es scheint zweitens evident zu sein, daß zwei Mengen von gleichem Umfang sind, wenn es möglich ist, ihre Elemente ein-eindeutig aufeinander abzubilden, d.h. so, daß jedem Element der ersten Menge ein Element der zweiten und jedem Element der zweiten Menge ein Element der ersten entspricht. Und doch führen diese zwei Sätze, die uns so evident, so einleuchtend erscheinen, sogleich auf einen logischen Widerspruch. Wenn man z. B. zwei Strecken von ungleicher Länge aufeinander projiziert, so entspricht jedem Punkt der einen Strecke genau ein Punkt der anderen und umgekehrt; es gibt keinen Punkt, der dabei leer ausgeht. Man müßte also sagen, daß die beiden Strecken gleichviel Punkte enthalten – und doch stellt die eine Strecke offenbar einen echten Teil der anderen dar.
Es scheint evident zu sein, daß eine stetige Kurve in jedem Punkte eine bestimmte Fortschreitungsrichtung hat, und doch hat Weierstraß die mathematische Welt
mit der Entdeckung einer Kurve überrascht, die überall stetig ist und doch nirgends eine bestimmte Richtung besitzt.
Es scheint evident zu sein, daß jedem Prädikat ein Umfang entspricht, die Klasse der Dinge, die unter das Prädikat fallen. Und doch führt dieses scheinbar evidente Prinzip zu Antinomien, wie Russell an einem bestimmten Beispiel gezeigt hat.
Was halten Sie von dem folgenden Satz: Es ist möglich, die ganze unendliche Ebene derart mit Quadraten von abnehmender Größe zu überdecken, daß 1. kein noch so kleiner Bezirk der Ebene von diesen bedeckenden Quadraten freibleibt und daß 2. die Flächensumme aller zur Bedeckung verbrauchten Quadrate beliebig klein ist, z. B. kleiner als 1 Quadratmillimeter? Sie werden sagen: Unsinn, das ist ganz unmöglich! Und doch ist das eine jedem Mathematiker vollkommen geläufige Tatsache, auf die zuerst E. Borel aufmerksam gemacht hat.
Angesichts solcher Erfahrungen ist es verständlich, daß der Kenner der exakten Wissenschaft heute außerordentlich vorsichtig ist, wenn er eine Behauptung durch Berufung auf die Evidenz verteidigen hört. Wenn schon in der Geometrie und Logik, wo die Kraft der Evidenz den höchsten Grad zu besitzen scheint, Evidenztäuschungen vorkommen – was soll man da erst von der Evidenz auf dem Gebiet der Wertungen halten, wo die Überzeugungen der Menschen so notorisch auseinander gehen?
Wir wollen indessen nicht vorschnell urteilen. Vielleicht gibt es doch eine Intuition, ein inneres Schauen, durch das uns der Unterschied zwischen Wert und Unwert offenbar wird. Vielleicht haben doch die Philosophen recht, welche sich auf eine solche intuitive Quelle der Moral berufen.Diese Philosophen versichern uns, daß die Menschen in ihren Urteilen über Wert und Unwert übereinstimmen, obwohl manchmal Irrtümer unterlaufen und es sogar einzelne Menschen geben mag, die wertblind sind. Ist damit die Situation auf dem Gebiet moralischer Wertungen richtig gekennzeichnet? Kann ein Beobachter, der von einem anderen Stern niederstiege und die Menschen sorgfältig betrachtete – ich meine nicht nur ihre Worte, sondern ihre Handlungen und Gefühle – mit diesem Bericht übereinstimmen? Würde er auch nur ein Gebiet von Wertungen entdecken, über die alle Menschen einig sind? Nehmen Sie ein Gebot wie »Du sollst nicht töten«. Ist das allgemein anerkannt? Nein, denn das Töten im Krieg ist ja erlaubt. Aber wie, das ist vielleicht nur Opportunismus, Ducken vor der Staatsmacht und nicht der Ausdruck der inneren Überzeugung? Nehmen wir einen anderen Fall. Wenn es einen menschlichen Unhold gäbe, der von der größten Gemeingefährlichkeit ist, ein Menschenschlächter im Stil Dschingis-Khans, der dabei über eine furchtbare Intelligenz verfügte, die ihn seinen Zeitgenossen überlegen macht – würden da nicht viele aus aufrichtigem Herzen erklären, es sei nur ein Verdienst, ein solches Scheusal aus der Welt zu schaffen? Und würde es nicht andere geben, die auch das Töten dieses Menschen für Sünde hielten? Denken Sie an die endlosen Diskussionen, ob der Staat das Recht habe, einen Menschen zum Tod zu verurteilen. Wie steht es mit der Frage, ob man einen unheilbar Kranken auf sein eigenes Verlangen töten darf? Ist Selbstmord unmoralisch? Denken Sie an Weinfinger, der Selbstmord beging, weil er fühlte, daß die verbrecherischen Elemente in seiner Natur die Überhand gewannen – der also Selbstmord beging, weil er das Ethische liebte: war das nun ethisch oder nicht?
Aber, so werden Sie sagen, es gibt eben Ausnahmen; und dies nur darum, weil das Motiv in diesen Fällen Leidverminderung ist. Leidverminderung ist das wahre ethische Gesetz, das wir alle anerkennen. Aber dazu ist erstens zu sagen, daß viele meinen, daß Leid vertiefe, also wertvoll sei, und daß zweitens die Frage ist, was man als wertvoller betrachten will, ein gleichmäßig temperiertes Leben mit geringen Gefühlsschwankungen, oder ein Leben, in die Tiefen bewegt, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt.
Aber dann ist doch Glücksmehrung etwas, das ungeteilt als gut gilt? Halt! Der Begriff des Glücks ist selbst wieder von moralischen Forderungen abhängig und in die Farbe eines ethischen Ideals getaucht. Glück ist doch etwas viel Komplizierteres als bloßes Wohlgefühl oder gegenwärtige Lust. Bedenken wir, wie verschieden das »Glück« aussieht, je nachdem hedonistische, heroische, asketische Ideale die Herrschaft haben. Die Formel, gut sei das, was das Glück vermehrt, sagt gar nichts, solange nicht näher erklärt wird, worin das Glück und die Glücksmehrung bestehen soll; und das bestimmen die Bekenner verschiedener Ethiken in verschiedener Weise. Ich frage nun wieder: gibt es eine wissenschaftliche Entscheidung, welches Glück das wertvolle, rechte Glück ist? Ist Glück das Glück des Kriegers, des Kampfes und Siegs? Ist Glück die Abtötung der sinnlichen Freuden, die Erforschung des Gewissens und das Suchen nach Gott? Ist Glück das gute Gewissen, das Gefühl der erfüllten Pflicht? Ist Glück, wie die Stoiker meinten, die »Meeresstille des Gemüts«? Ist Glück die Liebe? Ist Glück die heitere Zufriedenheit der Unschuld, das idyllische Behagen? Ist Glück der dionysische Rausch, in dem ein göttliches Licht die Welt erfüllt, wir uns eins fühlen mit dem Universum und die Musik der Sternenkreise vernehmen? Besteht das Glück in jenen seltenen Viertelstunden, in denen uns eine lichte, schwerelose Heiterkeit erfüllt, das Glück, das auf Taubenfüßen kommt? Oder ist das Glück das Glück des Schaffens? Wenn Gott zu einer Seele spräche: »Wähle dir das Leben und die Glücksform, die du haben willst!« – könnte sie erkennen und entdecken, welches Glück das beste ist?
Nun könnte man sagen: Gut ist, was zur Glücksmehrung in einem dieser Sinne führt, indem man sich das Glück durch eine Disjunktion dieser Beschreibungen definiert denkt. Aber damit wäre wieder nichts geholfen: denn die Ideale kämpfen miteinander, und wer das Glück in dem Behagen und in der Idylle sieht, kann nicht das Glück des Kampfes predigen, und was gut in seinem Sinne heißt, ist bös im Sinne des anderen. »Gut ist, was glücksmehrend ist.« Ja, hier scheinen alle übereinzustimmen; aber nur in den Worten, nicht in dem, was sie mit den Worten meinen, und geht man auf die Meinung zurück, so zerrinnt jene anscheinende Einhelligkeit.Aus Friedrich Waismann, Ethik und Wissenschaft, in: Wille und Motiv, Reclam 1983
Das Zitat der Woche
.
Über die Dummheit
Robert Musil
.
Im Leben versteht man unter einem dummen Menschen gewöhnlich einen, der »ein bißchen schwach im Kopf« ist. Außerdem gibt es aber auch die verschiedenartigsten geistigen und seelischen Abweichungen, von denen selbst eine unbeschädigt eingeborene Intelligenz so behindert und durchkreuzt und irregeführt werden kann, daß es im ganzen auf etwas hinausläuft, wofür dann die Sprache wieder nur das Wort Dummheit zur Verfügung hat. Dieses Wort umfaßt also zwei im Grunde sehr verschiedene Arten: eine ehrliche und schlichte Dummheit und eine andere, die, ein wenig paradox, sogar ein Zeichen von Intelligenz ist. Die erstere beruht eher auf einem schwachen Verstand, die letztere eher auf einem Verstand, der bloß im Verhältnis zu irgend etwas zu schwach ist, und diese ist die weitaus gefährlichere.
Die ehrliche Dummheit ist ein wenig schwer von Begriff und hat, was man eine »lange Leitung« nennt. Sie ist arm an Vorstellungen und Worten und ungeschickt in ihrer Anwendung. Sie bevorzugt das Gewöhnliche, weil es sich ihr durch seine öftere Wiederholung fest einprägt, und wenn sie einmal etwas aufgefaßt hat, ist sie nicht geneigt, es sich so rasch wieder nehmen zu lassen, es analysieren zu lassen oder selbst daran zu deuteln. Sie hat überhaupt nicht wenig von den roten Wangen des Lebens! Zwar ist sie oft unbestimmt in ihrem Denken, und die Gedanken stehen ihr vor neuen Erfahrungen leicht ganz still, aber dafür hält sie sich auch mit Vorliebe an das sinnlich Erfahrbare, das sie gleichsam an den Fingern abzählen kann. Mit einem Wort, sie ist die liebe »helle Dummheit«, und wenn sie nicht manchmal auch so leichtgläubig, unklar und zugleich so unbelehrbar wäre, daß es einen zur Verzweiflung bringen kann, so wäre sie eine überaus anmutige Erscheinung.
Ich mag mir nicht versagen, diese Erscheinung noch mit einigen Beispielen auszuzieren, die sie auch von anderen Seiten zeigen und die ich Bleulers Lehrbuch der Psychiatrie entnommen habe: Ein Imbeziller drückt, was wir mit der Formel »Arzt am Krankenbett« abtäten, mit den Worten aus: »Ein Mann, der hält dem ändern die Hand, der liegt im Bett, dann steht da eine Nonne.« Es ist die Ausdrucksweise eines malenden Primitiven! Eine nicht ganz klare Magd betrachtet es als schlechten Scherz, wenn man ihr zumutet, sie solle ihr Erspartes der Kasse übergeben, wo es Zinsen trage: So dumm werde niemand sein, ihr noch etwas dafür zu bezahlen, daß er ihr das Geld aufbewahre! gibt sie zur Antwort; und es drückt sich darin eine ritterliche Gesinnung aus, ein Verhältnis zum Geld, das man vereinzelt noch in meiner Jugend an vornehmen alten Leuten hat wahrnehmen können! Einem dritten Imbezillen endlich wird es symptomatisch aufgeschwärzt, daß er behauptet, ein Zweimarkstück sei weniger wert als ein Markstück und zwei halbe, denn – so lautet seine Begründung: man müsse es wechseln, und dann bekäme man zu wenig heraus! Ich hoffe, nicht der einzige Imbezille in diesem Saal zu sein, der dieser Werttheorie für Menschen, die beim Wechseln nicht aufpassen können, herzlich zustimmt!
Um aber nochmals auf das Verhältnis zur Kunst zurückzukehren, die schlichte Dummheit ist wirklich oft eine Künstlerin. Statt auf ein Reizwort mit einem ändern Wort zu erwidern, wie es in manchen Experimenten einstens sehr üblich war, gibt sie gleich ganze Sätze zur Antwort, und man mag sagen, was man will, diese Sätze haben etwas wie Poesie in sich! Ich wiederhole, indem ich zuerst das Reizwort nenne, einige von solchen Antworten:
»Anzünden: Der Bäcker zündet das Holz an.
Winter: Besteht aus Schnee.
Vater: Der hat mich einmal die Treppe hinuntergeworfen.
Hochzeit: Dient zur Unterhaltung.
Garten: In dem Garten ist immer schön Wetter.
Religion: Wenn man in die Kirche geht.
Wer war Wilhelm Tell: Man hat ihn im Wald gespielt; es waren verkleidete Frauen und Kinder dabei.
Wer war Petrus: Er hat dreimal gekräht.«
Die Naivität und große Körperlichkeit solcher Antworten, der Ersatz höherer Vorstellungen durch das Erzählen einer einfachen Geschichte, das wichtige Erzählen von Überflüssigem, von Umständen und Beiwerk, dann wieder das abkürzende Verdichten wie in dem Petrus-Beispiel, das sind uralte Praktiken der Dichtung; und wenn ich auch glaube, daß ein Zuviel davon, wie es recht in Schwang ist, den Dichter dem Idioten annähert, so ist doch auch das Dichterische in diesem nicht zu verkennen, und es fällt ein Licht darauf, daß der Idiot in der Dichtung mit einer eigentümlichen Freude an seinem Geist dargestellt werden kann.Zu dieser ehrlichen Dummheit steht nun die anspruchsvolle höhere in einem wahrhaft nur zu oft schreienden Gegensatz. Sie ist nicht sowohl ein Mangel an Intelligenz als vielmehr deren Versagen aus dem Grunde, daß sie sich Leistungen anmaßt, die ihr nicht zustehen; und sie kann alle schlechten Eigenschaften des schwachen Verstandes an sich haben, hat aber außerdem auch noch alle die an sich, die ein nicht im Gleichgewicht befindliches, verwachsenes, ungleich bewegliches, kurz, ein jedes Gemüt verursacht, das von der Gesundheit abweicht. Weil es keine »genormten« Gemüter gibt, drückt sich, richtiger gesagt, in dieser Abweichung ein ungenügendes Zusammenspiel zwischen den Einseitigkeiten des Gefühls und einem Verstand aus, der zu ihrer Zügelung nicht hinreicht. Diese höhere Dummheit ist die eigentliche Bildungskrankheit (aber um einem Mißverständnis entgegenzutreten: sie bedeutet Unbildung, Fehlbildung, falsch zustande gekommene Bildung, Mißverhältnis zwischen Stoff und Kraft der Bildung), und sie zu beschreiben, ist beinahe eine unendliche Aufgabe. Sie reicht bis in die höchste Geistigkeit; denn ist die echte Dummheit eine stille Künstlerin, so die intelligente das, was an der Bewegtheit des Geisteslebens, vornehmlich aber an seiner Unbeständigkeit und Ergebnislosigkeit mitwirkt. Schon vor Jahren habe ich von ihr geschrieben: »Es gibt schlechterdings keinen bedeutenden Gedanken, den die Dummheit nicht anzuwenden verstünde, sie ist allseitig beweglich und kann alle Kleider der Wahrheit anziehen. Die Wahrheit dagegen hat jeweils nur ein Kleid und einen Weg und ist immer im Nachteil.« Die damit angesprochene Dummheit ist keine Geisteskrankheit, und doch ist sie die lebensgefährlichste, die dem Leben selbst gefährliche Krankheit des Geistes.
Wir sollten sie gewiß jeder schon in uns verfolgen, und nicht erst an ihren großen geschichtlichen Ausbrüchen erkennen. Aber woran sie erkennen? Und welches unverkennbare Brandmal ihr aufdrücken?! Die Psychiatrie benutzt heute als Hauptkennzeichen für die Fälle, die sie angehen, die Unfähigkeit, sich im Leben zurechtzufinden, das Versagen vor allen Aufgaben, die es stellt, oder auch plötzlich vor einer, wo es nicht zu erwarten wäre. Auch in der experimentellen Psychologie, die es vornehmlich mit dem Gesunden zu tun hat, wird die Dummheit ähnlich definiert. »Dumm nennen wir ein Verhalten, das eine Leistung, für die alle Bedingungen bis auf die persönlichen gegeben sind, nicht vollbringt«, schreibt ein bekannter Vertreter einer der neuesten Schulen dieser Wissenschaft. Dieses Kennzeichen der Fähigkeit sachlichen Verhaltens, der Tüchtigkeit also, läßt für die eindeutigen »Fälle« der Klinik oder der Affenversuchsstation nichts zu wünschen übrig, aber die frei herumlaufenden »Fälle« machen einige Zusätze nötig, weil das richtige oder falsche »Vollbringen der Leistung« bei ihnen nicht immer so einleuchtend ist. Erstens liegt doch in der Fähigkeit, sich allezeit so zu verhalten, wie es ein lebenstüchtiger Mensch unter gegebenen Umständen tut, schon die ganze höhere Zweideutigkeit der Klugheit und Dummheit, denn das »sachgemäße«, »sachkundige« Verhalten kann die Sache zum persönlichen Vorteil benutzen oder ihr dienen, und wer das eine tut, pflegt den, der das andre tut, für dumm zu halten. (Aber medizinisch dumm ist eigentlich nur, wer weder das eine noch das andere kann.) Und zweitens läßt sich auch nicht leugnen, daß ein unsachliches Verhalten, ja sogar ein unzweckmäßiges, oft notwendig sein kann, denn Objektivität und Unpersönlichkeit, Subjektivität und Unsachlichkeit haben Verwandtschaft miteinander, und so lächerlich die unbeschwerte Subjektivität ist, so lebens-, ja denkunmöglich ist natürlich ein völlig objektives Verhalten; beides auszugleichen, ist sogar eine der Hauptschwierigkeiten unserer Kultur. Und schließlich wäre auch noch einzuwenden, daß sich gelegentlich keiner so klug verhält, wie es nötig wäre, daß jeder von uns also, wenn schon nicht immer, so doch von Zeit zu Zeit dumm ist. Es ist darum auch zu unterscheiden zwischen Versagen und Unfähigkeit, gelegentlicher oder funktioneller und beständiger oder konstitutioneller Dummheit, zwischen Irrtum und Unverstand. Es gehört das zum wichtigsten, weil die Bedingungen des Lebens heute so sind, so unübersichtlich, so schwer, so verwirrt, daß aus den gelegentlichen Dummheiten der einzelnen leicht eine konstitutionelle der Allgemeinheit werden kann. Das führt die Beobachtung also schließlich auch aus dem Bereich persönlicher Eigenschaften hinaus zu der Vorstellung einer mit geistigen Fehlern behafteten Gesellschaft. Man kann zwar, was psychologisch-real im Individuum vor sich geht, nicht auf Sozietäten übertragen, also auch nicht Geisteskrankheiten und Dummheit, aber man dürfte heute wohl vielfach von einer »sozialen Imitation geistiger Defekte« sprechen können; die Beispiele dafür sind recht aufdringlich.
Mit diesen Zusätzen ist der Bereich der psychologischen Erklärung natürlich wieder überschritten worden. Sie selbst lehrt uns, daß ein kluges Denken bestimmte Eigenschaften hat, wie Klarheit, Genauigkeit, Reichtum, Löslichkeit trotz Festigkeit und viele andere, die sich aufzählen ließen; und daß diese Eigenschaften zum Teil angeboren sind, zum Teil neben den Kenntnissen, die man sich aneignet, auch als eine Art Denkgeschicklichkeit erworben werden; bedeuten doch ein guter Verstand und ein geschickter Kopf so ziemlich das gleiche. Hierbei ist nichts zu überwinden als Trägheit und Anlage, das läßt sich auch schulen, und das komische Wort »Denksport« drückt nicht einmal so übel aus, worauf es ankommt.
Die »intelligente« Dummheit hat dagegen nicht sowohl den Verstand als vielmehr den Geist zum Widerpart, und wenn man sich darunter nicht bloß ein Häuflein Gefühle vorstellen will, auch das Gemüt. Weil sich Gedanken und Gefühle gemeinsam bewegen, aber auch weil sich in ihnen der gleiche Mensch ausdrückt, lassen sich Begriffe wie Enge, Weite, Beweglichkeit, Schlichtheit, Treue auf das Denken wie auf das Fühlen anwenden; und mag der daraus entstehende Zusammenhang selbst noch nicht ganz klar sein, so genügt es doch, um sagen zu können, daß zum Gemüt auch Verstand gehört und daß unsere Gefühle nicht außer Verbindung mit Klugheit und Dummheit sind. Gegen diese Dummheit ist durch Vorbild und Kritik zu wirken.
Die damit vorgetragene Auffassung weicht von der üblichen Meinung ab, die durchaus nicht falsch, wohl aber äußerst einseitig ist und nach der ein tiefes, echtes Gemüt des Verstandes nicht brauchte, ja durch ihn bloß verunreinigt würde. Die Wahrheit ist, daß an schlichten Menschen gewisse wertvolle Eigenschaften, wie Treue, Beständigkeit, Reinheit des Fühlens und ähnliche ungemischt hervortreten, aber das doch eigentlich nur tun, weil der Wettbewerb der anderen schwach ist; und ein Grenzfall davon ist uns vorhin im Bilde des freundlich zusagenden Schwachsinns zu Gesicht gekommen. Nichts liegt mir ferner, als das gute, rechtschaffene Gemüt mit diesen Ausführungen erniedrigen zu wollen — sein Fehlen hat sogar geziemlichen Anteil an der höheren Dummheit! — aber noch wichtiger ist es heute, ihm den Begriff des Bedeutenden voranzusetzen, was ich freilich nur noch gänzlich utopischerweise erwähne.
Das Bedeutende vereint die Wahrheit, die wir an ihm wahrnehmen können, mit den Eigenschaften des Gefühls, die unser Vertrauen haben, zu etwas Neuem, zu einer Einsicht, aber auch zu einem Entschluß, zu einem erfrischten Beharren, zu irgend etwas, das geistigen und seelischen Gehalt hat und uns oder anderen ein Verhalten »zumutet«; so ließe sich sagen, und was im Zusammenhang mit der Dummheit das wichtigste ist, das Bedeutende ist an der Verstandes- wie an der Gefuhlsseite der Kritik zugänglich. Das Bedeutende ist auch der gemeinsame Gegensatz von Dummheit und Roheit, und das allgemeine Mißverhältnis, worin heute die Affekte die Vernunft zerdrücken, statt sie zu beflügeln, schmilzt im Begriff der Bedeutung zu. Genug von ihm, ja vielleicht schon mehr, als zu verantworten sein möchte! Denn sollte noch etwas hinzugefugt werden müssen, so könnte es nur das eine sein, daß mit allem Gesagten durchaus noch kein sicheres Erkennungs- und Unterscheidungszeichen des Bedeutenden gegeben ist und daß wohl auch nicht leicht ein ganz genügendes gegeben werden könnte. Gerade das führt uns aber auf das letzte und wichtigste Mittel gegen die Dummheit: auf die Bescheidung.
Gelegentlich sind wir alle dumm; wir müssen gelegentlich auch blind oder halbblind handeln, oder die Welt stünde still; und wollte einer aus den Gefahren der Dummheit die Regel ableiten: »Enthalte dich in allem des Urteils und des Entschlusses, wovon du nicht genug verstehst!«, wir erstarrten! Aber diese Lage, von der heute recht viel Aufhebens gemacht wird, ist ähnlich einer, die uns auf dem Gebiet des Verstandes längst vertraut ist. Denn weil unser Wissen und Können unvollendet ist, müssen wir in allen Wissenschaften im Grunde voreilig urteilen, aber wir bemühen uns und haben es erlernt, diesen Fehler in bekannten Grenzen zu halten und bei Gelegenheit zu verbessern, wodurch doch wieder Richtigkeit in unser Tun kommt. Nichts spricht eigentlich dagegen, dieses exakte und stolzdemütige Urteilen und Tun auch auf andere Gebiete zu übertragen; und ich glaube, der Vorsatz: Handle, so gut du kannst und so schlecht du mußt, und bleibe dir dabei der Fehlergrenzen deines Handelns bewußt! wäre schon der halbe Weg zu einer aussichtsvollen Lebensgestaltung.
Aber ich bin mit diesen Andeutungen schon eine Weile am Ende meiner Ausführungen, die, wie ich schützend vorgekehrt habe, nur eine Vorstudie bedeuten sollen. Und ich erkläre mich, den Fuß auf der Grenze, außerstande, weiter zu gehen; denn einen Schritt über den Punkt, wo wir halten, hinaus, und wir kämen aus dem Bereich der Dummheit, der selbst theoretisch noch abwechslungsreich ist, in das Reich der Weisheit, eine öde und im allgemeinen gemiedene Gegend. ■Aus Robert Musil, Über die Dummheit, Vortrag, Wien 1937, Alexander Verlag Berlin
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über die geistige Situation der Zeit
Karl Jaspers
.
Man hat die Gegenwart mit der Zeit des untergehenden Altertums verglichen, mit der der hellenischen Staaten, in denen das Griechentum versank, oder mit dem dritten nachchristlichen Jahrhundert, in dem die antike Kultur überhaupt zusammenbrach. Jedoch bestehen wesentliche Unterschiede. Damals handelte es sich nm eine Welt, die einen kleinen Raum der Erdoberfläche einnahm und die Zukunft des Menschen auch noch außer sich hatte. Heute, wo der Erdball ganz ergriffen ist, muß, was an Menschsein bleibt, in die Zivilisation eintreten, die das Abendland geschaffen hat. Damals ging die Bevölkerung zurück, heute ist sie in nie dagewesener Vervielfachung angewachsen. Damals war in der Zukunft auch die Bedrohung von außen, heute ist äußere Bedrohung für das Ganze partikular, und der Untergang kann nur von innen her erfolgen, wenn er das Ganze treffen sollte. Der handgreifliche Unterschied gegenüber dem dritten Jahrhundert aber ist, daß damals die Technik stagnierte und zu verfallen begann, während sie heute in unerhörtem Tempo ihre unaufhaltsamen Fortschritte macht. Chance wie Gefahr sind hier unabsehbar. Das äußerlich sichtbare Neue, das allem menschlichen Dasein von jetzt an seine Grundlagen und damit neue Bedingungen stellen muß, ist diese Entfaltung der technischen Welt. Zum erstenmal hat eine wirkliche Naturbeherrschung begonnen.
Wollte man sich unsere Welt verschüttet denken, so würden spätere Grabungen zwar keine Schönheiten zutage fördern wie die der Antike, deren Straßenpflaster noch uns entzückt. Aber es würde gegenüber allen früheren Zeiten schon aus den letzten Jahrzehnten so viel Eisen und Beton zu finden sein, daß man noch spät es sehen könnte: der Mensch hatte jetzt den Planeten in ein Netz seiner Apparatur eingesponnen. Dieser Schritt ist gegenüber allen früheren Zeiten so groß wie der erste Schritt zur Werkzeugbildung überhaupt: die Perspektive einer Verwandlung des Planeten in eine einzige Fabrik zur Ausnutzung seiner Stoffe und Energien wird sichtbar. Der Mensch hat das zweitemal die Natur durchbrochen und sie verlassen, um in ihr ein Werk hinzustellen, das sie als Natur nicht nur niemals geschaffen hätte, sondern das nun mit ihr wetteifert an Wirkungsmacht. Nicht schon in der Sichtbarkeit seiner Stoffe und Apparate ist dies Werk vor Augen, sondern erst in der Wirklichkeit ihrer Funktion; der Ausgräber könnte an den Resten von Funktürmen nicht mehr die durch sie hergestellte Allgegenwart der Ereignisse und Nachrichten auf der Erdoberfläche ermitteln.
Was das Neue sei, durch das unsere Jahrhunderte und durch dessen Vollendung unsere Gegenwart gegen das Vergangene sich absetzen, ist auch mit der Weise der Entgötterung der Welt und dem Prinzip der Technisierung keineswegs begriffen. Noch ohne klares Wissen wird immer entschiedener bewußt, in einem Augenblick der Weltwende zu stehen, die nicht an einer der partikularen geschichtlichen Epochen der vergangenen Jahrtausende gemessen werden kann. Wir leben in einer geistig unvergleichlich großartigen, weil an Möglichkeiten und Gefahren reichen Situation, doch müßte sie, würde ihr niemand genug tun können, zur armseligsten Zeit des versagenden Menschen werden.
Im Blick auf die vergangenen Jahrtausende scheint der Mensch vielleicht am Ende. Oder er ist als gegenwärtiges Bewußtsein am Anfang Wienur im Beginn seines Werdens, aber mit erworbenen Mitteln und der Möglichkeit einer realen Erinnerung auf einem neuen, schlechthin anderen Niveau.
Wurde bisher von Situation gesprochen, so in einer abstrakten Unbestimmtheit. Letzthin ist nur der einzelne in einer Situation. Von da übertragend denken wir die Situation von Gruppen, Staaten, der Menschheit, von Institutionen wie Kirche, Universität, Theater, von objektiven Gebilden wie Wissenschaft, Philosophie, Dichtung. Wie wir den Willen einzelner diese als ihre Sache ergreifen sehen, ist dieser Wille mit seiner Sache in einer Situation.
Situationen sind entweder ungewußt und werden wirksam, ohne daß der Betroffene weiß, wie es zugeht. Oder sie werden als gegenwärtige von einem seiner selbst bewußten Willen gesehen, der sie übernehmen, nutzen und wandeln kann. Die Situation als bewußt gemachte ruft auf zu einem Verhalten. Durch sie geschieht nicht automatisch ein Unausweichliches, sondern sie bedeutet Möglichkeiten und Grenzen der Möglichkeiten: was in ihr wird, hängt auch von dem ab, der in ihr steht, und davon, wie er sie erkennt. Das Erfassen der Situation ist von solcher Art, daß es sie schon ändert, sofern es Appell an Handeln und Sichverhalten möglich macht. Eine Situation zu erblicken ist der Beginn, ihrer Herr zu werden, sie ins Auge zu fassen, schon der Wille, der um ein Sein ringt. Wenn ich die geistige Situation der Zeit suche, so will ich ein Mensch sein; solange ich diesem Menschsein noch gegenüberstehe, denke ich über seine Zukunft und Verwirklichung nach; sobald ich aber selbst es bin, suche ich es denkend zu verwirklichen durch Erhellung der faktisch ergriffenen Situation in meinem Dasein.
Es fragt sich jeweils, welche Situation ich meine:
Das Sein des Menschen steht erstens als Dasein in ökonomischen, soziologischen, politischen Situationen, von deren Realität alles andere abhängt, wenn es auch durch sie allein nicht schon wirklich wird.
Das Dasein des Menschen als Bewußtsein steht zweitens in dem Raum dessen, was wißbar ist. Das geschichtlich erworbene, nun vorhandene Wissen in seinem Inhalt und in der Weise, wie gewußt und wie das Wissen methodisch geschieden und erweitert wird, ist Situation als die mögliche Klarheit des Menschen.
Was er selbst wird, ist drittens situationsbedingt durch die Menschen, die ihm begegnen, und durch die Glaubensmöglichkeiten, welche an ihn appellieren.
Wenn ich die geistige Situation suche, muß ich also beachten faktisches Dasein, mögliche Klarheit des Wissens, appellierendes Selbstsein in seinem Glauben, in denen allen der jeweils einzelne sich findet.Aus Karl Jaspers, Die geistige Situation der Zeit, De Gruyter Verlag 1931
Das Zitat der Woche
.
Über die Emanzipation von Musik und Dichtung
Günther Patzig
.
Es mag sein, daß Dichtung als gebundene Form der Rede ihren Ursprung in magischen Vorstellungen hatte, daß ohne ein Ritual eine Tradition poetischer Sprachgestaltung nicht hätte entstehen können: Das bedeutet nicht, daß Dichtung demgegenüber nicht ihr Eigenrecht und Eigengesetz haben und entwickeln könnte. Musik und Gesang mögen nach den verschiedenen Hypothesen ihren Ursprung in der rhythmischen Akzentuierung von Arbeitsvorgängen bei gemeinsamen Arbeiten des Stammes haben, oder sie mögen in biologischen Präformationen als Medium der sexuellen Annäherung, vergleichbar dem Balzverhalten anderer Gattungen von Lebewesen, begründet sein: Das ist zwar ein interessantes Faktum, wenn es eins ist, das nicht vergessen werden sollte, wenn man über Musik und Dichtung spricht; aber es kann nicht zur Definition dessen, was Musik ist und welchen Normen sie unterstellt ist, dienen.
Das Sachgebiet Dichtung und das Sachgebiet Musik haben sich von ihren gesellschaftlichen oder biologischen Entstehungsbedingungen längst emanzipiert. Auch die Wissenschaft, Natur- wie Geisteswissenschaften, muß sich in ihrer inneren Sachbestimmtheit von den »leitenden Interessen« distanzieren. Das wissenschaftliche Interesse ist verschieden vom gesellschaftlichen Interesse an der Wissenschaft, daher kann das gesellschaftliche Interesse weder zur Definition noch zum Kriterium der Objektivität der Wissenschaft herangezogen werden.
Wie ein Segelflugzeug auf die Motorwinde oder ein Schleppflugzeug angewiesen ist, um seinen Flug beginnen zu können, so ist die Wissenschaft auf gesellschaftliches Interesse angewiesen, um in Gang zu kommen. Hat sie aber erst einmal die Region erreicht, in der sie vom Aufwind des Wahrheitsstrebens erfaßt wird, so gehorcht sie, wie das Segelflugzeug, ihren eigenen Gesetzen.Aus Günther Patzig, Erklären und Verstehen, Bemerkungen zum Verhältnis von Natur- und Geisteswissenschaften, in Neue Rundschau 84/3 1973
Das Zitat der Woche
.
Über die Realität im Schauspiel
Georg Simmel
.
Wie zurückhaltend und kritisch man auch über die »allgemeine Meinung«, über die Vox populi denken möge – die dunklen Ahnungen, Instinkte, Wertungen der groβen Masse haben in der Regel einen Kern von Zutreffendem und Zuverläβigem, den freilich eine dicke Schale von Oberflächlichem und Verblendetem umgibt; aber er wird im Religiösen und im Politischen, im Intellektuellen und Ethischen doch immer wieder als eine fundamentale Richtigkeit fühlbar werden.
Nur auf einem Gebiet, das sogar zugänglicher als jene anderen erscheint, zeigt sich das Urteil der Allgemeinheit als sozusagen von allen Göttern verlassen, gerade im Fundamentalen schlechthin unzulänglich: auf dem Gebiete der Kunst. Hier trennt ein brückenloser Abgrund die Meinung der Majorität von aller Einsicht in das Wesentliche, und in ihm wohnt die tiefe soziale Tragik der Kunst.
Der Schauspielkunst gegenüber, die mehr als jede andere an das unmittelbare Publikum appelliert, scheint deshalb allenthalben in dem Maβe von dessen massenmässiger Demokratisierung der Wertmaβstab sich von dem eigentlich Künstlerischen weg zu der Unmittelbarkeit des Natureindrucks zu wenden. Und, eigentümlich hiermit zusammenhängend, scheint das Wesen dieser Kunst selbst ihren Naturalismus tiefer als jede andere Kunst zu begründen. Denn so ungefähr wird dieses Wesen populär verstanden: durch den Schauspieler wurde das Dichtwerk »real gemacht«.
Das Drama besteht als abgeschlossenes Kunstwerk. Hebt der Schauspieler dies nun in eine Kunst zweiter Potenz? Oder wenn dies sinnlos ist, führt er, als leibhaftig lebende Erscheinung, es nicht doch in die überzeugende Wirklichkeit zurück? Warum aber, wenn dies der Fall ist, fordern wir von seiner Leistung den Eindruck von Kunst und nicht den von bloβer realer Natur? In diesen Fragen treffen sich alle kunstphilosophischen Probleme der Schauspielkunst.Die Bühnenfigur, wie sie im Buche steht, ist sozusagen kein ganzer Mensch, sie ist nicht ein Mensch im sinnlichen Sinne – sondern der Komplex des literarisch Erfassbaren an einem Menschen. Weder die Mienen noch den Tonfall, weder das Ritardando noch das Accelerando des Sprechens, weder die Gesten noch das Maβ anschaulicher Lebendigkeit der Gestalt kann der Dichter zeichnen oder auch wirklich unzweideutige Prämissen dafür geben. Er hat vielmehr Schicksal, Erscheinung, Seele dieser Gestalt in den nur eindimensionalen Verlauf des bloβ Geistigen projiziert. Diesen nun überträgt der Schauspieler gleichsam in die Dreidimensionalität der Vollsinnlichkeit. Und hier liegt das erste Motiv jener naturalistischen Verbannung der Schauspielkunst in die Wirklichkeit. Es ist die Verwechslung der Versinnlichung eines geistigen Gehaltes mit seiner Verwirklichung.
Wirklichkeit ist eine metaphysische Kategorie, in Sinnesimpressionen gar nicht auflösbar: der Inhalt, den der Dichter zum dramatischen gestaltet hat, zeigt ganz verschiedene Bedeutung, wenn er von da aus in die Kategorie sinnlicher Gestaltung wie wenn er in die der Wirklichkeit überginge. Der Schauspieler versinnlicht das Drama, aber er verwirklicht es nicht, und deshalb kann sein Tun Kunst sein, was Wirklichkeit ihrem Begriffe nach eben nicht sein könnte. So erscheint Schauspielerei zunächst als die Kunst der Vollsinnlichkeit, wie Malerei die Kunst der Augensinnlichkeit, Musik die der Gehörssinnlichkeit ist.
Innerhalb des realen Daseins ist jedes einzelne Stück und Ereignis in endlos weiterwebende Reihen räumlicher, begreiflicher, dynamischer Art eingestellt. Darum ist jede einzelne bezeichenbare Wirklichkeit ein Fragment, keine ist eine in sich geschlossene Einheit. Zu einer solchen aber die Inhalte des Daseins zu gestalten, ist das Wesen der Kunst. Der Schauspieler hebt alle Sichtbarkeiten und Hörbarkeiten der Wirklichkeitserscheinung in eine gleichsam eingerahmte Einheit: durch die Gleichmäβigkeit des Stiles, durch die Logik in Rhythmus und Ablauf der Stimmungen, durch die fühlbar gemachte Beziehung jeder Äuβerung auf den beharrenden Charakter, durch das Abzielen aller Einzelheiten auf die Pointe des Ganzen. Er ist der Stilisierer aller sinnlichen Beeindruckbarkeiten als einer Einheit.
Von neuem aber scheint an diesem Punkt die Realität in den Kunstbezirk einzubrechen, um eine innere Lücke in ihm zufüllen. Woher weiβ der Schauspieler sein durch die Rolle notwendig gemachtes Verhalten, da, wie ich andeutete, es in der Rolle nicht steht und nicht stehen kann? Mir scheint: wie sich Hamlet zu benehmen hat, kann der Schauspieler unmöglich anderswoher wissen, als aus der Erfahrung, der äuβeren und vor allem der inneren, wie ein Mensch, der wie Hamlet spricht und Hamlets Schicksal erlebt, sich in Wirklichkeit zu verhalten pflegt. Der Schauspieler taucht also, von dem Dichtwerk nur geführt, in den Realitätsgrund hinab, aus dem auch Shakespeare es erhoben hat, und erschafft von ihm aus das schauspielerische Kunstwerk Hamlet.
Die Dichtung führt den Schauspieler auf reale Koordinationen von Innerem und Äuβerem hin, von Schicksal und Reaktion, von Ereignissen und dem Luftton um sie herum – Koordinationen, zu denen auch jene Führung ihn nie bringen könnte, wenn er sie oder ihre schlusskräftigen Analogien nicht empirisch, in der Kategorie der Realität, kennen gelernt hätte.
Und nun schlieβt der Naturalismus: da der Schauspieler ausser dem Hamlet Shakespeares nur die empirische Wirklichkeit hat, an der er sich für alles von Shakespeare nicht Gesagte orientieren kann, so muss er sich so benehmen wie ein realer Hamlet, der auf die von Shakespeare vorgezeichneten Worte und Ereignisse festgelegt ist, sich benehmen würde. Dies ist dennoch ganz irrig; über jene Wirklichkeit, zu der der Schauspieler gleichsam an der Hand des Dramas hinabsteigt, über das sozusagen passiv gewonnene Wissen, das den Stoff für die Gestalt Hamlets bietet, kommt nun die Aktivität der künstlerischen Formung, der Aufbau des künstlerischen Eindrucks. Er hält an der empirischen Wirklichkeit nicht still. Jene realen Koordinationen werden umgelagert, die Akzente abgetönt, die Zeitmaβe rhythmisiert, aus allen Möglichkeiten, die diese Wirklichkeit gibt, das einheitlich zu Stilisierende ausgewählt. Kurz, der Schauspieler macht auch um dieser Unentbehrlichkeit der Realität willen nicht das dramatische Kunstwerk zur Realität, sondern umgekehrt, die Wirklichkeit, die jenes ihm zugewiesen hat, zum schauspielerischen Kunstwerk.
Wenn heute viele sensible Menschen ihre Aversion gegen das Theater damit begründen, dass ihnen dort zuviel vorgelogen wird, so liegt das Recht dazu nicht in seinem Zuwenig, sondern in seinem Zuviel an Wirklichkeit. Denn der Schauspieler überzeugt uns nur, indem er innerhalb der künstlerischen Logik verbleibt, nicht aber durch Hineinnehmen von Wirklichkeitsmomenten, die einer ganz anderen Logik folgen.Aus Georg Simmel, Der Schauspieler und die Wirklichkeit, Berliner Tageblatt, 1912
Das Zitat der Woche
.
Über die Liebe unterm Kapitalismus
Erich Fromm
.
Wenn die Liebe eine Fähigkeit des reifen und schöpferischen Charakters ist, folgt daraus, daß die Fähigkeit des Liebens in jedem Menschen, der in einer bestimmten Gesellschaft lebt, von dem Einfluß abhängig ist, den diese Gesellschaft auf den Charakter des Betreffenden ausübt. Wenn wir von der Liebe in der zeitgenössischen westlichen Gesellschaft sprechen, wollen wir damit die Frage stellen, ob die gesellschaftliche Struktur der westlichen Zivilisation und der aus ihr resultierende Geist der Entwicklung der Liebe förderlich sind.
Diese Frage zu stellen bedeutet, sie im negativen Sinne zu beantworten. Kein objektiver Beobachter unseres westlichen Lebens kann daran zweifeln, daß die Liebe – die Nächstenliebe, die Mutterliebe und die erotische Liebe – ein verhältnismäßig seltenes Phänomen ist und daß verschiedene Formen von Pseudo-Liebe an ihre Stelle getreten sind, die in Wirklichkeit nur genauso viele Formen des Verfalls dieser Liebe sind.
Die kapitalistische Gesellschaft beruht auf dem Prinzip der politischen Freiheit einerseits und des Marktes als Regulator aller wirtschaftlichen und damit gesellschaftlichen Beziehungen andererseits. Der Gütermarkt bestimmt die Bedingungen, unter denen der Güteraustausch stattfindet; der Arbeitsmarkt reguliert den An- und Verkauf von Arbeitskraft. Sowohl nützliche Dinge wie nützliche menschliche Energie und Geschicklichkeit sind zu Werten geworden, die ohne Zwang und ohne Betrug entsprechend den Marktbedingungen ausgetauscht werden. Schuhe zum Beispiel – mögen sie auch noch so nützlich und notwendig sein – haben keinen wirtschaftlichen Wert (Tauschwert), wenn sie auf dem Markt nicht gefragt sind; menschliche Kraft und Geschicklichkeit sind ohne jeden Tauschwert, wenn sie gemäß den derzeitigen Marktbedingungen nicht gefragt sind. Der Kapitalbesitzer kann Arbeitskraft kaufen und ihr befehlen, für die gewinnbringende Investierung seines Kapitals zu arbeiten. Der Besitzer von Arbeitskraft muß seine Arbeitskraft entsprechend den jeweiligen Marktbedingungen verkaufen, wenn er nicht verhungern will. Diese wirtschaftliche Struktur spiegelt sich in einer Ordnung der Werte wider. Kapital beherrscht die Arbeitskraft; leblose Dinge haben einen höheren Wert als Arbeitskraft, menschliches Können und alles, was lebendig ist. Haben ist mehr als Sein.Diese Struktur war von Anfang an die Grundlage des Kapitalismus. Obgleich sie noch heute für den modernen Kapitalismus charakteristisch ist, haben sich doch verschiedene Faktoren inzwischen geändert, die dem zeitgenössischen Kapitalismus seine besonderen Eigenschaften geben und einen tiefgehenden Einfluß auf die charakterliche Struktur des modernen Menschen ausüben. Als Ergebnis der Entwicklung des Kapitalismus sehen wir einen zunehmenden Prozeß der Zentralisation und Konzentration des Kapitals. Die großen Unternehmen dehnen sich fortlaufend weiter aus, während die kleineren erdrückt werden. Das Eigentum am Kapital, das in den großen Unternehmen investiert ist, wird immer mehr von der Verwaltung dieses Kapitals getrennt. Hunderttausende von Aktienbesitzern sind »Eigentümer« des Unternehmens; eine Verwaltungsbürokratie, die zwar gutbezahlt ist, der das Unternehmen jedoch nicht gehört, verwaltet es. Diese Bürokratie ist nicht nur daran interessiert, große Gewinne zu erzielen, sondern ebenso sehr daran, das Unternehmen und damit ihre Macht ständig auszuweiten. Die zunehmende Konzentration des Kapitals und das Entstehen einer mächtigen Verwaltungsbürokratie finden ihre Parallele in der Entwicklung der Arbeiterbewegung. Durch die gewerkschaftliche Zusammenfassung der Arbeitskraft braucht der einzelne Arbeiter auf dem Arbeitsmarkt nicht allein und für sich selbst zu kämpfen; er ist in großen Gewerkschaften vereinigt, die ebenfalls von einer machtvollen Bürokratie geleitet werden und die ihn gegenüber den industriellen Kolossen vertritt. Sowohl auf dem Gebiet des Kapitals als auch auf dem der Arbeitskraft ist die Initiative vom Individuum auf die Bürokratie übergegangen. Eine wachsende Zahl von Menschen hat aufgehört, unabhängig zu sein, und ist von der Bürokratie der großen wirtschaftlichen Imperien abhängig geworden.
Ein weiterer entscheidender Zug, der von dieser Konzentration des Kapitals herrührt und für den modernen Kapitalismus bezeichnend ist, liegt in der besonderen Art der Arbeitsorganisation. Weitgehend zentralisierte Unternehmen mit radikaler Arbeitstrennung führen zu einer Organisation der Arbeit, bei der das Individuum seine Individualität verliert, in der es zu einem auswechselbaren Rad in der Maschine wird. Das menschliche Problem des modernen Kapitalismus kann man folgendermaßen formulieren:
Der moderne Kapitalismus braucht Menschen, die reibungslos und in großer Zahl zusammenarbeiten, die mehr und mehr konsumieren wollen, deren Geschmack jedoch standardisiert, leicht zu beeinflussen und vorauszusagen ist. Der moderne Kapitalismus braucht Menschen, die sich frei und unabhängig fühlen und glauben, keiner Autorität, keinem Prinzip und keinem Gewissen unterworfen zu sein – die aber dennoch bereit sind, Befehle auszuführen, das zu tun, was man von ihnen erwartet, sich reibungslos in die gesellschaftliche Maschine einfügen, sich ohne Gewalt leiten lassen, sich ohne Führer führen und ohne Ziel dirigieren lassen – mit der einen Ausnahme: nie untätig zu sein, zu funktionieren und weiterzustreben.
Was ist das Ergebnis? Der moderne Mensch ist sich selbst wie auch seinen Mitmenschen und der Natur entfremdet. Er ist zu einer Ware geworden, erlebt seine Lebenskraft als eine Kapitalanlage, die ihm unter den gegebenen Marktbedingungen ein Maximum an Gewinn einbringen muß. Die menschlichen Beziehungen sind im wesentlichen die entfremdeter Automaten, deren Sicherheit darauf beruht, möglichst dicht bei der Herde zu bleiben und sich im Denken, Fühlen oder Handeln nicht von ihr zu unterscheiden. Während jeder versucht, den anderen so nahe wie möglich zu sein, bleibt jeder doch völlig allein, durchdrungen von dem tiefen Gefühl von Unsicherheit, Angst und Schuld, das immer auftritt, wenn die menschliche Getrenntheit nicht überwunden wird. Unsere Zivilisation bietet jedoch verschiedene Möglichkeiten, damit die Menschen dieser Einsamkeit bewußt nicht gewahr werden: in erster Linie die strenge Routine der bürokratisierten, mechanischen Arbeit, die dazu verhilft, daß die Menschen ihr grundlegendstes menschliches Verlangen, die Sehnsucht nach Transzendenz und Einheit, nicht bewußt erleben. Da die Routine dazu allein nicht ausreicht, mildert der Mensch seine unbewußte Verzweiflung durch die Routine des Vergnügens, durch den passiven Konsum von Tönen und Bildern, die ihm die Vergnügungsindustrie anbietet, ferner aber auch durch die Befriedigung, immer neue Dinge zu kaufen und diese bald darauf durch andere auszuwechseln. Der moderne Mensch ähnelt tatsächlich jenem Bild, das Huxley in seinem Buch Schöne neue Welt beschreibt: gutgenährt, gutgekleidet, sexuell befriedigt, aber ohne Selbst, nur im oberflächlichsten Kontakt mit seinen Mitmenschen, geleitet allein von Slogans, die Huxley knapp folgendermaßen formuliert: »Verschiebe ein Vergnügen nie auf morgen, wenn du es heute haben kannst.« Oder die alles krönende Feststellung: »Jeder ist heutzutage glücklich!« Das Glück des Menschen besteht heute darin, sich zu vergnügen. Vergnügen liegt in der Befriedigung des Konsumierens und »Einverleibens«: von Waren, Bildern, Essen, Trinken, Zigaretten, Menschen, Zeitschriften, Büchern und Filmen. Alles wird konsumiert, wird geschluckt. Die Welt ist nur für unseren Hunger da, ein riesiger Apfel, eine riesige Flasche, eine riesige Brust; wir sind Säuglinge, die ewig Erwartungsvollen, die ewig Hoffnungsvollen -.und die ewig Enttäuschten. Unser Charakter ist darauf eingerichtet, auszutauschen, zu empfangen und zu verbrauchen. Alles – geistige wie auch materielle Dinge – wird zum Objekt des Tausches und Verbrauches.
Hinsichtlich der Liebe entspricht die Situation notwendigerweise diesem gesellschaftlichen Charakter des modernen Menschen. Automaten können nicht lieben; sie können nur ihr »Persönlichkeitspaket« austauschen und dann hoffen, ein gutes Geschäft dabei gemacht zu haben. Ein wesentlicher Ausdruck der Liebe, und besonders der Ehe in dieser entfremdeten Struktur, ist die Idee des »Teams«. In unzähligen Artikeln über die glückliche Ehe wird das Ideal als ein reibungslos funktionierendes Team beschrieben. Diese Beschreibung unterscheidet sich gar nicht so sehr von der Vorstellung, die man von einem reibungslos funktionierenden Angestellten hat; er soll »angemessen unabhängig«, ein guter Mitarbeiter, tolerant, gleichzeitig aber auch ehrgeizig und anspruchsvoll sein. Genauso soll der Ehemann – wie der Eheberater uns mitteilt – seine Frau »verstehen« und ihr eine Hilfe sein. Er soll sich günstig über ihr neues Kleid äußern, aber auch über das Essen. Sie dagegen soll ihn verstehen, wenn er müde und mürrisch nach Hause kommt, soll ihm aufmerksam zuhören, wenn er von seinen beruflichen Sorgen spricht, und soll nicht ärgerlich, sondern verständnisvoll sein, wenn er ihren Geburtstag vergißt. Das alles aber ist nichts anderes als das gut geölte Verhältnis zwischen zwei Menschen, die sich ihr Leben lang fremd bleiben, die nie ein »zentrales Verhältnis« erreichen, sondern sich gegenseitig mit Höflichkeit behandeln und alles tun, damit der andere sich wohl fühlt. In diesem Begriff von Liebe und Ehe liegt die Betonung darauf, Schutz vor einem sonst unerträglichen Gefühl von Einsamkeit zu finden. In der »Liebe« hat man endlich einen Hafen gefunden. Man schließt ein zweiseitiges Bündnis gegen die Welt, und dieser Egoismus zu zweit wird dann für Liebe und Vertrautheit gehalten.Aus Erich Fromm, Die Kunst des Liebens, Ullstein Verlag, Frankfurt/Main 1956
Das Zitat der Woche
.
Über das Spiel in der Kunst
Hans-Georg Gadamer
.
Was ist die anthropologische Basis unserer Erfahrung von Kunst? […] Insbesondere geht es um den Begriff Spiel. Die erste Evidenz, die wir uns da verschaffen müssen, ist, daß Spiel eine elementare Funktion des menschlichen Lebens ist, so daß menschliche Kultur ohne ein Spielelement überhaupt nicht denkbar ist. Daß menschliche Religionsübung im Kult ein Spielelement einschließt, ist seit langem von Denkern wie Huizinga, Guardini und anderen betont worden. Es ist lohnend, sich die elementare Gegebenheit des menschlichen Spielens in ihren Strukturen zu vergegenwärtigen, damit das Spielelement der Kunst nicht nur negativ, als Freiheit von Zweckbindungen, sondern als freier Impuls sichtbar wird. Wann reden wir von Spiel, und was ist darin impliziert? Sicherlich als erstes das Hin und Her einer Bewegung, die sich ständig wiederholt – man denke einfach an gewisse Redeweisen, wie etwa «das Spiel der Lichter» oder «das Spiel der Wellen», wo ein solches ständiges Kommen und Gehen, ein Hin und Her vorliegt, d. h. eine Bewegung, die nicht an ein Bewegungsziel gebunden ist. Das ist es offenbar, was das Hin und Her so auszeichnet, daß weder das eine noch das andere Ende das Ziel der Bewegung ist, in der sie zur Ruhe kommt. Es ist ferner klar, daß zu einer solchen Bewegung Spielraum gehört. Das wird uns für die Frage der Kunst besonders zu denken geben. Die Freiheit der Bewegung, die hier gemeint ist, schließt ferner ein, daß diese Bewegung die Form der Selbstbewegung haben muß. Selbstbewegung ist der Grundcharakter des Lebendigen überhaupt. Das hat schon Aristoteles, das Denken aller Griechen formulierend, beschrieben. Was lebendig ist, hat den Antrieb der Bewegung in sich selber, ist Selbstbewegung. Das Spiel erscheint nun als eine Selbstbewegung, die durch ihre Bewegung nicht Zwecke und Ziele anstrebt, sondern die Bewegung als Bewegung, die sozusagen ein Phänomen des Überschusses, der Selbstdarstellung des Lebendigseins, meint. Das ist es in der Tat, was wir in der Natur sehen – das Spiel der Mücken etwa oder all die bewegenden Schauspiele des Spiels, die wir in der Tierwelt, insbesondere bei Jungtieren, beobachten können. All das entstammt offenkundig dem elementaren Überschußcharakter, der in der Lebendigkeit als solcher nach Darstellung drängt. Nun ist es das Besondere des menschlichen Spieles, daß das Spiel auch die Vernunft, diese eigenste Auszeichnung des Menschen, sich Zwecke setzen und sie bewußt anstreben zu können, in sich einzubeziehen und die Auszeichnung der zwecksetzenden Vernunft zu überspielen vermag. Das nämlich ist die Menschlichkeit des menschlichen Spiels, daß es in dem Bewegungsspiel sich seine Spielbewegungen sozusagen selbst diszipliniert und ordert, als ob da Zwecke wären, z.B. wenn ein Kind zählt, wie oft der Ball auf den Boden schlagen kann, bevor er ihm entgleitet.
Hans-Georg Gadamer (1900-2002)
Was sich hier in Form des zweckfreien Tuns selber Regeln setzt, das ist Vernunft. Das Kind ist unglücklich, wenn der Ball schon beim zehnten Male wegrutscht, und stolz wie ein König, wenn es dreißigmal geht. Diese zweckfreie Vernünftigkeit im menschlichen Spielen bedeutet einen Zug im Phänomen, der uns weiterhelfen wird. Es zeigt sich nämlich hier, insbesondere am Phänomen der Wiederholung als solcher, daß Identität, Selbigkeit gemeint ist. Das Ziel, auf das es hier herauskommt, ist zwar ein zweckloses Verhalten, aber dieses Verhalten ist als solches selber gemeint. Es ist das, was das Spiel meint. Mit Anstrengung und Ehrgeiz und ernstester Hingabe wird in dieser Weise etwas gemeint. Dies ist ein erster Schritt auf dem Weg zur menschlichen Kommunikation; wenn hier etwas dargestellt wird – und sei es nur die Spielbewegung selber -, so gilt auch für den Zuschauer, daß er es «meint» – so wie ich mir selbst im Spielen wie ein Zuschauer gegenübertrete. Es ist die Funktion der Spieldarstellung, daß nicht irgend etwas Beliebiges, sondern die so und so bestimmte Spielbewegung am Ende steht. Spiel ist also letzten Endes Selbstdarstellung der Spielbewegung.
Ich darf sofort hinzufügen: Solche Bestimmung der Spielbewegung bedeutet zugleich, daß Spielen immer Mitspielen verlangt. Selbst der Zuschauer, der etwa einem Kind zuschaut, das da mit dem Ball hin und her spielt, kann gar nicht anders. Wenn er wirklich »mitgeht«, ist das nichts anderes als die participatio, die innere Teilnahme an dieser sich wiederholenden Bewegung. Bei höheren Formen des Spieles wird das oft sehr anschaulich: Man braucht sich nur einmal, im Fernsehen z.B., das Publikum bei einem Tennisturnier anzusehen! Es ist eine reine Halsverrenkung. Keiner kann es unterlassen, mitzuspielen. – Es scheint mir also ein weiteres wichtiges Moment, daß Spiel auch in dem Sinne ein kommunikatives Tun ist, daß es nicht eigentlich den Abstand kennt zwischen dem, der da spielt, und dem, der sich dem Spiel gegenübersieht. Der Zuschauer ist offenkundig mehr als nur ein bloßer Beobachter, der sieht, was vor sich geht, sondern ist als einer, der am Spiel «teilnimmt», ein Teil von ihm. Natürlich sind wir bei solchen einfachen Spielformen noch nicht bei dem Spiel der Kunst. Aber ich hoffe gezeigt zu haben, daß das kaum noch ein Schritt ist, was da vom kultischen Tanz zu der als Darstellung gemeinten Begehung des Kultes führt. Und daß es kaum ein Schritt ist, der von da zu der Freisetzung der Darstellung führt, etwa zum Theater, das aus diesem Kultzusammenhang als seine Darstellung herauswuchs. Oder zur bildenden Kunst, deren Schmuck- und Ausdrucksfunktion im Ganzen eines religiösen Lebenszusammenhanges erwächst. Das geht ineinander über. Aber daß es ineinander übergeht, bestätigt ein Gemeinsames in dem, was wir als Spiel erörterten, nämlich daß da etwas als etwas gemeint ist, auch wenn es nichts Begriffliches, Sinnvolles, Zweckhaftes ist, sondern etwa die reine selbstgesetzte Bewegungsvorschrift. Das scheint mir für die heutige Diskussion der modernen Kunst außerordentlich bedeutsam.Aus Hans-Georg Gadamer, Die Aktualität des Schönen, Reclam Verlag 1977
Das Zitat der Woche
.
Über die Disziplinierung der Vernunft
Alfred N. Whitehead
.
In der menschlichen Geschichte verkörpern sich die Techniken der Praxis in etablierten Institutionen – Berufsverbänden, wissenschaftlichen Vereinigungen, Wirtschaftsunternehmen, Universitäten, Kirchen und Regierungen. Infolgedessen bildet die Untersuchung der Ideen, die der Gesellschaftsstruktur zugrunde liegen, einen Appell an die oberste Autorität – den Appell des Stoikers an die <Stimme der Natur>. Aber selbst diese oberste Autorität kann nicht endgültig sein, und zwar aus zwei Gründen. Erstens ist das, was sie uns zu erkennen gibt, verwirrt, mehrdeutig und in sich widersprüchlich. Und zweitens wäre, wenn sie in irgendeiner Epoche der menschlichen Geschichte als endgültig akzeptiert worden wäre, jeder Fortschritt zum Stillstand gekommen. Die abstoßenden Praktiken der Vergangenheit – brutish and nasty, «bestialisch und widerwärtig», wie sie Hobbes genannt hat – hätten uns bis in alle Zukunft beherrscht. Aber selbst die Gegenwart können wir nicht als endgültigen Maßstab akzeptieren. Wir können heute leben, und sogar gut leben. Aber wir spüren immer noch das aufwärtsgerichtete Streben, wir suchen nach wie vor nach dem besseren Leben.
Was wir finden müssen, ist eine angemessene Disziplin der spekulativen Vernunft. Es gehört zum Wesen dieser Spekulation, daß sie über die unmittelbar gegebenen Tatsachen hinausgeht. Ihre Aufgabe ist, das Denken schöpferisch in die Zukunft wirken zu lassen; und sie erfüllt diese Aufgabe durch das Erschauen von Ideensystemen, die das Beobachtete umfassen, aber über seine Grenzen hinaus verallgemeinert sind. Und sie braucht Disziplin, weil die Geschichte der Spekulation nicht viel anders verlaufen ist als die Geschichte der Praxis. Wenn wir die vergangenen Spekulationen der Menschheit überblicken, erscheinen auch sie töricht, bestialisch und widerwärtig. Der richtige Gebrauch der Geschichte besteht darin, allgemeine Prinzipien zur Disziplinierung der Praxis und der Spekulation aus ihr zu extrahieren. Das Ziel dieser Disziplin ist nicht Stabilität, sondern Fortschritt.
Aus Alfred N. Whitehead, Die Funktion der Vernunft, Reclam Verlag 1974
Das Zitat der Woche
.
Vom Wesen des Menschen im Wesen Gottes
Ludwig Feuerbach
.
Der Theist stellt sich Gott als ein außer der Vernunft, außer dem Menschen überhaupt existierendes, persönliches Wesen vor – er denkt als Subjekt über Gott als Objekt. Er denkt Gott als ein dem Wesen, d.h. seiner Vorstellung nach geistiges, unsinnliches, aber der Existenz, d.h. der Wahrheit nach sinnliches Wesen; denn das wesentliche Merkmal einer objektiven Existenz, einer Existenz außer dem Gedanken oder der Vorstellung ist die Sinnlichkeit. Er unterscheidet Gott von sich in demselben Sinne, in welchem er die sinnlichen Dinge und Wesen als außer ihm existierende von sich unterscheidet; kurz, er denkt Gott vom Standpunkt der Sinnlichkeit aus. Der spekulative Theologe oder Philosoph dagegen denkt Gott vom Standpunkt des Denkens aus; er hat daher nicht zwischen sich und Gott in der Mitte die störende Vorstellung eines sinnlichen Wesens; er identifiziert somit ohne Hindernis das objektive, gedachte Wesen mit dem subjektiven, denkenden Wesen.
Die innere Notwendigkeit, daß Gott aus einem Objekt des Menschen zum Subjekt, zum denkenden Ich des Menschen wird, ergibt sich aus dem bereits Entwickelten näher so: Gott ist Gegenstand des Menschen, und nur des Menschen, nicht des Tieres. Was aber ein Wesen ist, das wird nur aus seinem Gegenstand erkannt; der Gegenstand, auf den sich ein Wesen notwendig bezieht, ist nichts anderes als sein offenbares Wesen. So ist der Gegenstand der pflanzenfressenden Tiere die Pflanze; aber durch diesen Gegenstand unterscheiden sich wesentlich dieselben von den anderen, den fleischfressenden Tieren. So ist der Gegenstand des Auges das Licht, nicht der Ton, nicht der Geruch. Im Gegenstand des Auges ist uns aber sein Wesen offenbar. Ob einer nicht sieht oder kein Auge hat, ist darum einerlei. Wir benennen daher auch im Leben die Dinge und Wesen nur nach ihren Gegenständen. Das Auge ist das »Lichtorgan«. Wer den Boden bebaut, ist ein Bauer; wer die Jagd zum Objekt seiner Tätigkeit hat, ist ein Jäger; wer Fische fängt, ein Fis her usw. Wenn also Gott – und zwar, wie er es ja ist, notwendig und wesentlich – ein Gegenstand des Menschen ist, so ist in dem Wesen dieses Gegenstandes nur das eigene Wesen des Menschen ausgesprochen. Stelle Dir vor, ein denkendes Wesen auf einem Planeten oder gar Kometen bekäme zu Gesicht die paar Paragraphen einer christlichen Dogmatik, welche von dem Wesen Gottes handeln. Was würde dieses Wesen aus diesen Paragraphen folgern? Etwa die Existenz eines Gottes im Sinne einer christlichen Dogmatik? Nein! Es würde nur daraus folgern, daß auch auf der Erde denkende Wesen sind; es würde in den Definitionen der Erdbewohner von ihrem Gott nur Definitionen von ihrem eigenen Wesen, z.B. in der Definition: Gott ist ein Geist, nur den Beweis und Ausdruck ihres eigenen Geistes finden; kurz, es würde aus dem Wesen und den Eigenschaften des Objektes auf das Wesen und die Eigenschaften des Subjektes schließen. Und mit vollem Recht; denn die Unterscheidung zwischen dem, was der Gegenstand an sich selbst, und dem, was er für den Menschen ist, fällt bei diesem Objekt weg. Diese Unterscheidung ist nur an ihrem Platz bei einem unmittelbar sinnlich, und eben deswegen auch noch anderen Wesen außer dem Menschen gegebenen Gegenstand. Das Licht ist nicht nur für den Menschen da, es affiziert auch die Tiere, auch die Pflanzen, auch die unorganischen Stoffe: es ist ein allgemeines Wesen. Um zu erfahren, was das Licht ist, betrachten wir darum nicht nur die Eindrücke und Wirkungen desselben auf uns, sondern auch auf andere, von uns unterschiedene Wesen. Notwendig, objektiv begründet ist daher hier die Unterscheidung zwischen dem Gegenstand an sich selbst und dem Gegenstand für uns, namentlich zwischen dem Gegenstand in der Wirklichkeit und dem Gegenstand in unserem Denken und Vorstellen. Gott aber ist nur ein Gegenstand des Menschen. Die Tiere und Sterne preisen Gott nur im Sinne des Menschen. Es gehört also zum Wesen Gottes selbst, daß er keinem anderen Wesen außer dem Menschen Gegenstand, daß er ein spezifisch menschlicher Gegenstand, ein Geheimnis des Menschen ist. Wenn aber Gott nur ein Gegenstand des Menschen ist, was offenbart sich uns im Wesen Gottes?
Aus Ludwig Feuerbach, Grundsätze der Philosophie der Zukunft, Zürich 1843
Das Zitat der Woche
.
Vom Essentiellen
Karl. R. Popper
.
Obwohl ich nicht glaube, daß wir jemals durch unsere allgemeinen Gesetze ein letztes Wesen der Welt beschreiben können, so bezweifle ich doch nicht, daß wir danach streben, immer tiefer in die Welt oder, wie wir sagen können, in immer wesentlichere Eigenschaften der Welt einzudringen.
Jedesmal, wenn wir dazu fortschreiten, irgendein vermutetes Gesetz oder eine Theorie durch eine neue vermutete Theorie von höherem Grad der Universalität zu erklären, entdecken wir Neues über die Welt, indem wir versuchen, tiefer in ihre Geheimnisse einzudringen. Und jedesmal, wenn es uns gelingt, eine Theorie dieser Art zu falsifizieren, machen wir eine neue wichtige Entdeckung. Denn diese Falsifizierungen sind höchst wichtig. Sie lehren uns das Unerwartete; und sie lehren uns wieder, daß unsere Theorien, obwohl sie von uns selbst aufgestellt wurden, obwohl sie unsere eigene Erfindung sind, dennoch echte Aussagen über die Welt sind; denn sie können mit etwas zusammenstoßen, sie können an etwas scheitern, das wir nicht selbst erfunden haben.Unser «modifizierter Essentialismus» ist, wie ich glaube, nützlich, wenn wir die Frage nach der logischen Form der Naturgesetze erheben. Er deutet an, daß unsere Gesetze, oder unsere Theorien, universell sein müssen, das heißt, daß sie Aussagen über die Welt machen müssen – über alle räumlich-zeitlichen Gebiete der Welt. Er deutet darüber hinaus an, daß unsere Theorien Aussagen über strukturelle oder relationale Eigenschaften der Welt machen und daß die durch eine erklärende Theorie beschriebenen strukturellen Eigenschaften, in irgendeinem Sinn, tiefer sind als diejenigen, die erklärt werden sollen. Ich glaube, daß das Wort «tiefer» dem Versuch einer erschöpfenden logischen Analyse Widerstand leistet; es ist jedoch ein Führer zu unseren Intuitionen. (Das ist so in der Mathematik: Alle ihre Lehrsätze sind logisch äquivalent, da sie in der Gegenwart der Axiome voneinander ableitbar sind, und doch besteht ein großer Unterschied in ihrer »Tiefe«, der sich kaum logisch analysieren läßt.) Die «Tiefe» einer erfahrungswissenschaftlichen Theorie scheint in sehr enger Beziehung zu ihrer Einfachheit und damit zu ihrem Gehalt zu stehen. (Dies unterscheidet sich völlig von der Tiefe eines mathematischen Lehrsatzes, dessen Gehalt immer gleich Null ist.) Zwei Bestandteile scheinen erforderlich zu sein: ein reicher Gehalt und eine gewisse intuitive Einheitlichkeit oder Geschlossenheit (oder ein «organischer Charakter») des beschriebenen Sachverhalts. Es ist gerade dieser letzte Bestandteil, der so schwer zu analysieren ist und den die Essentialisten zu beschreiben versuchen, wenn sie von wesentlichen Eigenschaften sprechen, im Gegensatz zu einer bloßen Anhäufung von zufälligen Eigenschaften.
Ich glaube nicht, daß wir viel mehr tun können, als hier auf eine intuitive Idee zu verweisen. Und ich glaube nicht, daß wir viel mehr tun müssen. Denn im Falle irgendeiner vorgeschlagenen besonderen Theorie ist es ihr Gehalt, das heißt ihre Prüfbarkeit, die über das Interesse an ihr entscheidet, so wie es der Ausfall der tatsächlichen Prüfungen ist, der über ihr Schicksal entscheidet. Vom methodologischen Gesichtspunkt aus sind ihre Tiefe, ihr Zusammenhang und ihre Schönheit nichts als Hinweise und Anregungen für unsere Intuition und unser Vorstellungsvermögen.Aus Karl R. Popper, Theorie und Realität, in: H. Albert (Hrsg.), Ausgewählte Aufsätze zur Wissenschaftslehre der Sozialwissenschaften, J.C.B. Mohr/Siebeck 1972
Das Zitat der Woche
.
Vom Hassen und Lieben
Sigmund Freud
.
Sie verwundern sich darüber, dass es so leicht ist, die Menschen für den Krieg zu begeistern, und vermuten, dass etwas in ihnen wirksam ist, ein Trieb zum Hassen und Vernichten, der solcher Verhetzung entgegenkommt. Wiederum kann ich Ihnen nur uneingeschränkt beistimmen. Wir glauben an die Existenz eines solchen Triebes und haben uns gerade in den letzten Jahren bemüht, seine Äußerungen zu studieren. Darf ich Ihnen aus diesem Anlass ein Stück der Trieblehre vortragen, zu der wir in der Psychoanalyse nach vielem Tasten und Schwanken gekommen sind?
Wir nehmen an, dass die Triebe des Menschen nur von zweierlei Art sind, entweder solche, die erhalten und vereinigen wollen – wir heißen sie erotische, ganz im Sinne des Eros im Symposion Platos, oder sexuelle mit bewusster Überdehnung des populären Begriffs von Sexualität – und andere, die zerstören und töten wollen; wir fassen diese als Aggressionstrieb oder Destruktionstrieb zusammen. Sie sehen, das ist eigentlich nur die theoretische Verklärung des weltbekannten Gegensatzes von Lieben und Hassen, der vielleicht zu der Polarität von Anziehung und Abstoßung eine Urbeziehung unterhält, die auf Ihrem Gebiet eine Rolle spielt. Nun lassen Sie uns nicht zu rasch mit den Wertungen von Gut und Böse einsetzen. Der eine dieser Triebe ist ebenso unerlässlich wie der andere, aus dem Zusammen- und Gegeneinanderwirken der Beiden gehen die Erscheinungen des Lebens hervor. Nun scheint es, dass kaum jemals ein Trieb der einen Art sich isoliert betätigen kann, er ist immer mit einem gewissen Betrag von der anderen Seite verbunden, wie wir sagen: legiert, der sein Ziel modifiziert oder ihm unter Umständen dessen Erreichung erst möglich macht. So ist z.B. der Selbsterhaltungstrieb gewiss erotischer Natur, aber grade er bedarf der Verfügung über die Aggression, wenn er seine Absicht durchsetzen soll. Ebenso benötigt der auf Objekte gerichtete Liebestrieb eines Zusatzes vom Bemächtigungstrieb, wenn er seines Objekts überhaupt habhaft werden soll. Die Schwierigkeit, die beiden Triebarten in ihren Äußerungen zu isolieren, hat uns ja so lange in ihrer Erkenntnis behindert.Wenn Sie mit mir ein Stück weitergehen wollen, so hören Sie, dass die menschlichen Handlungen noch eine Komplikation von anderer Art erkennen lassen. Ganz selten ist die Handlung das Werk einer einzigen Triebregung, die an und für sich bereits aus Eros und Destruktion zusammengesetzt sein muss. In der Regel müssen mehrere in der gleichen Weise aufgebaute Motive zusammentreffen, um die Handlung zu ermöglichen. […] Wenn also die Menschen zum Krieg aufgefordert werden, so mögen eine ganze Anzahl von Motiven in ihnen zustimmend antworten, edle und gemeine, solche, von denen man laut spricht, und andere, die man beschweigt. Wir haben keinen Anlass, sie alle bloßzulegen. Die Lust an der Aggression und Destruktion ist gewiss darunter; ungezählte Grausamkeiten der Geschichte und des Alltags bekräftigen ihre Existenz und ihre Stärke. Die Verquickung dieser destruktiven Strebungen mit anderen erotischen und ideellen erleichtert natürlich deren Befriedigung. Manchmal haben wir, wenn wir von den Gräueltaten der Geschichte hören, den Eindruck, die ideellen Motive hätten den destruktiven Gelüsten nur als Vorwände gedient, andere Male z.B. bei den Grausamkeiten der Inquisition, meinen wir, die ideellen Motive hätten sich im Bewusstsein vorgedrängt, die destruktiven ihnen eine unbewusste Verstärkung gebracht. Beides ist möglich.
Ich habe Bedenken, Ihr Interesse zu missbrauchen, das ja der Kriegsverhütung gilt, nicht unseren Theorien. Doch möchte ich noch einen Augenblick bei unserem Destruktionstrieb verweilen, dessen Beliebtheit keineswegs Schritt hält mit seiner Bedeutung. Mit etwas Aufwand von Spekulation sind wir nämlich zu der Auffassung gelangt, dass dieser Trieb innerhalb jedes lebenden Wesens arbeitet und dann das Bestreben hat, es zum Zerfall zu bringen, das Leben zum Zustand der unbelebten Materie zurückzuführen. Er verdiente in allem Ernst den Namen eines Todestriebes, während die erotischen Triebe die Bestrebungen zum Leben repräsentieren. Der Todestrieb wird zum Destruktionstrieb, indem er mit Hilfe besonderer Organe nach außen, gegen die Objekte, gewendet wird. Das Lebewesen bewahrt sozusagen sein eigenes Leben dadurch, dass es fremdes zerstört. Ein Anteil des Todestriebes verbleibt aber im Innern des Lebewesens tätig und wir haben versucht, eine ganze Anzahl von normalen und pathologischen Phänomenen von dieser Verinnerlichung des Destruktionstriebes abzuleiten. Wir haben sogar die Ketzerei begangen, die Entstehung unseres Gewissens durch eine solche Wendung der Aggression nach innen zu erklären. Sie merken, es ist gar nicht so unbedenklich, wenn sich dieser Vorgang in allzu großem Ausmaß vollzieht, es ist direkt ungesund, während die Wendung dieser Triebkräfte zur Destruktion in der Außenwelt das Lebewesen entlastet, wohltuend wirken muss. Das diene zur biologischen Entschuldigung all der hässlichen und gefährlichen Strebungen, gegen die wir ankämpfen. Man muss zugeben, sie sind der Natur näher als unser Widerstand dagegen, für den wir auch noch eine Erklärung finden müssen. Vielleicht haben Sie den Eindruck, unsere Theorien seien eine Art von Mythologie, nicht einmal eine erfreuliche in diesem Fall. Aber läuft nicht jede Naturwissenschaft auf eine solche Art von Mythologie hinaus?Sigmund Freud an Albert Einstein, Wien 1932, in: Warum Krieg?, Briefwechsel Einstein-Freud, Diogenes Verlag 1972
Das Zitat der Woche
.
Über das Lächeln
Helmuth Plessner
.
Lächeln ist Mimik des Geistes. Wir können auch sagen: Mimik der menschlichen Position. Wie aber steht es dann mit Lachen und Weinen? Steht das Urteil nicht in Widerspruch zu unserer eigenen These, daß Lachen und Weinen Monopole des Menschen sind, Ausdrucksweisen seiner exzentrischen Position? Zunächst sind beide überhaupt keine mimischen Gebärden, sondern Katastrophenreaktionen an Grenzen menschlichen Verhaltens. Als Ausbrüche ziehen sie auch die Mimik in Mitleidenschaft, jedoch durch Verlust unserer Selbstbeherrschung und damit auch unserer Herrschaft über den eigenen Körper. Dieser Verlust trifft den Menschen in Situationen, auf die er keine Antwort weiß, da sie durch ihre Mehrdeutigkeit oder Unvermitteltheit zugleich an sein Verständnis appellieren und ihn der Mittel berauben, ihrer Herr zu werden. Ein Wesen ohne Verständnis, ein ungeistiges Wesen könnte demnach seiner Inkongruenz mit der Situation nicht gewahr werden. Nur ein geistiges Wesen vermag auf solches Mißverhältnis entsprechend, d.h. in diesem Falle mit einem Bruch zwischen sich und seinem Leib zu reagieren.
Lachen und Weinen sind unbeherrschte und gebrochene Antworten auf Situationen, welche beherrschte, auf geordnetem Verhältnis der Person zu ihrem Leib beruhende und solches Verhältnis wahrende Antworten unmöglich machen, doch die Person zugleich zur Antwort zwingen. Wenn die Formel erlaubt ist: sinnvolle Fehlreaktionen mit Hilfe eines Bruchs zwischen Mensch und Körper. Die Distanziertheit der menschlichen Person wird als Bruch im Verlust ihrer Selbstbeherrschung sichtbar. Ein physischer Automatismus tritt an die Stelle artikulierter, von der Person selbst ausgehender Antworten. Ein Wesen ohne Distanz, ohne Exzentrum kann nicht objektivieren, nicht begreifen, kennt weder Sinn noch Unsinn und vermag darum weder zu lachen noch zu weinen. Es vermag, da es nicht »über sich« steht, auch nicht, »unter sich« zu fallen. Nur wer Selbstbeherrschung besitzt, kann sie verlieren.In ihrem Verlust wird die Distanziertheit, die Geistigkeit manifest. Ihr explosiver und desaströser Ausdruck reißt auch die Mimik mit sich, läßt aber der Person gerade keine Freiheit zu ausdrückender Gebärde mehr. Sie ist das katastrophale Ende aller Mimik, wiewohl darin ein Zeugnis menschlicher Distanz und ein Monopol des Menschen. Im Lächeln dagegen bewahrt er seine Distanz zu sich und zur Welt und vermag sie, mit ihr spielend, zu zeigen. Lachend und weinend ist der Mensch das Opfer seines Geistes, lächelnd gibt er ihm Ausdruck.
In seiner lehrreichen Auseinandersetzung mit den Auffassungen Duchennes, Spencers und Dumas’ vom Mechanismus des Lächelns kommt Buytendijk, wiewohl am üblichen Gedanken festhaltend, Lächeln sei Einleitung des Lachens, Ausdruck der Freude, zu dem trefflichen Satz, seine Paradoxie bestünde in der Spannung einer Muskelgruppe, welche Spannung als Entspannung einer aktiven Ruhehaltung erlebt werde. Diese bilde zugleich die Vorbedingung für die Entwicklung einer ausdrucksfähigen Innerlichkeit, somit für die Erscheinung des Lächelns als echter Ausdrucksbewegung. Hiermit ist phvsiologisch fixiert, was wir Abstand im Ausdruck zum Ausdruck nannten. Sicher trifft auch seine Zeichnung der Genese etwas Richtiges, die er als Entwicklung aus einer puren Reaktion auf ein passiv erlebtes ambivalentes Lustgefühl, den Kitzel, zu einem aktiven Lächeln, einem Suchen nach expansivem Gefühl – wir sprechen von Lockerung – sieht. Das Lächeln wird dann Ausdruck einer Vorwegnahme und zugleich Reaktion auf eine sinnlich bestimmte Empfindung, die sensorische Verlegenheit. Freilich scheint mir die Entfaltung des ausdrücklicken Lächelns hier zu stark an ein sinnliches Anfangsstadium gebunden und seiner Emanzipationsfähigkeit zu wenig Rechnung getragen. Selbst wenn das erste Lächeln des Kleinkindes Reaktion auf kitzelnde Reize wäre, brauchte seine weitere Ausbildung zum Ausdruck der Lockerung nicht an Verlegenheit und strukturell verwandte »Freuden« gebunden oder darauf bezogen zu sein. Hier macht sich auch für die Entwicklungspsychologie des Phänomens die einseitige Auffassung als Einleitung des Lachens und als Ausdruck der Freude störend bemerkbar. Wie für die Genese des Lachens und Weinens hat auch für dir Genese des Lächelns der methodische Grundsatz zu gelten, daß man erst den vollentwickelten Ausdruck in seinem vollen Sinn verstanden haben muß, will man seine Keimformen richtig taxieren.
Nur dann wird die Gefahr der Überbestimmung ebenso wie der Unterbestimmung eines Ausdrucksphänomens vermieden. Das Diffuse in den kindlichen Reaktionen kann erst zum Ansatz eines Studiums gemacht werden, wenn ihre entwickelten Endstadien bekannt sind, so aufschlußreich auch der erinnernde Rückblick auf ihre Keimformen bleibt. Die Formel: Lächeln ist Ausdruck des Geistes, scheint das Phänomen viel zu hoch und einseitig im Hinblick auf gewisse Formen des Lächelns beim Erwachsenen zu nehmen, für die einfachen Freuden des sinnlichen Wohlseins und Behagens und für die entsprechenden Gebärden des Kleinkindes dagegen verfehlt. Nimmt man sie freilich in verengter Bedeutung, als Gebärdensprache und Sinnbezüge andeutendes Gebaren, dann fällt das sinnlich-reaktive und vitale Lächeln aus dem Bereich der Formel. Jedoch auch das »nicht mehr« andeutende und zu verstehen gebende Lächeln des Friedens, des Erlöstseins und der Entrückung, das sich bisweilen auf dem Antlitz der Toten malt, gehört dann nicht mehr dazu.
Wird Lächeln Ausdruck, dann drückt es in jeder Form die Menschlichkeit des Menschen aus. Nicht nur so wie jede Expression bei ihm, auch die ungehemmteste der starken Affekte, noch etwas Menschliches durchscheinen läßt, nicht wie Lachen und Weinen, die als Monopole m spezifischen Formen eines Verlusts seiner Selbstbeherrschung zum Vorschein kommen, sondern in aktiver Ruhehaltung und beherrschtem Abstand. Noch in den Modifikationen der Verlegenheit, Scham, Trauer, Bitterkeit, Verzweiflung kündet Lächeln ein Darüberstehen. Das Menschliche des Menschen zeigt sich nicht zufällig in leisen und gehaltenen Gebärden, sein Adel in Lockerung und Spiel; wie eine Ahnung im Anfang, wie ein Siegel im Ende. Überall, wo es aufscheint, verschönt sein zartes Leuchten, als trage es einer Göttin Kuß auf seiner Stirn.Aus Helmuth Plessner, Das Lächeln, in: Philosophische Anthropologie, S.Fischer Verlag 1970
Das Zitat der Woche
.
Von der Wahrheit auf Kredit
William James
.
Daß es für das menschliche Leben von Wichtigkeit ist, daß wir über Tatsachen wahre Urteile zur Verfügung haben, ist eine bekannte Sache. Wir leben in einer Welt von Wirklichkeiten, die uns unendlich nützlich und auch unendlich schädlich sein können. Gedanken, die uns sagen, was wir zu erwarten haben, gelten auf dieser primären Stufe als die wahren Gedanken, und das Streben nach dem Besitz solcher Gedanken ist eine der ersten menschlichen Pflichten. Der Besitz der Wahrheit ist hier keineswegs Selbstzweck, sondern ein Mittel zur Befriedigung irgendeines Lebensbedürfnisses. Wenn ich mich im Walde verirrt habe und halb verhungert bin, und ich finde etwas, das wie ein Kuhweg aussieht, so ist es von der größten Wichtigkeit, daß ich mir am Ende des Weges ein Haus vorstelle; denn wenn ich das tue und dem Weg folge, so rette ich mich dadurch. Der wahre Gedanke ist hier nützlich, weil sein Gegenstand, das Haus, nützlich ist. Der praktische Wert nützlicher Vorstellungen läßt sich somit ursprünglich von der Wichtigkeit ableiten, die die Gegenstände der Vorstellungen für uns haben. Diese Gegenstände sind nun nicht zu allen Zeiten von Wichtigkeit. Für das Haus in dem oben angenommenen Fall habe ich vielleicht ein andermal keine Verwendung, und dann ist meine Vorstellung davon, obwohl verifizierbar, doch praktisch ohne Belang und würde besser unbewußt bleiben. Da jedoch fast jeder Gegenstand eines Tages bedeutungsvoll werden kann, so ist es offenbar von Vorteil, einen allgemeinen Vorrat von Wahrheiten zu besitzen, d.h. von Vorstellungen, die für bloß mögliche Situationen sich als wahr erweisen können. Wir speichern solche Wahrheiten in unserem Gedächtnis auf, und mit dem Überfluß derselben füllen wir unsere Nachschlagebücher. Wenn eine solche Wahrheit für eines unserer Erlebnisse bedeutsam wird, dann wird sie aus dem kalt gestellten Vorrat heraufgeholt, um in der Welt ihre Arbeit zu leisten, und dann wird unser Glaube an sie aktuell. Man kann dann sagen: «sie ist nützlich, weil sie wahr ist», oder «sie ist wahr, weil sie nützlich ist». Beide Sätze bedeuten dasselbe, nämlich, daß hier ein Gedanke da ist, der verwirklicht und verifiziert werden kann. «Wahr» ist der Name für jede Vorstellung, die den Verifikationsprozeß auslöst und «Nützlich» der Name für die in der Erfahrung sich bewährende Wirkung. Wahre Vorstellungen hätten sich nie von den andern abheben, hätten nie mit einem allgemeinen gleichen Namen bezeichnet werden können und ganz gewiß nicht mit einem Namen, der an etwas Wertvolles erinnert, wenn sie nicht von Anfang an in dieser Art nützlich gewesen wären.
Aus dieser einfachen Überlegung gewinnt der Pragmatismus seinen Begriff der Wahrheit. Diese ist im wesentlichen nichts anderes als der Weg, auf dem wir von einem Stück der Erfahrung zu andern Stücken hingeführt werden, und zwar zu solchen, die zu erreichen die Mühe lohnt. Ursprünglich und auf dem Boden des gesunden Menschenverstandes bedeutet die Wahrheit eines Bewußtseinszustandes nichts anderes als diese Funktion des Hinführens, das der Mühe lohnt.
Wenn im Verlaufe unserer Erfahrung, von welcher Art sie auch sei, ein Augenblick uns mit einem Gedanken erfüllt, so bedeutet das nichts anderes, aIs daß wir, von diesem Gedanken geleitet, wieder in die Einzelheiten der Erfahrung eindringen und vorteilhafte Verbindungen mit ihnen stiften. Unsere Erfahrung ist von Regelmäßigkeiten ganz durchflossen. Ein Stück von ihr kann uns auf ein anderes Stück vorbereiten, kann «intentional» auf einen entfernteren Gegenstand «hinweisen». Tritt dann der Gegenstand wirklich vor uns, so ist der Hinweis verifiziert. Wahrheit bedeutet in diesen Fällen nichts anderes als eventuelle Verifikation und ist mit Launenhaftigkeit unvereinbar. Weh dem, dessen Überzeugungen mit der Ordnung, die in der Wirklichkeit seiner Erfahrungen besteht, ein willkürliches Spiel treiben. Seine Überzeugungen werden ihn nie zu etwas Wirklichem hinführen, oder sie werden falsche Verbindungen stiften. Unter «Wirklichkeiten» und «Gegenständen» verstehen wir entweder die sinnenfälligen Dinge oder auch die Beziehungen des gewöhnlichen Denkens, wie z. B. Zeiten, Orte, Entfernungen, Gattungen, Tätigkeiten. Wenn wir in dem obigen Beispiel den Kuhweg einschlagen und dem in uns lebendigen Bilde des Hauses nachgehen, so kommen wir dazu, das Haus wirklich zu sehen. Das Bild in unserem Kopfe erhält dadurch seine volle Verifikation. Ein derartiges einfach und vollständig sich bewährendes Hinführen, das ist das wahre Prototyp des Wahrheitsprozesses. Die Erfahrung bietet uns auch andere Formen des Wahrheitsprozesses, allein man kann sie alle als gehemmte, verdichtete, oder für einander substituierte primäre Verifikationen auffassen.
Nehmen wir z.B. jenen Gegenstand dort an der Wand. Sie und ich betrachten ihn als eine Wanduhr, ob zwar keiner von uns das innere Uhrwerk gesehen hat, welches ihn zur Uhr macht. Wir lassen unsere Auffassung als wahr gelten, ohne erst die Verifikation zu versuchen. Wenn die Wahrheiten im wesentlichen Verifikationsprozesse sind, sollten wir dann vielleicht derartige nicht verifizierte Wahrheiten als etwas Unfruchtbares ansehn? Nein, denn sie bilden einen überwältigend großen Teil aller Wahrheiten, von denen wir leben. Wir lassen indirekte Verifikation ebenso gelten, wie direkte. Wo die umgebenden Umstände Beweis genug sind, da können wir des Augenscheins entraten. Genau so wie wir annehmen, daß Japan existiert, auch wenn wir nie dort waren, weil seine Tätigkeit uns zu der Annahme veranlaßt, weil alles, was wir wissen, mit dieser Annahme übereinstimmt und nichts sie stört, so nehmen wir auch an, dies Ding dort sei eine Uhr. Wir gebrauchen es als Uhr, indem wir die Dauer der Vorlesung darnach bemessen. Die Verifikation der Annahme besteht hier darin, daß sie nicht zu einer Täuschung oder zu einem Widerspruch führt. Die Verifizierbarkeit der Uhrräder, der Gewichte und des Pendels ist ebensoviel als wirkliche Verifikation. Auf einen ganz vollständigen Wahrheitsprozess kommt im Leben eine Million anderer, die in diesem embryonalen Zustand der Verifikation bleiben. Sie geben uns nur die Richtung zu direkter Verifikation, führen uns in die Umgebung des Gegenstandes, den sie im Auge haben. Wenn dann alles entsprechend verläuft, sind wir von der Möglichkeit der Verifikation so überzeugt, daß wir auf wirkliche Verifikation verzichten, und gewöhnlich rechtfertigen die Ereignisse unser Verhalten.
Die Wahrheit lebt tatsächlich größtenteils vom Kredit. Unsere Gedanken und Überzeugungen «gelten», so lange ihnen nichts widerspricht, so wie die Banknoten so lange gelten, als niemand ihre Annahme verweigert. Dies alles weist aber auf augenscheinliche Verifikationen hin, die irgendwo vorhanden sind. Ohne diese muß unsere Wahrheits-Fabrik ebenso zusammenbrechen, wie ein finanzielles Unternehmen, das überhaupt keine Kapitals-Grundlage hat. Sie nehmen von mir eine Verifikation an und ich eine andere von Ihnen. Wir verkehren untereinander mit unsern Wahrheiten. Aber die Grundpfeiler des ganzen Oberbaues sind doch immer Überlegungen, die von irgend jemandem anschaulich verifiziert worden sind.Aus William James, Der Wahrheitsbegriff des Pragmatismus, in R.Wiehl (Hrsg.): Geschichte der Philosophie/20.Jahrhundert, Reclam Verlag 1981
Das Zitat der Woche
.
Von den Geschlechtern
Immanuel Kant
.
In alle Maschinen, durch die mit kleiner Kraft ebensoviel ausgerichtet werden soll als durch andere mit großer, muß Kunst gelegt sein. Daher kann man schon zum voraus annehmen: daß die Vorsorge der Natur in die Organisierung des weiblichen Teils mehr Kunst gelegt haben wird als in die des männlichen, weil sie den Mann mit größerer Kraft ausstattete als das Weib, um beide zur innigsten leiblichen Vereinigung, doch auch als vernünftige Wesen zu dem ihr am meisten angelegenen Zwecke, nämlich der Erhaltung der Art, zusammenzubringen, und überdem sie in jener Qualität (als vernünftige Tiere) mit gesellschaftlichen Neigungen versah, ihre Geschlechtsgemeinschaft in einer häuslichen Verbindung fortdauernd zu machen.
Zur Einheit und Unauflöslichkeit einer Verbindung ist das beliebige zusammentreten zweier Personen nicht hinreichend; ein Teil mußte dem andern unterworfen und wechselseitig einer dem andern irgendworin überlegen sein, um ihn beherrschen oder regieren zu können. Denn in der Gleichheit der Ansprüche zweier, die einander nicht entbehren können, bewirkt die Selbstliebe lauter Zank. Ein Teil muß im Fortgange der Kultur auf heterogene Art überlegen sein: der Mann dem Weibe durch sein körperliches Vermögen und seinen Mut, das Weib aber dem Manne durch ihre Naturgabe, sich der Neigung des Mannes zu ihr zu bemeistern: da hingegen im noch unzivilisierten Zustande die Überlegenheit bloß auf der Seite des letzteren ist. – Daher ist in der Anthropologie die weibliche Eigentümlichkeit mehr als die des männlichen Geschlechts ein Studium für den Philosophen. Im rohen Naturzustande kann man sie ebensowenig erkennen als die der Holzäpfel und Holzbirnen, deren Mannigfaltigkeit sich nur durch Pfropfen oder Inokulieren entdeckt, denn die Kultur bringt diese weiblichen Beschaffenheiten nicht hinein, sondern veranlaßt sie nur, sich zu entwickeln und unter begünstigenden Umständen kennbar zu machen.
Diese Weiblichkeiten heißen Schwächen. Man spaßt darüber; Toren treiben damit ihren Spott, Vernünftige aber sehen sehr gut, daß sie gerade die Hebezeuge sind, die Männlichkeit zu lenken und sie zu jener ihrer Absicht zu gebrauchen. Der Mann ist leicht zu erforschen, die Frau verrät ihr Geheimnis nicht, obgleich anderer ihres (wegen ihrer Redseligkeit) schlecht bei ihr verwahrt ist. Er liebt den Hausfrieden und unterwirft sich gern ihrem Regiment, um sich nur in seinen Geschäften nicht behindert zu sehen; sie scheut den Hauskrieg nicht, den sie mit der Zunge führt und zu welchem Beruf die Natur ihr Redseligkeit und affektvolle Beredtheit gab, die den Mann entwaffnet. Er fußt sich auf das Recht des Stärkeren, im Hause zu befehlen, weil er es gegen äußere Feinde schützen muß; sie auf das Recht des Schwächeren: vom männlichen Teil gegen Männer geschützt zu werden, und macht durch Tränen der Erbitterung den Mann wehrlos, indem sie ihm seine Ungroßmütigkeit vorrückt.
Im rohen Naturzustande ist das freilich anders. Das Weib ist da ein Haustier. Der Mann geht mit Waffen in der Hand voran, und das Weib folgt ihm mit dem Gepäck seines Hausrats beladen. Aber selbst da, wo eine barbarische bürgerliche Verfassung Vielweiberei gesetzlich macht, weiß das am meisten begünstigte Weib in ihrem Zwinger (Harem genannt) über den Mann die Herrschaft zu erringen, und dieser hat seine liebe Not, sich in dem Zank vieler um eine (welche ihn beherrschen soll) erträglicherweise Ruhe zu schaffen.
Aus Immanuel Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Königsberg 1798
Das Zitat der Woche
.
Über das Gute im Leiden
Henry Deku
.
Seit 1755, dem Erdbeben von Lissabon, pflegt man zu argumentieren: es gibt das Böse, also kann es keinen Gott geben. Thomas dagegen meinte, gerade weil es das Böse gebe, gebe es auch Gott: »esset autem e contrario arguendum: si malum est, Deus est.« Dabei spielt der physische Defekt nur eine Nebenrolle. Daß Tiere sich gegenseitig auffressen, ist ja kein so tragischer Umstand – sollten wir denn vom Tiger erwarten, daß er sein Lebtag nur Rüben knabbert? Schwerwiegend ist erst das moralische Übel bzw. das durch es verursachte Leid, zumal wenn es unverdient ist: Verleumdung etwa, ungerechte Verfolgungen und dergleichen mehr; stellen sie nicht tatsächlich handfeste Einwände gegen die Existenz Gottes dar?
Nun kann man mit dem Leiden in ästhetisierender Weise fertig zu werden versuchen, indem man sagt, wo Licht sei, müsse auch Schatten sein. Dieser mache jenes um so kostbarer. Doch wird ein solcher Gedankengang wahrscheinlich nur solange verfangen, als es andere sind, die zu leiden haben. Dann kann man es moralisch rechtfertigen, wie es ein zwanzigjähriger Student tat, dessen Tagebuch man in Oradour gefunden hat: »La seule vérité de vie: le sacrifice. Je n’ai pas assez sacrifié … combien la douleur est nécessaire! Nous n’aurons jamais assez de douleur car le peu que nous en avons sur terre ne peut même pas effacer ou faire oublier un seul de nos péchés«. Das ist nobel gedacht, wenn auch nicht so überraschend in einem weder gnostischen noch ästhetisierenden BiIdungsmilieu, aber immer noch ein wenig gewaltsam, insofern man Trostgründe gegen das Leid aufmarschieren läßt.Henry Deku: 1909-1993, Studium der Mathematik, Klassischen Philologie, Philosophie in Berlin, Dr. phil. Prof.; 1937 Bonitzpreis der Österr. Akademie der Wissenschaften, Emigration nach einem Aufenthalt im KZ Buchenwald; mit den Amerikanern nach Deutschland zurück; lehrte ab 1946 Philiosophie an den Universitäten Nortre Dame, Salzburg, München (Bronze-Statue: A. Rückel)
Wie wäre es, den Trost im Leiden selber zu suchen? Da es auch darauf ankommt, nicht nur die Dinge so zu sehen »prout sunt« – ohne verfälschende Denkmodelle, sondern auch das Rechte zu tun, wird die Übung der Selbstüberwindung nötig werden: Naive Unmittelbarkeit und Echtheit des Empfindens taugen ja nicht viel, auch Frömmigkeit ist oft genug nur eine Weise der Selbstbestätigung. Sitzen doch die Egoismen im allgemeinen so tief, daß ihnen nichts leichter fällt als eine zur Wirklichkeit recht beziehungslose Frömmigkeitswelt zusammenzuzimmern, in der von vornherein dafür gesorgt ist, daß man nur seinen eigenen Idealen begegnet, nicht aber dem Willen Gottes. Nur widrige Umstände, nur intensive Leiderfahrungen werden ein solches Gefängnis aufzubrechen vermögen. Der Verlust der Selbstverkrampfung, des Eingesponnenseins in sich selber müßte dann aber als befreiend, als beglückend empfunden werden: »itaque ad virtutem spectat tribulationes fortiter sustinere: ad sapientiam gaudere in tribulationibus« (Bernardus PL). Der Trost liegt im Leiden selber, vorausgesetzt man stellt es in den Dienst der Läuterung und Sühne und versucht darüber hinaus noch, durch geduldiges Annehmen die Summe der Übel geradezu zu vermindern; d. h. man soll nicht um jeden Preis soviel wie möglich leiden wollen – das könnte auf Eitelkeit beruhen. Auf das Ertragen als solches kommt es auch nicht an – das wäre allenfalls eine sportliche Leistung, zumal man ja auch für objektiv Unsinniges Opfer zu bringen imstande ist, etwa aus parteipolitischer Leidenschaft. In all dem läge immer noch eine subtile Selbstbestätigung verborgen. Statt dessen kann und soll man aus Liebe zu Gott versuchen, am Widrigen zu wachsen, an ihm ein anderer zu werden, um dann die in irgendeiner Hinsicht negativ gewordene Weltsituation mit der Selbstlosigkeit eines Opfers zu beantworten. Dieses Mehr an Liebe macht zwar das, worauf es die Antwort darstellt, nicht ungeschehen, es vermag ihm aber sozusagen den Stachel zu nehmen. In rückläufiger Betrachtung, aber auch nur in einer solchen, wird sogar dem bösen Anlaß etwas vom Glanz des nachfolgenden Guten zuteil…
Aus Henry Deku, Die Konkurrenzlosigkeit des Christentums, in W.Jens (Hrsg.), Warum ich Christ bin, Kindler Verlag 1979
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über den Frieden
Arthur Schnitzler
.
So lange der Krieg als eine Möglichkeit überhaupt in Betracht kommt, d.h. also, so lange es Berufszweige gibt, die auf die Möglichkeit eines Krieges gestellt sind, ferner so lange es auch nur einen Menschen gibt, der durch den Krieg seinen Reichtum vergrößern oder solchen erwerben kann und der zu gleicher Zeit die Macht hat oder den Einfluß, einen Krieg herbeizuführen, genau so lange wird es Kriege geben. Und hier ist die Frage des Weltfriedens anzupacken, nirgends anders. Weder in religiösen, noch in philosophischen, noch in ethischen Motiven. Diese spielen absolut keine Rolle. Weder die Vernunft, noch das Mitleid, noch die Ehre dürfen wir mit der geringsten Aussicht auf Erfolg anrufen.
Es handelt sich ausschließlich darum, die Ordnung der Welt so umzugestalten, daß kein Mensch, auch nicht ein einziger, weder in Freundes- noch in Feindesland, die geringste Aussicht hat, seine persönlichen Verhältnisse durch einen Krieg zu verbessern. Unmöglich? So lange das unmöglich ist, hat die Friedensbewegung nicht die entfernteste Aussicht auf Erfolg. Mit Tiefsinn und mit Sentimentalitäten werdet Ihr weder die Herzen der Diplomaten, noch die der Attachés, noch die der Generäle, noch die der Heereslieferanten rühren.
Aus Arthur Schnitzler, Aphorismen und Betrachtungen, S.Fischer-Verlag, Frankfurt/M 1967
Das Zitat der Woche
.
Über den Nihilismus
André Comte-Sponville
Nihilismus spielt der Barbarei in die Hände. Davon gibt es zwei Typen, die man keinesfalls verwechseln darf: Die irreligiöse Barbarei ist nichts anderes als ein allgemeiner oder triumphierender Nihilismus; die fanatische Barbarei will ihre Religion mit Gewalt durchsetzen. Nihilismus führt zum ersten Typ und lässt dem zweiten freie Bahn.
Die Barbarei der Nihilisten hat kein Programm, kein Projekt, keine Ideologie. Das braucht sie nicht. Solche Leute glauben an nichts. Sie kennen nur Gewalt, Egoismus, Verachtung und Hass. Sie sind in ihren Trieben, ihrer Dummheit, ihrer Unbildung gefangen, Sklaven dessen, was sie für ihre Freiheit halten. Sie sind Barbaren aus Mangel an Glauben oder Überzeugungen: Sie sind die Partisanen des Nichts.Die Barbarei der Fanatiker kommt ganz anders daher. Diesen fehlt es nicht an Glauben oder Überzeugungen, ganz im Gegenteil: Sie bersten geradezu vor Gewissheit, Enthusiasmus und Dogmatismus. Sie halten ihren Glauben für Wissen und würden jederzeit für ihn sterben oder töten. Zweifel kennen sie nicht. Aber das Wahre und Gute. Wozu Wissenschaft? Wozu Demokratie? Es steht doch alles geschrieben. Man muss nur daran glauben und gehorchen. Zwischen Darwin und Schöpfungsgeschichte, Menschenrechten und Scharia, Völkerrecht und Tora haben sie sich endgültig für ein Lager entschieden. Sie sind an der Seite Gottes. Wie könnten sie unrecht haben? Wie etwas anderes glauben, etwas anderem dienen? Fundamentalismus. Obskurantismus. Terrorismus. Sie wollen Engel sein und werden zu Tieren oder Tyrannen. Sie sehen sich als Reiter der Apokalypse, sind aber Janitscharen des Absoluten, das sie für sich reklamieren und auf die sehr beschränkten Ausmaße ihres guten Gewissens reduzieren. Sie sind Gefangene ihres Glaubens, Sklaven Gottes oder dessen, was ihnen – ohne jeden Beweis – als Sein Wort oder Sein Gesetz gilt. Spinoza hat schon das Wichtigste über sie gesagt: «Sie kämpfen für ihre Knechtschaft, als ginge es um ihr Heil.» Sie wollen sich Gott unterwerfen. Das steht ihnen frei, solange sie nicht auf unserer Freiheit herumtrampeln. Aber sie sollten nicht versuchen, uns zu unterwerfen!
Was ist das Schlimmste, das wir befürchten müssen? Der Krieg der Fanatismen. Oder dass wir den unterschiedlichen Fanatismen der einen ebensowenig entgegenzusetzen haben wie dem Nihilismus der anderen. In beiden Fällen würde die Barbarei gewinnen, ganz gleich, ob sie von Norden oder Süden kommt, aus dem Orient oder aus dem Okzident, ob sie sich auf Gott oder auf das Nichts beruft. Und dann ist es äußerst zweifelhaft, ob unsere Welt überlebt.Aus André Comte-Sponville, Woran glaubt ein Atheist? – Spiritualität ohne Gott, Diogenes Verlag 2008
Das Zitat der Woche
.
Über die Willensfreiheit
Gottfried W. Leibniz
.
Die Prävalenz der Neigungen hindert durchaus nicht, daß der Mensch nicht Herr über sich sei, wofern er nur von seiner Macht Gebrauch zu machen weiß. Sein Reich ist das der Vernunft, er braucht sich nur rechtzeitig zum Widerstande gegen die Leidenschaften zu rüsten, und er vermag dem Ungestüm der heftigsten Leidenschaften Einhalt zu gebieten. Angenommen, Augustus wolle gerade den Befehl zur Hinrichtung des Fabius Maximus geben, und bediene sich gewohnheitsgemäß des Rates, den ihm ein Philosoph gegeben: nichts in der Aufwallung des Zornes zu tun, sondern das griechische Alphabet zu rezitieren. Diese Überlegung vermag das Leben des Fabius und den Ruhm des Augustus zu retten. Doch wird die Leidenschaft ohne eine glückliche Überlegung, die man mitunter einer ganz besonderen göttlichen Güte verdankt, oder ohne eine im voraus erworbene Angewohnheit, geeignet, wie die des Augustus, uns zu den für Zeit und Ort passenden Überlegungen zu bringen, den Sieg über die Vernunft davontragen. Der Kutscher ist Herr über die Pferde, wenn er sie lenkt, wie er soll und kann, es gibt jedoch Gelegenheiten, wo er sich vergißt, und dann muß er für eine Zeit die Zügel fahren lassen.
Immer besitzen wir genügend Macht über unseren Willen, aber man denkt nicht immer daran, sie anzuwenden. Daraus ersieht man, wie wir mehr als einmal erwähnt haben, daß die Macht der Seele über ihre Neigungen eine Macht ist, die sich nur auf indirekte Art ausüben läßt. In Wirklichkeit hängen die äußeren Handlungen, wenn sie nicht unsere Kräfte überschreiten, ganz und gar von unserem Willen ab, unsere Willensakte selbst aber hängen vom Willen nur auf gewissen Umwegen ab, die uns ein Mittel an die Hand geben, unsere Entschlüsse aufzuhalten oder zu verändern. Wir sind bei uns Herr, nicht etwa wie Gott Herr der Welt ist, dessen Wort Schöpfung bedeutet, aber so wie ein weiser Fürst Herr in seinem Staat ist oder ein guter Familienvater seinem Diener gegenüber. Herr Bayle (=Pierre Bayle, 1647-1706, französischer Aufklärer und Skeptiker, berühmter Leibniz-Antipode / Die Red.) faßt dies bisweilen anders auf, wie wenn es eine absolute Macht bedeutete, die von Gründen und Mitteln unabhängig ist und die wir bei uns haben müßten, um uns einer freien Willensentscheidung rühmen zu können. Aber darüber verfügt Gott selbst nicht und kann diese Freiheit in bezug auf seinen Willen in diesem Sinne auch gar nicht haben, kann er doch sein Wesen nicht ändern und nicht anders als der Ordnung gemäß handeln.
Aus Gottfried W. Leibniz, Über die Willensfreiheit, in: Theodizee (1710)
Report: Vom Sturmgeläut zur Totenglocke
.
Klang-Wolken
Franz Trachsel.
.
Klingende anstelle der üblichen stummen, allenfalls donnerrollenden Wolken über unserem Kopf? Was soll’s bedeuten? Dem biblischen Himmel abgelauscht, oder sozusagen jener Wiener Operette aufgesessen, wo der Himmel voller Geigen hängen soll? Oh! Wäre solcherlei in privilegierten Augenblicken aber geeignet, lauter Behagen auszulösen oder in aufgeschriebener Form stille Sonntagnachmittage oder lange Winterabende zu beseelen!
Nur, was soll’s bedeuten für den handfest geschäftigen Alltag? Für einen Bauern zum Beispiel, hier im Falle Ludwig Rengglis auf der am voralpinen nördlichen Pilatus–Fuss gelegenen Entlebucher Rengg?
Wolken sind nun einmal da, oder aber es sind keine da. Seine Erfahrung lehrt ihn jedoch, dass Wolken, auf der Rengg erlebt, höchst stimmig sein können. Stimmig, wenn sie ersehnten Regen versprechen, stimmig für ihn vor allem aber dann, wenn er sie zum glücklichen Zeitpunkt als Klangwolken mit Signalwirkung daherkommen hört.
«Wetter zum Heuen» heisst dieses auf der Rengg eines Frühsommermorgens abgelauschte Signal in der Sprache Meister Rengglis. So denn auch seine Botschaft an die bei Rösti und Milchkaffee zum Frühstück versammelte Familie. Zurück von ersten frühmorgendlichen Verrichtungen in Feld und Stall gibt er sich beruhigt überzeugt davon, und die älteren unter seinen fünf Nachkommen harren auch schon seiner Erklärung: «Man hört Emmen läuten». Wieder mal ganz nach Wunsch eingestellt hatte sich anfangs Juni über Nacht der willkommene Klang-Wolken-Verfrachter, der Ostwind.
Ostwind zum Juni – Beginn auf der Rengg: Die Gewähr, den Heuet einem Vorschuss-Erntesegen gleich gesichert beginnen zu können! Fürs Auge, von bisweiligen dünnen Schleierwolken abgesehen, der sommerlich sanftblaue Himmel; fürs Ohr, wenn Emmen Dorf zum Gottesdienst ruft, die Klangwolken; und in der Nase den in wenigen Tagen sich in Haus und Hof ausbreitende Duft frischen Heus.
Mag den Bauern drunten im Tal im Hinblick auf den erforderlichen Betriebshauptertrag aus Weizen-, Obst-, Gemüse- oder Kartoffelernte die vorrangige Bedeutung zukommen, hier oben ist‘ s der Lage gemäss der Milchertrag, der zählt, und demzufolge für seine zwanzig Kühe die Weide im Sommer und das Heu im Winter. «Jedes Geschöpf lebt von der Frucht der Erde», besingt ein bekanntes Kirchenlied. Begreiflich, dass den dank Ostwind hierher verfrachteten Klangwolken ein wenig der Nimbus eines Familienschicksals zukommt.
Ahnungslos zu sein darüber, was das Geheimnis derer ausmacht, welche die Klangfülle aus dem Kirchturm zu Emmen dem Ostwind mit auf seine Reise geben, war nicht die Art der Familie Renggli. Auffallend am an Klangfarbe und -fülle reichen Geläute nun einmal der stark herauszuhörende, führende Unterton: Ein Akkord wie dazu bestimmt, auf der vom jeweiligen Ostwind beflügelten 20-Kilometer-Schwingungsreise zu 800 Metern Höhenunterschied vom Reusstal zur Rengg empor, die Aufgabe der akkustischen Tragfläche wahrzunehmen. So eine der Besonderheiten eines in der Tradition Emmens verwurzelten und gewachsenen Kirchengeläutes. Erstmals verbrieft findet man Emmen Dorf so gesehen, noch vor der Gründung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, nämlich im Jahre 1257. Eine Tradition, welche 1828 frühere Kirchenbauten durch die heutige Dorfkirche ersetzt hat, und die in ihrem Turm seit 1880 ausser drei früheren Glocken neu gleich noch vier weitere, seither also deren sieben beherbergt.
Begreiflich im Hause Renggli, dass nicht gleich alle fünf Nachkommen Anspruch darauf erhoben, die nächste Generation auf der Rengg zu stellen. Willy zum Beispiel wandte sich nach gründlicher Lebens- und Berufsbildung in der Heimatpfarrei Entlebuch dem Sakristanen-Beruf zu. Das Aparteste, was er dort wenige Jahre später erfahren konnte, war, Emmen Dorf bedürfe für seinen altershalber zurücktretenden Sakristan eines Nachfolgers. Darauf hingewiesen zu werden war ihm eine einzige Vergegenwärtigung dessen, auf welchem Weg ihm Emmen seit früher Jugend heraufgedämmert war. Und das im Vertrauen – falls, was er nicht auszuschließen gedachte, er der Bewerbungsfavorit sein sollte – darauf, etwas Gutes ins Auge gefasst zu haben.
Emmens neuer Sakristan war 1975 niemand anders als Willy Renggli. Er kam sich vor wie von einer reichen Ernteankündigung begünstigt. Einmal im Leben die grosse Ernte einfahren, wer möchte das nicht! Fast steht die Redensart neben dem gezogenen grossen Los. Demnach müsste, wer von Berufes wegen handgreiflichst grosse Ernten einfährt, der Glücklichste sein auf Erden. Dem widerspricht, dass Bauern selten auf Heu allein gebettet und die Abhängigkeit wie auch die Risiken vielfältig sind. Auf ureigene, signalhaft verlässliche Klangwolken am Himmel müsste ihnen wie den Rengglis auf der Rengg Verlass sein.
Keine Frage, dass ihn sein erster Besuch in Emmen die steilen, engen Holztreppen hinauf in die Glockenstube des Kirchturms führte, denn die As-Glocke zu sieben Tonnen Gewicht und je zwei Metern in Höhe und Durchmesser unter den übrigen sechs Gefährtinnen musste er gesehen haben. Man sagt, er sei fortan ein wenig in sie verliebt gewesen.
Mögen einige Jahrhunderte für eine Glocke auch im Turm zu Emmen kein aussergewöhnliches Alter darstellen, sie bleibt sich, ob neu oder alt, treu und bezieht ihre Tonqualität aus dem sorgfältig aus Kupfer und Zinn legierten Bronzeguss, ihrer Dimension und Wandstärke, sowie aus den kunstgerecht auf eine entsprechend gestimmte Tonlage nachgeschliffenen Rippen.
Es fehlt so gesehen auch am Glockenhimmel nicht an Sternen. Wie sonst wäre das sopranistisch hehr ausholende «Hörst Du die Glocken von Stella Maria?» in seiner schier unvergleichlichen Weite und Schönheit, ja fast Erhabenheit zu erklären, oder das von stimmgewaltigen Moskauer Männerchören geradezu eindrücklich wiedergegebene «Einsame Kirchenglöckchen in der Taiga»!
Vereinzelte Glocken vermögen aber auch von sich aus weltweit zu imponieren. So nicht zuletzt im italienischen, ohnehin melancholischen Dorfkirchengeläute, wo eine einzelne daraus jeweils die Totenglocke zu markieren hat. Und fernab moderner Glocken-Joche und -Lagerungen im Kirchturm, elektronischer Zeitschaltungen und Steuerungen, nicht zuletzt auch diverser Antriebstechniken wirkt eine einsame Glocke auf einer afrikanischen Missionsstation geradezu archaisch einfach; ein urtümlich behelfsmässiger Stamm in die Astgabeln je eines an Ort und Stelle gewachsenen und zurecht gestutzten Baumes gelegt, und die Glocke hängt, zwecks eines stattlichen Klangs mit einem Handseil dran, unter freiem Himmel.
Für sozusagen zum Schweigen abberufen hält der Besucher im Kreml zu Moskau die dortige «Kolokol», den mehr als 200-Tonnen-Riesen unter den weltgrössten. Und dann die von Seiten der Besucher sich geradezu aufdrängende Frage nach dem Glockenturm, worin dieser Gigant hänge – und welche baulichen Voraussetzungen ihn schadlos schwingen lassen und zum Klingen bringen. Nun, die Ausstellung daselbst macht kein Geheimnis daraus, dass der Glocke beim Giessen vor 275 Jahren ein Grossbrand zum Verhängnis geworden ist. Ihm zufolge drang Löschwasser, so sagt man, in die noch nicht erkaltete Form und sprengte ein Stück von 12 Tonnen ab. Aus der Erde gehoben und ausgestellt hat man sie erst 1836, hundert Jahre später, ohne dass sie jemals einen Klöppel zum Schwingen und voluminösen Schlagen gebracht hätte.
In einem preisgekrönten Südtiroler Lied grüssen die Glocken «die Gletscher und das ewige Eis» – vergleichsweise bescheiden erfüllt der berühmte Big Ben im Londoner Westminster-Uhrturm die ihm zugedachte Aufgabe ohne Anspruch darauf, dabei von aussen beobachtet werden zu können. Der mächtige Stundenschlag sichert dem 13-Tönner die Publikumsgunst auf immer auch hinter seinen Turmlucken-Lamellen.
Glockengeläute: Ihm verdankt eine Gemeinschaft, am klanglich hochkoloriert rationalen, emotionalen oder religiösen Pulsschlag einer Gesellschaft, ja einer Nation (hierzulande vornehmlich aus Anlass der Bundesfeier), aber auch gemeinsamer christlicher Fest- und Feiertage zu stehen. Kanada zum Beispiel liess die Welt ihre 400-Jahre-Stadt und landesweit grösste Provinz Quebec durch seinen vom Atlantik bis zum Pazifik vereinten Glockenklang vernehmen, am 1. Juli 2008. Und das Charakterbild einer unverkennbar Jahrhunderte alten Glocke markierte im Frühjahr 2008 das Titelbild einer bekannten Jesuiten-Zeitschrift; geweiht ist sie, ihrer Inschrift gemäss, «in nomine Jesu» dem heiligen Petrus («San Pedro»). Sie steht für die im 17./18. Jahrhundert während 150 Jahren im Paraguayanischen Urwald geführte und inzwischen wieder fortgesetzte Indianer-Guarani-Mission. Unübersehbar daran, dass sie die 250 Jahre Zwischenzeit etwas mitgenommen haben, aber auch, dass sie all die lange Zeit dazu überstanden hat, die Missions-Pionierarbeit heute erst recht wieder zu beflügeln. Ihr im Busch verbrachtes Vierteljahrtausend kommt der zweiten Dimension ihrer Botschaft gleich…
Eines mehr nordamerikanischen Bekanntheitsgrades erfreut sich das Geläute im Turm der River-Side-Church im nördlichen Manhattan der Riesenmetropole New York. Das Besondere daran: ihr Glockenspiel. Und wenn immer aus Anlass einer grossen Feier auf dem St. Petersplatz in Rom dank weltweiter Fernsehübertragung eindrückliche Bilder über den Bildschirm gehen, dann zum jeweiligen Ausklang aus der linksseitigen Domnischen-Höhe stets auch das imposante Erscheinungsbild und der vollrunde Klang der wuchtigen As-Glocke.
Sterne am Glockenhimmel: Eine Vielzahl von Zeitgenossen könnte sich vielleicht vorstellen, ihre Lieblingsglocke, wo auch immer rund um die Welt, unterm zeitgemässeren Star (=Liebling) angeführt zu erhalten. Eine reiche Vielfalt dessen, was der Inbegriff einer «Lieblingsglocke» sein kann, wäre vermutlich die Folge. Vor allem aber sähen sich wahrscheinlich, und das vielleicht nicht zu Unrecht, in nur halb so berühmten Türmen und Geläuten thronende Glocken oder Glockenspiele, lokale nicht ausgenommen, zum Star erhoben.
Wenn hierzulande ein Wahrzeichen architektonisch und klanglich Luzerns stolze Tradition mitverkörpert, dann die Hofkirche. Noch bis vor 100 Jahren hat sich ihr klangvolles, von den beiden Türmen in die Strassen und Gassen hinunter zum Gottesdienst rufendes Geläute seit jeher mit dem Knarren der verkehrenden Pferdefuhrwerke und dem Knattern der Kutschen vermengt. Ob’s beim Ablauf ihrer je eigenen Schallwellen länger (will sagen: erklecklicher) ablief als angesichts des heutigen unaufhörlichen Motorengedröhns sei, den Tonmeistern anheim gestellt. Es braucht sich solcherlei aber gar nicht immer nur an historisch-kulturell berühmter Stelle abzuspielen: Wer am späten Samstagnachmittag die Emmen Center-Restaurants verspätet verlässt, hört sich sozusagen im Sinne einer nächsten Einladung draussen vom die Seetal-Strasse säumenden Kirchturm St.Maria herab auch schon zum Sonntag willkommen geheissen.
Sage zudem noch jemand, die Zeit der «Glocken der Heimat» am Samstagabend über Radio DRS sei nach all ihren Jahrzehnten im Programm abgelaufen! Nach wie vor gehen sie, gewiss nicht ohne Zuhörerschaft, regelmässig über den Aether.
Glöckelein von Munots Gnaden und sein Klingen, das, was Schaffhausen und darüber hinaus seine Freunde landesweit aus dem Herzen singt: Zart in seinem klanglichen Auftritt und liebevoll im nicht weniger bekannten Lied besungen, dürfte es jedoch, weil im «Hohen Turm», dem Höchsten seines für seine Stadt historisch wehrhaften Munots zu Hause, gleichzeitig aber auch als Respektssignal verstanden werden.
Unter anderen Sternen am Glockenhimmel wie das Berner Münster, die Kathedrale Fribourg, wo eine 650-Jährige treue Dienste erfüllt, kann die Glockenstube zu Malters für sich beanspruchen, ihre wohlklingenden Schützlinge im höchsten katholischen Turm unseres Landes zu 98 Metern zu beherbergen.
Wie metallisch zart filigraniert kommt, wenns ebenso zart säuselnden Winden gefällt, ein Geläute über einen dazwischen stehenden Wald in Emmenbrücke daher! Gerliswils Glockenklang (Gemeinde Emmen) liess sich, 1924 eingeweiht und in Betrieb genommen, in der Gerliswilstrasse drunten noch sehr wohl mit dem Knarren von Pferdefuhrwerken vermengt vernehmen, wenn er zum Gebet oder Gottesdienst rief. Auch waren die von der Glockenstube bis ins Turmparterre herunterhängenden Handseile, wie damals notwendigerweise noch nicht anders üblich, dazu da, von treuen, kräftigen Helfern, auf dass es kunstgerecht klinge, gezogen zu werden. Ein für manchen heutigen Senior unvergessliches Erlebnis!
Etwas vom Garstigsten allerdings, welches der allmählich 100jährigen Pfarrkirche Gerliswil (1915-2015) widerfahren konnte, war die Ausgeburt des längsten Tages 2007 in Gestalt eines Gewittersturms fast ohnegleichen. Ein in der Fachsprache unter klassischer Kaltfront angekündigter Wetterumsturz hatte es in sich, Schrecken zu verbreiten und den 21. Juni 2007 zu einem Schatten seiner selbst zu machen. Es bot sich das Bild eines wieder zur Nacht gewordenen Morgens. Eine bedrohlich düstere, von Sturmwinden, Regengüssen, Hagel, Blitz und Donner gezeichnete Wolkenwand wälzte sich unter Getöse einher, als hätte sie’s ausgerechnet auf die nördlichen Vororte Luzerns abgesehen. Da sass man ohne jede Ahnung davon, was ihre flächenmässige Ausdehnung und das Schicksal der Nachbarschaft betreffen mochte, mitten drin in einem hoch darüber zum geradezu kochenden Kumulus-Gebräu gezeugten nasstriefenden Hexenkessel!

Luzern und seine Hofkirche kurz vor einem heftigen Sommergewitter
Unheimlich daran vor allem die mit weisslichen Hagelböen vermengten, sturzbachähnlichen Regenwände herniederfegen zu sehen, bis nackttrockener Hagel den Hexenkessel endgültig zur Hölle machen könnte. Dazu unter berstenden Donnerkrachern das pausenlose Jagen der Blitze! Und dies alles in so großer Bodennähe, dass einem, möglicher Einschläge wegen – den ins diabolische Wolkengebräu hineinragenden Kirchturm Gerliswils nicht ausgenommen – fast bange wurde. Dann aber urplötzlich das Unerwartete: Die sechs Glocken der Gerliswiler Pfarrkirche setzten zum Sturmläuten an! In ähnlichen Fällen seit jeher, in jüngerer Zeit jedoch kaum mehr praktiziert, hatte es dabei diese Klage zum Himmel in sich: Das beklemmende Erlebnis einer in dieser Tempierung und Zusammensetzung vielleicht noch nie dagewesenen Klangwolke war vollständig. Blitz, Donnerbersten und -Krachen, Sturmwind, sturzbachähnliches Regenprasseln und Hagelgehacke vermengt nun mit diesem klagenden Geläute!
Nun, in einen verheerenden Hagelschlag gekippt, so wie anderswo, ist das wilde Fegen entfesselter Gewittersturmkräfte nun doch nicht. Aber der Mann an der Gerliswiler Glockensteuerung war wenig später der darauf Angesprochene: «Wie fühlt man sich, wieder einmal zum Sturmläuten herausgefordert gewesen zu sein?» – «Das war es gar nicht; der Zeitpunkt deckte sich nur genau mit einem Begräbnis, wozu bekanntlich die Totenglocken in Aktion zu treten haben», lautete der knappe Bescheid. Also ein von solch infernalischen Paukenschlägen angeführter Riesenspektakel zum Abschied eines Mitmenschen, als habe dieser auf sein menschlich Endzeitliches aufmerksam zu machen! Und zwar auf den in seinem 75. Altersjahr zu Grabe getragenen Fritz Arnold, der offenbar abseits eines grossen Bekanntenkreises kaum von sich reden gemacht und zu den Stillen im Lande gezählt haben musste. Gelebte Bescheidenheit offenbar, die sich kaum je die Freiheit genommen hatte, zu irgend einer atypischen Jahreszeit ein wenig Fasnacht zu spielen, stattdessen die Jahreszeiten mit ihren Besonderheiten annahm und sie lebte…

Gewitterszene aus Les grandes inventions anciennes et modernes dans les sciences, l'industrie et les arts (1870)
Fragen, wie sie sich beim Zusammenprall seines Begräbnisses mit solch einem Witterungseklat stellen, und wie sie sich auch dem Amerikaner Bob Dylan in seinem einfühlsamen Lied «Blowing in the wind» stellen: «How many times must the man look up before he can see the sky?“ – «Wie viele Male muss der Mensch empor schauen, bis er den Himmel zu sehen vermag?» – «The answer my friend», findet der Sänger, «is blowing in the wind». – «Die Antwort, mein Freund, die treibt im Winde». – Im Wind, der im biblischen Pfingstbericht niemand anderes ist als Gottes Heiliger Geist, dahergefahren im himmlisch gewaltigen Sturmgebraus.
«How many roads must a man walk down…?» – «Wie viele Wege muss ein Mensch gegangen sein, bevor Du ihn einen Menschen nennen kannst?» – «The answer my friend is…» – «Die Antwort auf die Frage nach seiner und jedermanns Würde, mein Freund, treibt im Winde dahin».
Im Wind, der, Stunden nach dem Begräbnis Fritz Arnolds und nachdem die in Moll aufspielende Orgel verstummt und der Segen über den Verstorbenen und die Gemeinde erteilt waren, wieder im Abflauen begriffen war, auch die dämonische Wolkenwand sich auflöste und die Donnerschläge wie leergeschossen, metallisch hohl in der östlichen Ferne ausklangen – «The answer, my friend, is blowing in the wind»… ♦
________________________________
Franz Trachsel
Geb. 1933, langjähriger Lokal- und Kulturjournalist bei verschiedenen Printmedien, Kurzprosa in Zeitungen und Zeitschriften, lebt in Emmenbrücke/CH
.
.
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Von der Verteidigung der Freiheit
Albert Camus
Man findet sich zu leicht mit dem Verhängnis ab. Man läßt sich zu leicht zu dem Glauben verleiten, daß im Grunde genommen nur das Blut die Geschichte vorwärtstreibt und daß der Stärkere dank der Schwäche des anderen fortschreitet. Vielleicht gibt es dieses Verhängnis. Aber es ist nicht die Aufgabe des Menschen, es hinzunehmen und sich seinen Gesetzen zu unterwerfen. Wenn die Menschen es in der Urzeit getan hätten, stünden wir heute noch in der Vorgeschichte. Die Aufgabe des gebildeten und gläubigen Menschen besteht auf jeden Fall nicht darin, den historischen Kämpfen auszuweichen, noch darin, dem Grausamen und Unmenschlichen an ihnen zu dienen. Sondern darin, ihren Platz zu behaupten, dem Menschen Hilfe zu bringen gegen das, was ihn unterdrückt, und seine Freiheit zu verteidigen gegenüber den Verhängnissen, die ihn rings umgeben.
Unter dieser Bedingung schreitet die Geschichte wahrhaft vorwärts, dann schafft sie Neues, ist sie mit einem Wort schöpferisch. In allem übrigen wiederholt sie sich wie ein blutiger Mund, der nur wütendes Gestammel speit. Wir sind heute am Gestammel, und doch öffnen sich unserem Jahrhundert die weitesten Perspektiven. Wir stehen noch beim Zweikampf mit dem Messer, oder doch beinahe, und die Welt bewegt sich mit der Geschwindigkeit unserer Überschallflugzeuge. Am gleichen Tag, da unsere Zeitungen den traurigen Bericht unserer Provinzstreitigkeiten drucken, verkünden sie die Schaffung des europäischen Atompools. Wenn Europa bloß mit sich selber eins wird, können morgen Fluten von Reichtümern den Kontinent bedecken und bis hierher überfließen, so daß unsere Probleme überholt sind und unser Haß hinfällig wird.
Aus Albert Camus, Verteidigung der Freiheit, Politische Essays (daraus: Burgfrieden in Algerien, Algier 1956), Rowohlt Verlag 1960
Das Zitat der Woche
.
Über das emanzipative Sprechen
Werner Loch
.
Welches sind die Regeln des emanzipativen Sprachgebrauchs?
Es ist ein nicht repressives und insofern herrschaftsfreies Sprechen, das die Wahrheit sagt ohne Rücksicht auf einen Herrschaftsanspruch, der dadurch verletzt werden könnte. Es ist insofern autoritätsfreies Sprechen, als dabei Berufung auf Autorität anstelle von vernünftigen Gründen ausgeschlossen ist. Es verfährt nach der Regel, daß immer dann, wenn eine nicht selbstverständliche Behauptung oder Forderung aufgestellt wird, eine vernünftige Begründung dieser Aussage gegeben oder erfragt werden muß.
Als vernünftiges Sprechen ist es sachgemäßes, alle vom in Rede stehenden Sachverhalt geforderten Unterscheidungen berücksichtigendes und logisch folgerichtiges Sprechen, dessen Aussagen nachprüfbar sein müssen. Nur dann ist es überzeugend. – Um nachprüfbar und überzeugend zu sein, muß es ein verständliches Sprechen sein. Diese Verständlichkeit zeigt sich in dem Merkmal der Übersetzbarkeit seiner Ausdrücke und Aussagen in die Sprache der Angesprochenen, seiner Bereitschaft, deren sozialkulturelle Lebensbedingungen und -bedürfnisse als hemmende oder fördernde Faktoren ihres Verständnisses im Gespräch mit zu berücksichtigen, und der Bereitschaft, sich von jedermann immer wieder neu in Frage stellen zu lassen und Antwort zu geben.
Emanzipatorisches Sprechen muß deshalb reversibles Sprechen sein, das jedem Gesprächspartner bzw. Diskussionsgegner grundsätzlich die gleichen Rechte einräumt. Die benutzten Redeformen und Ausdrücke müssen allen Beteiligten gleich erlaubt sein. Auf die Argumente eines jeden muß gleichmäßig eingegangen werden, und die Verteilung der Sprechzeiten darf niemanden benachteiligen. Kein Gesprächs- oder Diskussionspartner darf wegen seiner individuellen oder sozialen Situation oder Position diskriminiert werden (z. B. wegen seines Alters, weil er «zu jung» oder «zu alt» erscheint).
Trotz aller Gleichberechtigung der Partner ist es ein kritisches Sprechen, das – weil autoritätsfrei bzw. <antiautoritär> – die nicht als vernünftig zu rechtfertigenden Behauptungen bzw. Forderungen in Frage stellt und Aussagen, die die wirklichen Verhältnisse verschleiern bzw. verfälschen, entlarvt und richtigstellt. – Das emanzipative Sprechen ist notwendig praxisbezogen, weil sich sonst das Ziel der Emanzipation nicht verwirklichen läßt. Was als vernünftig erkannt ist, muß realisiert werden. Denn mündiges Handeln heißt, das, was als Aufgabe überzeugend ausgesprochen und als Verpflichtung übernommen worden ist, verantwortlich verwirklichen. Die gesellschaftliche Praxis gibt dem emanzipativen Sprechen seine Gegenstände auf. Sie ist insofern sein <Prinzip>.
Als kritisches und praktisch verbindliches Sprechen ist das emanzipative Sprechen notwendig wertend und normativ, weil jede Kritik und jede Handlung Normen braucht, an denen sie sich orientiert, und Ziel, Mittel und Ergebnisse des Handelns beurteilt.
Als handlungsbezogenes Sprechen ist es notwendig ein projektierendes Sprechen: In der kritischen Abhebung von den faktischen Verhältnissen, die geändert werden sollen, entwirft es zukünftige Handlungsmöglichkeiten, die die Regel der Sachgemäßheit jedoch grundsätzlich der Forderung der Realisierbarkeit unterstellt. Seine Konzepte können utopisch sein, d. h. etwas noch nicht Verwirklichtes aussprechen, es muß sich nur verwirklichen lassen. Deshalb ist gerade dieses projektierende Sprechen auf Praxis angewiesen.
Um kritisch und projektiv sein zu können, setzt dieses Sprechen sprachliche Sensibilität und Kreativität voraus. Nur dadurch können die oft verschleierten, ja unbewußten Zwänge, Hemmungen und Herrschaftsformen bezeichnet, begriffen und die neuen Handlungsmöglichkeiten entworfen werden, die sie zu überwinden suchen.
Die praktische Verbindlichkeit des emanzipatorischen Sprechens impliziert das soziale und politische Engagement. Was als vernünftig erkannt ist, muß in der Gesellschaft und darf nicht abseits von der Gesellschaft verwirklicht werden. Es muß, wenn notwendig, mit politischen Mitteln durchgesetzt werden, für die grundsätzlich gilt, daß auch sie die Regeln der Mündigkeit nicht verletzen dürfen, weil Mündigkeit als Ziel der Erziehung und immer neue Aufgabe der Selbsterziehung in der Dimension ihre entscheidende Erprobung findet, aus der sie als Anspruch der Vernunft gegen ungerechtfertigte Herrschaft erwachsen ist: in der politischen. ♦
Aus Werner Loch: Sprache; in: Handbuch pädagogischer Grundbegriffe II, Kösel Verlag, München 1970
Das Zitat der Woche
.
Vom Berichten und Überzeugen
Eike von Savigny
.
Warum können wir mit Berichten, daß p, Leute davon überzeugen, daß p der Fall ist? Indem wir berichten, daß p, übernehmen wir Verantwortung; und wir werden zuverlässig, weil wir Kosten vermeiden müssen. Weil wir zuverlässig sind, treffen unsere Berichte gewöhnlich zu; Leute, die sich auf sie verlassen, werden gewöhnlich nicht enttäuscht. Deshalb gewöhnen sie sich daran, uns zu trauen. Wenn wir die Überzeugungsbildung entscheidungstheoretisch betrachen, ist die Mechanik des Überzeugens sogar noch direkter: Die Adressaten werden von p in einem Grade überzeugt, hoch genug, um sich darauf zu verlassen, weil wir durch die Übernahme der Verantwortung ihr Risiko minimieren.
Aber schauen wir doch genau hin, wie das vor sich geht. Weil unsere Äußerungen ihre konventionalen Ergebnisse haben, können wir sie benutzen, um unsere Motive zu verfolgen. Daß unsere Äußerungen deshalb Berichte wären, weil wir sie aus dem Motiv tun, Adressaten zu überzeugen, hieße das Pferd beim Schwanze aufzäumen. Darauf muß ich bestehen und kann dann gern zugeben, daß unsere Sprache ganz anders aussähe, wenn wir sie nicht ständig benutzten, um unsere Adressaten zu überzeugen – sie würde anders aussehen, weil sie ein ganz andersartiges System von Äußerungsbedeutungsregeln darstellen würde. Würden wir nicht ständig unsere Mitmenschen über Tatsachen informieren, deren Zeugen sie nicht selbst gewesen sind, dann würden wir ein ganz anderes Leben führen; vor allen Dingen würde unser Wissen von Generation zu Generation nur in äußerst kleinen Schritten anwachsen, beschränkt auf das, was man vormachen oder zeigen kann. Vielleicht würden wir irgendwo in der Mittleren Steinzeit leben. Natürlich würde unsere Sprache sehr von unserer jetzigen abstechen, wenn wir überhaupt eine hätten. Also ist die Tatsache, daß wir unsere Sprache zum Überzeugen benutzen, dafür mitverantwortlich, daß wir gerade diese Sprache haben. Riskanter ausgedrückt: Diese Tatsache ist mitverantwortlich dafür, daß unsere Sprache so ist, wie sie ist; weniger riskant: mitverantwortlich dafür, daß wir gerade so mit einer solchen Sprache überlebt haben. Der Geschlechtsverkehr beruht auf bestimmten physiologischen und psychologischen Grundlagen. Diese Grundlagen sind nicht deshalb gerade so, weil sie für das Streben nach Glück benutzt werden. Umgekehrt, sie werden für das Streben nach Glück benutzt, weil sie gerade so sind. Trotzdem würden sie uns fehlen, wenn wir sie nicht ständig für das Streben nach Glück benutzen würden – aus dem einfachen Grunde, daß wir sonst ausgestorben wären. ♦
(Aus Eike von Savigny: Zum Begriff der Sprache, Konvention, Bedeutung, Zeichen, Reclam Verlag 1983)
Das Zitat der Woche
.
Tod und Fortleben
Max Scheler
.
Wir sehen in den letzten Jahrhunderten den Glauben an die Unsterblichkeit innerhalb der westeuropäischen Zivilisation im wachsenden Sinken begriffen. Was ist der Grund? Viele meinen, es sei das, was sie den Fortschritt der Wissenschaft nenne. Die Wissenschaft aber pflegt der Totengräber, nie die Todesursache eines religiösen Glaubens zu sein. Religionen werden geboren, wachsen und sterben; sie werden nicht bewiesen und nicht widerlegt. […]
Suchen wir also letzte Gründe für das Sinken des Glaubens an die Unsterblichkeit innerhalb der Völker westeuropäischer Kultur, so müssen wir unsere Blicke abwenden von allen jenen bloß symptomatischen Erscheinungen seines Sinkens, wie sie in allen bloß wissenschaftlichen Reflexionen darüber gegeben sind. Und wir müssen ihn hinwenden auf die prinzipielle Art und Weise, wie gerade der moderne Mensch sein Leben und seinen Tod sich selbst zur Anschauung und zur Erfahrung bringt.
Da ergibt sich nun der auf den ersten Blick merkwürdige Tatbestand, daß es an erster Stelle gar nicht das besondere neue Verhältnis des Menschen zur Frage, ob er nach dem Tode fortexistieren werde und was nach seinem Tode sei, welches Schicksal ihm da widerfahren werde, ist, was für jenes Sinken des Glaubens an das Fortleben bestimmend ist, sondern vielmehr das Verhältnis des modernen Menschen zum Tode selbst. Der moderne Mensch glaubt in dem Maße und so weit nicht mehr an ein Fortleben und an eine Überwindung des Todes im Fortleben, als er seinen Tod nicht mehr anschaulich vor sich sieht – als er nicht mehr «angesichts des Todes lebt»; oder schärfer gesagt, als er die fortwährend in unserem Bewußtsein gegenwärtige intuitive Tatsache, daß uns der Tod gewiß ist, durch seine Lebensweise und Beschäftigungsart aus der klaren Zone seines Bewußtseins zurückdrängt, bis nur ein bloßes urteilsmäßiges Wissen, er werde sterben, zurückbleibt. Wo aber der Tod selbst in dieser unmittelbaren Fom nicht gegeben ist, wo sein Herankommen nur als ein dann und wann auftauchendes urteilsmäßiges Wissen gegeben ist, da muß auch die Idee einer Überwindung des Todes im Fortleben verblassen.
Der Typus «moderner Mensch» hält vom Fortleben vor allem darum nicht viel, da er den Kern und das Wesen des Todes im Grunde leugnet.
Um die eben aufgestellte These zu begründen, ist es nötig, einiges über Wesen und Erkenntnistheorie des Todes voranzuschicken, d. h. auf die Frage einzugehen, was der Tod sei, wie er uns gegeben sei und welche Art von Gewißheit des Todes wir besitzen.
Es ist gegenwärtig die am meisten verbreitete Vorstellung, daß unser Wissen vom Tode ein bloßes Ergebnis der äußeren, auf Beobachtung und Induktion beruhenden Erfahrung vom Sterben der anderen Menschen und der uns umgebenden Lebewesen sei. Nach dieser Ansicht würde ein Mensch, der niemals mit angesehen oder davon gehört hat, daß nach einer bestimmten Zeit die Organismen aufhören, die ihnen vorher eigenen «Lebensäußerungen von sich zu geben», und schließlich in einen «Leichnam» verwandelt werden und zerfallen, keinerlei Wissen vom Tode und von seinem Tode besitzen.
Dieser Vorstellung, welche den Begriff des Todes zu einem rein empirisch aus einer Anzahl von Einzelfällen entwickelten Gattungsbegriff macht, müssen wir hier entschieden widersprechen. Ein Mensch wußte in irgendeiner Form und Weise, daß ihn der Tod ereilen wird, auch wenn er das einzige Lebewesen auf Erden wäre; er wußte es, wenn er niemals andere Lebewesen jene Veränderung hätte erleiden schon, die zur Erscheinung des Leichnams führen.
Man kann nun dies vielleicht zugeben, aber dazusetzen, dass es in diesem Falle eben doch auch einzelne Beobachtungen an seinem eigenen Leben sind, die ihm ein Aufhören seiner Lebensprozesse «wahrscheinlich» machen würden. Der Mensch macht die Erfahrungen des «Alterns». Er nimmt auch, abgesehen von den hiermit verbundenen Niedergangserscheinungen seiner Kräfte, in den Erlebnissen der Erkrankung und der Krankheiten irgendwie Kräfte wahr, die in ihrer weiteren Entwicklung ihm die ahnende Vorstellung eines Endes seines Lebensprozesses überhaupt suggerieren müßten. Oft zwingt ihn ein starkes Gefühl dazu, aus dem Sinn- und Zweckzusammenhang seines Wachlebens hinunterzusteigen in Schlaf und Traum; er muß es, obgleich er dabei die Hälfte seines Lebens verliert. Fr braucht gleichsam nur die Richtung der Kurve, die ihm jede dieser Erfahrungen des Alterns, der Krankheit, des Schlafes gibt, auszuziehen, um an ihrem Endpunkte gleichsam die Idee des Todes zu finden. Aber auch diese Vorstellung genügt nicht, das Problem zu lösen. Denn woher wußte der Mensch, daß diese Kurve nicht grenzenlos in diesem Rhythmus weitergehe? Nicht erst in der Beobachtung und der vergleichenden Erinnerung verschiedener Lebensphasen, hinzugenommen ein solches künstliches Vorwegnehmen der «wahrscheinlichen» Beendigung, liegt das Material zu jener Gewißheit, sondern sie liegt schon in jeder noch so kleinen «Lebensphase» und ihrer Erfahrungsstruktur. ♦
Aus Max Scheler, Tod und Fortleben, Francke Verlag 1957


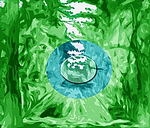


















































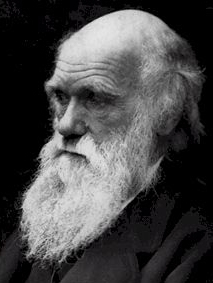












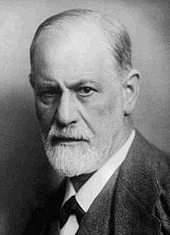























leave a comment