Das Zitat der Woche
.
Über den Patriotismus
Samuel Smiles
.
Ein großer Teil dessen, was heutzutage im Namen des Patriotismus geschieht, ist im Grunde genommen bloße Heuchelei und Beschränktheit, die sich in nationalen Vorurteilen, nationalem Dünkel und nationalem Haß darstellen. Diese Gesinnung zeigt sich nicht in Taten, sondern in prahlerischen Worten – in Geschrei, Gestikulationen und kläglichen Hilferufen – im Fahnenschwenken und Absingen von Liedern – im beständigen Ableiern längst begrabener Beschwerden und längst gesühnten Unrechts. Von solchem »Patriotismus« befallen zu werden, gehört wohl zu den schwersten Flüchen, die ein Volk treffen können.
Aber wenn es einen unechten Patriotismus gibt, so gibt es auch einen echten – den Patriotismus, der ein Land durch edle Taten stärkt und erhebt – der seine Pflicht aufrichtig und mannhaftig erfüllt – der ein ehrliches, mäßiges und wahrhaftiges Leben führt und sich bemüht, die Gelegenheiten zur Vervollkommnung, die sich ihm von jeder Seite darbieten, nach besten Kräften zu benutzen; und gleichzeitig gibt es Patrioten, die das Andenken und Beispiel großer Männer früherer Zeit in Ehren halten, von Männern, die durch ihr Leiden um die Sache der Religion oder der Freiheit unsterblichen Ruhm für sich und für ihr Volk, jene Privilegien freien Lebens und freier Einrichtungen, deren Erbe und Besitzer es ist, errungen haben.
Nationen dürfen ebensowenig wie Individuen nach ihrer meßbaren Größe beurteilt werden. Denn um groß zu sein, bedarf eine Nation nicht einer großen Ausbreitung, obgleich diese Begriffe häufig miteinander verwechselt werden. Eine Nation kann an Land und Bevölkerungszahl sehr ausgedehnt und dennoch ohne wahre Größe sein. Das Volk Israel war klein, doch welch großes Leben entfaltete es und welch gewaltigen Einfluß übte es auf die Geschicke der Menschheit aus. Griechenland war nicht ausgedehnt. Die ganze Bevölkerung Attikas war geringer als die von Süd-Lancashire. Athen zählte weniger Einwohner als New York und doch wie groß war es in Kunst, Literatur, Philosophie und Patriotismus! Aber es war eine verhängnisvolle Schwäche Athens, daß seine Bürger kein wahres Familienleben hatten, während die Freien von den Sklaven an Zahl weit übertroffen wurden. Seine Staatsmänner waren in ihrer Moral lax, wenn nicht gar verderbt. Seine Frauen, auch die gebildetsten, waren sittenlos. So war Athens Fall unvermeidlich, und er erfolgte rascher als der Aufstieg.
Ebenso ist der Verfall und Untergang Roms der allgemeinen Korruption des Volkes und der immer weiter um sich greifenden Vergnügungssucht und Trägheit zuzuschreiben – wurde doch die Arbeit in der letzten Zeit als nur für Sklaven passend angesehen. Seine Bürger rühmten sich nicht mehr der Charaktertugenden ihrer großen Vorfahren, und das Reich ging unter, weil es nicht verdiente, weiter zu leben. Und so müssen die Nationen, die träge und üppig sind – die wie der alte Burton sagt, »lieber in einer einzigen Schlacht ein Pfund Blut, als bei ehrlicher Arbeit einen Tropfen Schweiß vergießen« – unvermeidlich aussterben, und arbeitsamen, energischen Völkern Platz machen.
Als Ludwig XIV. Colbert fragte, wie es käme, daß er als Herrscher über ein so großes und bevölkertes Land wie Frankreich das kleine Holland nicht hätte erobern können, antwortete der Minister: »Sire, weil die Größe eines Landes nicht auf der Ausdehnung seines Gebietes, sondern auf dem Charakter seines Volkes beruht. Es war der Fleiß, die Mäßigkeit und die Energie der Holländer, die sie für Eure Majestät unüberwindlich gemacht haben.«
Von Spinola und Richardet, den Gesandten des Königs von Spanien zur Abschließung eines Vertrages in Haag 1608, wird erzählt, daß sie eines Tages acht oder zehn Leute aus einem kleinen Boote steigen sahen, welche sich im Grase niederließen, um eine Mahlzeit von Brot, Käse und Bier einzunehmen. »Wer sind jene Ankömmlinge?« fragten die Gesandten einen Bauern. »Das sind unsere edlen Herren, die Gesandten der Generalstaaten«, war die Antwort. Spinola flüsterte sofort seinem Gefährten zu: »Wir müssen Frieden schließen, solche Menschen lassen sich nicht besiegen.«
Die Stabilität der Einrichtungen muß auf der Stabilität des Charakters beruhen. Eine Anzahl entarteter Gemeinwesen kann keinen großen Staat bilden. Das Volk kann hochzivilisiert scheinen und doch bei dem ersten Angriff zerfallen. Ohne Untadeligkeit des individuellen Charakters gibt es für einen Staat keine wahre Stärke, keinen inneren Zusammenhang, kein gesundes Leben. Ein Volk kann reich, politisch, künstlerisch bedeutend sein und doch schon am Rande des Verderbens stehen. Ein Volk, in dem jeder nur für sich und sein Vergnügen lebt – wo jedes kleine Ich für einen Gott sich hält – ist schon gerichtet, und sein Untergang ist unabwendbar.
Wo der nationale Charakter nicht mehr aufrecht erhalten wird, da ist die Nation verloren. Wo die Tugenden der Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Unbescholtenheit und Gerechtigkeit nicht mehr geschätzt und geübt werden, da verdient niemand mehr, zu leben. Und wenn ein Land durch Reichtum so verdorben, oder durch Vergnügen so entartet, oder durch Parteiung so verblendet ist, daß Ehre, Ordnung, Gehorsam, Tugend und Treue nur noch der Vergangenheit angehören, wenn dann ja noch vorhandene ehrenhafte Männer im Dunkeln umhertasten, um ihres Gleichen Hände zu fassen, so bleibt als einzige Hoffnung nur noch die Wiederherstellung und Hebung des individuellen Charakters; und wenn der Charakter unwiederbringlich verloren ist, dann ist in der Tat nichts mehr übrig, was erhalten zu werden verdient. ▀Aus Samuel Smiles, Der Charakter, Traktat 1895
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über den Rhythmus
Carl Ludwig Schleich
.
Es ist längst bekannt, welche Rolle die Periodizität im Körperlichen und Geistigen spielt, wie die ganze Summe physischen und psychischen Geschehens in unserem Leibe und unserer Seele in dauernder Abhängigkeit vom Rhythmus ist, von dem wiederum gar nicht anders zu denken ist, als daß er in Harmonie mit dem Welttakte sein muß, um nicht einfach hinweggefegt zu werden vom Schwungrad des Kosmos, wie ein Sonnenstäubchen vom wehenden Atem. Ich will niemand behelligen mit der Aufzählung aller physiologischen und pathologischen Periodizitäten, den Bedingungen des Pulsschlags und der Atmungszahl, den periodischen Sekretionen, Schlaf und Wachsein, Pubertät und Adynamie, Ein- und Ausgabe der Nahrungsmittel, nicht mit der Rhythmik der Schmerzanfälle, der Krämpfe, der Zuckungen, Wallungen und Blutungen, ich will nur verweilen bei dem psycho-physischen Grundgesetz des Rhythmischen auch im menschlichen Leben und will den Mechanismus zu ergründen suchen, auf dem sich auch dieses psycho-physische Geschehen auf einem Widerspiel zwischen Aktion und Hemmung, als dem eigentlichen Grunde der Rhythmik, aufbauen läßt. Ich muß hier bemerken, daß ich alles seelische Geschehen in Abhängigkeit setze von einer Aktion der Nervenströme und einem Hemmungsmechanismus, einer Art periodischer Isolation durch die Neuroglia, bzw. von dem sie durchströmenden Blutsafte, welcher ja nach Ritters Untersuchungen aus Biers Schule in der Tat stromhemmende, Nervenerregungen einbettende Kraft hat. Danach ist es leicht, sich vorzustellen, daß das mit dem Herzpulse einströmende Blut periodisch die Ganglien außer Kontakt setzt und daß die Pause der Herzbewegung diejenige Zeit ist, innerhalb welcher die Ganglien Anschlußfreiheit besitzen. Die Ärzte wissen, welche Rolle Blutmischungsanomalien für die Art der Anschlüsse im Gehirn spielen, wie ein verdünntes, hemmungsarmes Blut naturgemäß zu Erregungen und Unruhen, Ängsten und Wahnvorstellungen und Schmerzempfindungen disponiert; wie Hunger und Krankheit, veränderte innere Sekretion ein ganzes Heer abnormer Nervenstörungen hervorrufen kann. Sie wissen alle, wie die Herausnahme der Schilddrüse unter Überladung des Blutes mit Hemmungssäften, wie bekannt, auch den geistreichsten Menschen zu einem Idioten machen kann. Wir wissen, daß die Nebennieren einen Stoff produzieren, welcher selbst auf peripheren Nerven die allerenergischste Stromausschaltung zuwege bringt, und den Irrenärzten ist bekannt, wie wichtig ein normaler Hemmungsmechanismus für den Bestand der Seele ist.
Es kann keine Frage sein, daß, wenn der Blutsaft die ihm von mir vindizierte Kraft der Ein- und Ausschaltung besitzt, das eigentliche Wesen der Persönlichkeit, das Temperament eine Frage der rhythmischen größeren oder geringeren Reaktionsfähigkeit der Nervenzentren sein muß, daß die Zahl der aufgenommenen Eindrücke and ihre Verarbeitung zu Vorstellungs- und Willensimpulsen in direkter Abhängigkeit von rhythmischen Individualitäten sein muß, die wiederum in Abhängigkeit von der rhythmisch ein- und ausschaltenden Saftfüllung des Gehirns steht. Der alte Volksglaube von dem leichten und schweren Blute findet hier also seine durchaus plausible wissenschaftliche Begründung; das Menschenherz ist nicht nur die grobmechanische Druckpumpe für Blutbewegungen, es spielt in seinen rhythmischen Zuckungen auch für das Nerven- und Gemütsleben eine wichtige, wenn auch bisher noch wenig gewürdigte Rolle. Aber noch in einem ganz anderen Sinne ist die Herzbewegung der eigentliche Manometer der harmonischen Einstellung des Nervenlebens in den Gesamtrhythmus aller Erscheinungen. Schon Ernst v. Baer hat die geistreiche Frage gewagt, wie wohl unsere Wahrnehmungen sich anders gestalten würden, wenn wir nicht, wie jetzt, in einer Sekunde etwa zehn Einzelwahrnehmungen zu apperzipieren fähig wären, in einem Zeitraum, der durchschnittlich genau übereinstimmt mit dem Ablauf eines Herzpulses, und er hat plausibel gemacht, daß schon die Fähigkeit, innerhalb einer Sekunde etwa 30 Beobachtungen machen zu können, uns zwingen würde, das ganze Weltbild anders zu sehen. Wir würden die Flintenkugel als einen Strich, alle Himmelskörper als leuchtende Kreise wahrnehmen können, und würden von jedem Sinne her der Welt als total anders erkennende Wesen gegenüberstehen. Wir können jetzt hinzufügen, daß wir schon mit bloßem Auge die festen Gegenstände nicht mehr als fest bezeichnen könnten, sondern daß wir etwas von ihrer innerlichen, rasenden Bewegung wahrzunehmen vermöchten. Wir sind also mit unserm rhythmischen Spiel von Puls- und Nervenaktion einerseits und Sinneseindrücken andererseits so in den Rhythmus des Ganzen eingestellt, daß unser Harmoniegefühl direkt abhängig ist von diesem rhythmischen Maß unserer Wahrnehmung in Sekunden. Natürlich erklärt sich auf diese Weise am einfachsten das »Zeitliche« im Begriff alles Rhythmischen. Zeit ist eben die mit dem Maß unseres eigenen rhythmischen Wahrnehmens gemessene und empfundene Bewegung des Alls. Das führt uns direkt zu einem Verständnis des Ästhetischen.
Wir haben nur von denjenigen Rhythmen der Außenwelt den Eindruck des Lebenfördernden, Erhebenden, Daseinsteigernden, welche sich dem Rhythmus unserer inneren Aktionen harmonisch einfügen, richtiger, sofern wir sie in uns harmonisch zu verschmelzen imstande sind. Daseinsteigernd im ästhetischen Sinne sind eben nur diejenigen Rhythmen, welche unserm persönlichen Sinnesrhythmus synchron zu verbinden sind bzw. ihn ohne Widerstand und Disharmonie zu erhöhen imstande sind.
Das schließt nicht aus, daß auch der Konflikt der Rhythmen außer uns mit denen in uns als Kontrastempfindung nach vollzogenem Ausgleich lusterhöhend, doch nur indirekt wirken kann, aber im allgemeinen ist zu einer ästhetischen Freude die Einfügung der lusterweckenden Rhythmen in den Rhythmus unserer Nervenströme unerläßlich. Insofern hat alles deutlich erkennbar Rhythmische einen erheiternden, erhebenden, freudewirkenden Einfluß, überall besteht ein geheimes Verhältnis seiner Schwingungszahl zur Schwingungszahl unserer Nervensubstanz, mag das nun an einer schöngeschwungenen Linie, an einem Akkord, an einer Farbengebung, an einem Wohlgeruch oder an einem Hautgefühl sich betätigen. Die Rhythmen der schönen Dinge müssen einfügbar sein in die Rhythmen unserer Sinnesschwingungen, um ästhetisch zu wirken, das ist das Grundgesetz der Kunst, so variabel für den einzelnen, weil eben diese innenwirkende Schwingungszahl eine durchaus persönliche Gleichung ist. Ist in diesem Verhältnis doch auch der eminente Einfluß alles Rhythmischen, seine suggestive Übertragbarkeit begründet. Der Redner, der Dichter, der Schauspieler reißt mich darum in seinen Bann, weil dem Schwungrad seiner Begeisterung alle meine Seelenräder sich im geheimen Gleichtakt einstellen, und ich bin im Bann eines jeden Menschen, dessen seelische Schwingungen mich gleichsinnig zu bewegen imstande sind. Die ganze Macht der Imitation, ja der Ähnlichkeiten, beruht auf diesem Einstellungsverhältnis zwischen Außenwirkung und Innenbewegung. Und fragen wir, auf welchem Wege diese Rhythmusakkomodation sich abspielt, so gibt es nur einen erkennbaren Weg des Ausgleiches zwischen Wahrnehmung und innerer Anpassung, der ist die Marconiplatte des Nervus Sympathicus, dessen enormen und oft blitzartigen Einfluß auf Herzbewegungen und Gefäßspannungen die Ärzte lange kennen. Hat aber die Herzbewegung Einfluß auf unsere Ein- und Ausschaltungen im zentralen Nervengebiet, so ist der Kontaktkreis geschlossen: der sympathische Außenweltrhythmus erhält seine rhythmische Konsonanz im Innern. Die Vorgänge sind also viel mechanischer, als man gemeinhin anzunehmen geneigt ist. Ein zündendes Wort, eine schlagende Formel, eine leuchtende Wahrheit hat oft die Kraft, unser ganzes Innere blitzartig zu erhellen, weil sie Spannkraft genug hat, die schlummernden Wellen unserer Seele mit rhythmischem Lichte zu durchbrausen. Dem metrischen, schön gefügten Wortreiz liegt oft eine verborgene Harmonie zu unserem Atmungsrhythmus zugrunde, und es wäre eine dankbare Untersuchung, festzustellen, wie aus den möglichen Atmungsvarianten sich die Versmaße herleiten lassen. Ist doch nicht, wie Bücher meint, die Arbeit der Vater des Rhythmus und der Musik, sondern ist doch vielmehr der Rhythmus der Arbeit mit dem typischen Niederschlag des Hammers in der Exspirationspause, also beim Ausatmen, und das Ausholen beim Einatmen eben die direkte Folge des Atmungsrhythmus, so daß dieser selbst für Melodie und Rhythmus des Gesanges den Ursprung bedeutet. Rhythmus und Arbeit sind beides nur Funktionäre unserer Atmungsmechanik, die Cäsuren einer Melodie sind ursprünglich die naturgemäßen Pausen zum Atemholen.
Wir wissen, daß es Schwingungen der Luftwellen gibt, welche von einer solchen rhythmischen Schnelligkeit sind, daß wir sie mit dem Ohre allein nicht wahrnehmen können. Wir hören nicht mehr das Geigenspiel gewisser Zikadenarten, trotzdem es mit Kunsthilfe wahrnehmbar und berechenbar ist, ähnliches mag bei vielen anderen Sinneswahrnehmungen der Fall sein, so daß schon aus diesen Tatsachen der Satz sich herleiten läßt, der Rhythmus unserer Nervenschwingungen übermittelt uns nur einen Teil der Weltallsrhythmen, und dieses Verhältnis läßt uns die Möglichkeit nicht von der Hand weisen, daß es Menschen mit einer Feinheit der Sinnesrhythmen geben mag, welche mehr Dinge wahrnehmen, als der Durchschnitt. – Haben wir bisher im wesentlichen die rhythmischen Wogen betrachtet, welche von den brausenden, chaotischen Kraftwellen stammen, die die Außenwelt gegen die seelischen Gestade wirft in nimmer ruhendem, vom Weltallsodem gepeitschtem Wogenspiel, so bleibt uns noch übrig, dem rhythmischen Hin- und Hergleiten der inneren, scheinbar aus eigenem Herd geborenen, summenden und kreisenden Nervenspindeln zu lauschen. War schon der Mensch als organisches Wesen in seiner Gesamtheit aufzufassen als ein System rhythmischer Durchflutungen für sich, abgetrennt vom Kraftspiel der anorganischen Masse, so ist noch viel mehr seine Seele eine für sich und vielleicht einzig dastehende, still verschlossene Kammer wunderbaren rhythmischen Spiels, die ihn in eigener Weise befähigt, mit den Eindrücken der Außenwelt innen frei zu schalten und zu walten. Haben nicht auch diese seine der Phantasie zugeborenen Tätigkeiten ihre offenbare, zwingende Beziehung zur Rhythmik? Ist nicht eigentlich die Phantasie die Gabe, sich mit allen seinen Gedanken in den Rhythmus des Andern außer uns, sei es Mensch, Tier, Pflanze oder ein Unbelebtes, selbst ein Gedachtes, hineinzuversetzen? Wo wäre der Künstler, der einen Gegenstand voll und überzeugend darzustellen vermöchte, wenn er nicht zuvor völlig eins geworden wäre mit dem Rhythmus und der Wesensart des Darzustellenden, der nicht aufjauchzte, wenn er sein eigenes inneres Empfinden, die Schwingungen des persönlichen Ichs verschmelzen fühlt mit dem erschauten Objekt? Das ist aber nur möglich, wenn er gleichschwingend den Einklang fühlt, in dem der Rhythmus des Gegenstandes mit der eigenen inneren Rhythmik verschmilzt. Sich »hineinversetzen« heißt doch nichts anderes, als sich das Gefühl des Anderen und sei es eines Gegenstandes einzuverleiben mit Hilfe der Phantasie und so selbst Lebloses mit dem Strom des eigenen Lebens betrachtend zu erfüllen. Wehe dem Künstler, der nicht rhythmisch verschmilzt mit dem Objekt, das er darstellen will: er muß ein Stein sein können, wenn er ihn malt, eine Blume, wenn er ihres Kelches Schönheit herbeizaubern will, ein Kind, wenn er sprechen will, wie Kinder sprechen, und eine Wolke, wenn er mit ihr seine Lieder wandern lassen will. Der echte Künstler steckt in Woge und Wald, die er malt, ist König und Bettler, wenn er sie darstellt, hat ihren Stolz und ihren Hunger, trägt ihren Szepter und ihren Bettelstab.
Wie reich macht doch die Phantasie, indem sie den Verwandlungsmantel über unsere Seele legt, so daß schlechterdings nichts unerreichbar wird! Aber auch der Wissenschaftler, der Entdecker und der Erfinder wird niemals zu neuen Offenbarungen gelangen, wenn nicht die Intensität seines Einfühlens in die Materie ihn befähigt, den Rhythmus des zu Schauenden bis zu dem geheimen Motor der kreisenden Atome zu erfassen und das Geschaute auch anderen, weniger Einfühlungsfähigen zu übermitteln. Wo wäre der Redner, der Erzieher, der Prophet, der wirken könnte ohne diese rhythmische Durchdringung seiner Lauscher, ohne die Fähigkeit Strudel der innersten Bewegung zu erzeugen, in welchen Zweifel, Furcht, Eigenliebe versinken, wie Holzstückchen in den gurgelnden Schlund! Wie wäre eine Ethik denkbar, die sich nicht den Rhythmus des höherstehenden, anbetungswürdigen Ideals zu eigen machte, das uns die Phantasie als lockendes Ziel eines königlichen Gefühls der inneren Harmonie vorhält?
Wie könnte man Liebe erwecken, wenn nicht ein Gleichstrom siegenden Wollens die Geliebte mit berauschendem Wort in den Feuerstrom entfesselter Leidenschaften hineinrisse?
Ich bin am Ende meiner Ausführungen. Wollte ich alle Beziehungen des Rhythmischen zur Seele auch nur aufzählen, so würde wohl kaum ein Gebiet seelischer Aktionen unerwähnt bleiben. Ich muß mich mit diesen kurzen Andeutungen begnügen. Der Rhythmus ist der Allbeherrscher alles physischen und psychischen Geschehens. Der Puls des Universums schlägt in allem, was ist und lebt. Das Gehirn der Menschen ist ein Gestade nur, das er mit ewigem Wellenliede umrauscht, eine Harfe nur, auf der er seine Sonnenlieder und Schattenklagen singt, ein Prisma nur, durch das seine hellen und dunklen Lichtwellen zitternd jagen und das, vielgestaltig und zu buntem Strahlenbüschel zerstreut, den umgeformten Rhythmus wieder in das All zurücksendet. War Rhythmus der Pendelschlag von Kraft und Hemmung, so ist die Seele ein diesem Pendelspiel spezifisch eingeschalteter, organischer Widerstand. Nicht die Lebenskraft ist das Besondere, der Kraft kann noch unendlich viel Wunderbareres vorbehalten sein als der Menschengeist, – sondern die eigentümliche Hemmung, die die Weltkraft zwingt, sich in uns so rätselhaft zu spalten, ist der Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung. Wo sich die Weltkraft entzündet an der atomistischen Reibefläche des Organischen, da blitzt das Leben auf und erlischt wie der Meteorstein, der aufglüht, wenn sein Sturz ins Chaos hineingerät in die sausenden Rhythmen der irdischen Atmosphäre. ■Aus Carl Ludwig Schleich, der Rhythmus, in: Von der Seele, Essay 1922
Zitat der Woche
.
Von der Bedeutung der Naturwissenschaften an den Universitäten
Wilhelm Maximilian Wundt
.
Die Erneuerung unsrer Hochschulbildung, die sich im 18. Jahrhundert vorbereitet und im 19. vollzogen hat, beruht auf dem jetzt erst endgültig eingetretenen Bruch mit dem schulmäßigen Lehrbetrieb. Und dieser Bruch ist auf das engste gebunden an die von nun an mit unwiderstehlicher Macht sich durchsetzende Verbindung von Lehre und Forschung. Nicht die Erneuerung des Lehrstoffs und nicht die ohnehin nur teilweise durch sie bedingte veränderte Lehrform hat die Scholastik endgültig von unseren Hochschulen verbannt, sondern die Umwandlung dieser selbst aus höheren Schulen im buchstäblichen Sinne des Wortes in Anstalten, die der wissenschaftlichen Arbeit in der doppelten Form der Forschung und der Lehre gewidmet sind. Noch war im 18. Jahrhundert im allgemeinen die Forschung eine private Nebenbeschäftigung des Lehrers gewesen, zu der er dann allmählich wohl auch die Tüchtigeren unter seinen Studenten heranzog. So sind neben den mehr praktisch gerichteten Übungen der Theologen schon im Laufe des 18. Jahrhunderts in Göttingen und Halle philologische Seminarien entstanden. Bei uns wurde ein solches jetzt vor hundert Jahren bei dem vierhundertjährigen Jubiläum der Universität eröffnet, und es mochte als ein glückliches Vorzeichen gelten, daß der jugendliche Gottfried Hermann das neue Institut mit einer in klassischem Latein gedichteten Kantate begrüßte.
Die Hauptschwierigkeit, die dem für die neue Verbindung von Lehre und Forschung unentbehrlichen Fortschritt dieser Gründungen im Wege stand, bereiteten jedoch zunächst die Gebiete, die in der Bedeutung ihrer Institute und in dem Aufwand ihrer Mittel ihre bescheidenen philologischen Vorläufer heute weit überflügelt haben: die Naturwissenschaften. Die späte Aufnahme ihrer praktischen Hilfsmittel in den Lehrbetrieb der Universitäten hängt mit der Art, wie von diesen überhaupt die neue Naturwissenschaft aufgenommen worden war, auf das engste zusammen. Wohl hatte sich die die Scholastik verdrängende neuere Philosophie auf der Grundlage der neuen Naturwissenschaft entwickelt. Eingang bei den Universitäten fanden aber die Naturwissenschaften selbst zuerst in der Form der aus ihnen hervorgegangenen Philosophie. Das war bei der Art des von den Zeiten der Scholastik her noch immer herrschenden Lehrbetriebs begreiflich genug. Die Universitäten waren und blieben ja Lehrinstitute, höhere Schulen, nichts weiter. Wenn der Professor für sich physikalische oder chemische Experimente machte, so lag das außerhalb seines Lehrberufs. Dieser blieb in der Naturwissenschaft und zumeist selbst in der Medizin ein rein theoretischer, ganz wie er es zur Zeit der Herrschaft der Aristotelischen Physik gewesen war. Selbst der Anatom tat ein Übriges, wenn er etwa einmal im Semester die Lage der Eingeweide seinen Zuhörern demonstrierte. Da war es denn immerhin ein großer Schritt vorwärts, daß die neue Philosophie wenigstens zu ihrem Teil in die naturwissenschaftlichen Anschauungen, von denen sie durchdrungen war, einführte. So kam es, daß besonders die allgemeineren Naturwissenschaften lange noch von Professoren der Philosophie vorgetragen wurden, die dann freilich in der Universalität ihrer Bestrebungen auch bis zu ganz konkreten technischen Gebieten, die später überhaupt von der Hochschule verschwanden, herabstiegen. Christian Wolff und seine Schüler lasen daher gelegentlich über Baukunst, Kriegskunst, Nautik ebensogut wie über Physik und über Mechanik. Dieser Zustand war nur möglich, weil doch ein gutes Stück scholastischer Tradition in der Lehrform immer noch weiterlebte, vornehmlich aber, weil die Aufgabe, die sich die Hochschule gestellt, die einer eigentlichen Schule noch nicht überschritten hatte. Hierfür ist es bezeichnend, daß die Initiative zur Gründung von Arbeitsstätten naturwissenschaftlicher Forschung zunächst überhaupt nicht von den Universitäten ausging, sondern von den Fürsten und ihren Räten. Wohl mochten es nicht immer wissenschaftliche Interessen sein, die in solchen von oben kommenden Anregungen zum Ausdruck kamen. Die Experimente mit Elektrisiermaschine und Luftpumpe waren beliebte Vorführungen, mit denen vom 17. Jahrhundert an wandernde Künstler die Hofgesellschaften unterhielten. Begreiflich daher, daß man in diesen Kreisen wünschte, die Universitäten möchten ihnen in der Pflege dieser Gebiete, die ihnen interessanter waren als Cicero oder Virgil, zu Willen sein. So regte Kurfürst August der Starke schon um das Jahr 1710 nicht nur die Gründung einer Sternwarte in Leipzig an, sondern er veranlaßte auch die Anstellung eines besonderen Professors der Physik, von dem er wünschte, daß er mit dem nötigen Instrumentarium ausgestattet werde. Die Universität aber stand diesen Anforderungen ziemlich ablehnend gegenüber. Eine Sternwarte, meinte man, sei eine überflüssige Zierde; und dem Professor der Physik überließ man es, sich, wenn er wollte, seine Apparate selbst anzuschaffen oder aus der Hinterlassenschaft seines Vorgängers zu erwerben. Noch schlimmer urteilte man über die Errichtung chemischer Laboratorien, über die ein Gutachten aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts sich äußerte, sie seien nicht bloß überflüssig, sondern durch den Geruch, den sie verbreiteten, lästig, und durch die giftigen Stoffe, mit denen die Chemiker umgingen, gesundheitsgefährlich.
Wenn man daher nach der Bedeutung, die heute die naturwissenschaftlichen Laboratorien und die mannigfachen, gleichzeitig der praktischen Unterweisung und der wissenschaftlichen Forschung dienenden medizinischen Institute für unsere Universitäten besitzen, vermuten könnte, es sei von Anfang an der für den Wohlstand der Nation wie der Einzelnen unschätzbare Nutzen dieser Anstalten gewesen, der ihre Gründung veranlaßt habe, so würde diese Annahme ein großer historischer Irrtum sein. Eine theoretische Wahrheit kann zuweilen sofort einleuchten. Die ungeheuren praktischen Folgen, die eine Umwälzung wissenschaftlicher Methoden mit sich führt, werden erfahrungsgemäß immer erst erkannt, nachdem diese Folgen selbst mindestens teilweise schon eingetreten sind. So war es denn auch eine solchen praktischen Erwägungen völlig ferne liegende reformatorische Idee pädagogischer Art, die hier aus den Bildungsbestrebungen des 18. Jahrhunderts und den am Ende des Jahrhunderts mächtig sich regenden neuen Erziehungsidealen als letzte Frucht hervorging. Schon Kant hatte in seinem “Streit der Fakultäten” die Anwendung dieser Ideale auf die Hochschulbildung gestreift. Ihren energischen Ausdruck fand sie aber erst in dem Zukunftsprogramm der neuen Philosophie, die im Bunde mit der um die Wende der Jahrhunderte auftretenden romantischen Geistesströmung hervortrat, und die auf eine neue, engere Verbindung von Kunst, Wissenschaft und Leben hindrängte. Hier war es allen voran Fichte, der seine Stimme laut für diese neue Botschaft erhob. In der Entfremdung vom Leben und von den praktischen Bedürfnissen der Zeit erkannte er den schwersten Schaden der seitherigen Wissenschaft und besonders auch der seitherigen Hochschulbildung. Doch in dem wunderbaren Wechselspiel geistiger Kräfte, das solchen Übergangszeiten eigen ist, hat die gleiche Erneuerung der Philosophie, von der diese reformatorische Idee ausging, nicht minder durch den Konflikt, den sie sehr bald zwischen der Philosophie und den positiven Wissenschaften, besonders den Naturwissenschaften, heraufbeschwor, jene Entwicklung begünstigt, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts der Naturwissenschaft allmählich die führende Rolle an den deutschen Universitäten verschaffte. ■Aus Wilhelm Maximilian Wundt: Festrede zur fünfhundertjährigen Jubelfeier der Unversität Leipzig, Wilhelm Enegelmann Verlag 1909
.
.
Bösel/Pudill/Schäfer (Hg): «Denken im Affekt»
.
Denken ohne Effekt
Michael Magercord
.
 Denken und Affekt wollen im Abendland nicht mehr zusammenkommen. Doch sollten diese beiden grundlegenden menschliche Regungen nicht letztlich immer zusammen betrachtet werden? Gehören sie nicht sogar zusammen?
Denken und Affekt wollen im Abendland nicht mehr zusammenkommen. Doch sollten diese beiden grundlegenden menschliche Regungen nicht letztlich immer zusammen betrachtet werden? Gehören sie nicht sogar zusammen?
Dies jedenfalls meinen die jungen Wiener Philosophen, die sich als Autoren des Bandes «Denken im Affekt» zusammengefunden haben. Ihre Abhandlungen sind recht unterschiedlich gestaltet: von der theoretischen Herleitung der eigenen Überzeugung über die Aussagen früherer Philosophen bis zum Versuch, sich schreibend dem gedanklichen Affekt auszusetzen, reicht die textliche Herangehensweise an das Titelthema.
Die Erkenntnis, dass Gefühle in unserer rationalen abendländischen, ja kartensischen Welt eher – wie es im Buch heißt – «infantilisiert» werden, ist nicht neu, sie begleitet die Aufklärungskritik schon seit ihrem Beginn. Doch unbeirrt schreibt Mitherausgeber Bernd Bösel im Vorwort: «Wir brauchen eine Philosophie, die es wagt, im Affekt zu denken.»
Aber wozu? Philosophische Texte sollten nach Möglichkeit mehr sein, als eine bloße Wiedergabe schon erkannten. Und tatsächlich soll das neuentdeckte Denken im Affekt nach der Vorstellung der Autoren zu etwas führen, nämlich zu einer neuen Subjektsouveränität im Umgang mit dem Affekt – und demnach eben auch mit dem Denken. Auch ein Philosoph will von seinen eigene Ideen überfallen werden, heißt es weiter im Buch.
Einige der Autoren – wagemutig sind sie, sich darauf einzulassen, das immerhin sollte man ihnen zugestehen – lassen sich von ihren vermeintlich affektösen Gedanken leiten und schreiben im Selbstversuch munter drauf los. Doch den hohen Anspruch kann der Affekt nicht einlösen. Die textlichen Versuche in diesem Buch scheitern kläglich daran beides, Affekt und Denken, schreibend zu etwas Weiterführendem zu verbinden. Mehr als ein paar nette Sätze kommen dabei nicht hinaus. Und dem leidigen Leib-Seele-Problem dadurch beizukommen, dass man das ganze dann als «Textkörper» bezeichnet, erscheint doch eher als semantischer Schnickschnack. Oder ist hier die Philosophie als Therapie gemeint? Dann ist die Frage erlaubt, wie diese Schreibereien nun die Souveränität über sein Selbst fördern sollen.
Vielleicht hätten die Autoren ihren Blick eher auf außereuropäische Denktraditionen lenken und vor allem den oralen Kulturen Gehör schenken sollen. Es gibt dazu bereits hoffnungsvolle Versuche, sich über philososophische Betrachtungen diese unverschrifteten Denkweisen für die Aufklärungskritik nutzbar zu machen. Zu erinnern gilt es hier an die Werke von Mamoussé Diagne sowie die Untersuchungen von Cheikh Moctar Ba, die beide am Lehrstuhl für afrikanische Philosophie an der Universität Dakar im Senegal lehren.
Und doch: Die Autoren und ihr Buch berührt immerhin einen tatsächlichen Mangel im abendländischen Umgang mit dem Gefühl oder dem Denken, dass darin verhaftet ist. Es ist nur der falsche Hebel, an dem sich die Texte abmühen. Denn es wurde ja vermutlich noch nie soviel über Gefühle im öffentlichen Raum dahergelabert, wie heute im medialen Raum, worin man dann allerdings von «Emotionen» spricht. Und doch lässt sich ein eklatantes Fehlen einer wirklichen Diskursfähigkeit über Gefühle im politischen und gesellschaftlichen Raum konstatieren, wie in Deutschland die Auseinandersetzung um das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 gezeigt hat:

Das Buch «Denken im Affekt» spricht ein wichtiges Thema an, schreibt aber an ihm vorbei. Es bleibt zu hoffen, dass dieses nur ein Anfang ist, eine Schreibübung vielleicht, woraus sich in Zukunft mehr entwickelt – denn die Behandlung des Themas vor allem im politischen und gesellschaftlichen Raum ist dringender denn je. So aber wie bislang in diesem Buch kommt man in dem Bemühen nicht weiter.
Zur Schlichtung der Gemüter über umstrittenen Bahnhofsneubau wurde etliche Gesprächsrunden mit Experten aller Art und von allen Seiten veranstaltet, die als «Schlichtung» bekannt geworden sind. Alle Aspekte wurden darin debattiert, von den Taktzeiten der S-Bahn bei unterschiedlichen Gleislängen und Gleiszahlen bis hin zur Dichte und Grundwasserführung des Gipskeupers bei Tunnelbohrungen. Aber es fiel darin kein Wort über den vielleicht wichtigsten Anlass, aus dem heraus sich soviele Menschen gegen den Bau des Megaprojektes gewandt hatten: Denn es ist wohl die komplette Veränderung des Lebensumfeldes, die mit dem Bau einhergeht, die das Unbehagen auslöst. Die affektierte Verbundenheit mit dem alten Bahnhof oder die Unlust, in Zukunft nur noch unterirdisch in einem Shopping-Centre anzukommen anstatt in der gewohnten Umgebung sind zwei Dinge, die bei der Schlichtung nicht angesprochen worden sind, weil es vermutlch dafür keine Sprache gibt in einer ach so sachlichen Entscheidung über Infrastrukturprojekte. Oder anders ausgedrückt: Aus dem Volk der Dichter und Denker wurden die Schlichter und Rechner.
Doch gerade diese Auseinandersetzung, die nun sogar den Ausgang der Landtagswahlen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg bestimmt hat, zeigt dass Gefühle im politischen Raum nicht notgedrungen mit irrationalen Ängsten gleichbedeutend sind, etwa vor Fremdartigen und Andersgläubigen, wie immer gegen jede Rücksichtnahme auf derartige Affekte ins Feld geführt wird. Doch dabei ist es erst diese Negation der berechtigten Gefühle in den politischen und gesellschaftlichen Prozessen, die diese Ängste sogar meist zu erzeugen.
Nein, nicht am Ausdrücken von Gefühlen und dem Denken in – nennen wir es also nochmals neudeutsch: Emotionen fehlt es. Aber es hakt beim Diskurs über sie, sowie an der Rücksichtnahme im politischen Raum auf sie und ihrer Einbeziehung in die entsprechenden Entscheidungen. Das zu beheben, bedürfte es aber gerade einer analytischen Betrachtung auf Gefühltes und Gedachtes, doch dazu leisten die in diesem Sammelband erschienenen theoretischen Texte und Textversuche leider keinen Beitrag. Sie sind nur eine Wiederholung der Aufklärungskritik, die so alt ist wie das aufklärerische Denken selbst. Das Glücksgefühl der weiterführenden Erkenntnis vermittelt dieser Band jedenfalls nicht. ●
Bernd Bösel / Eva Pudill / Elisabeth Schäfer (Hg): Denken im Affekt, Passagen Verlag Wien, 188 Seiten, ISBN 9783851659566
.
.
.
Das neue 50-Euro-Literatur-Preisrätsel
.
Wer bin ich?
Im Glarean Magazin findet sich regelmäßig ein neues 50-Euro-Preisrätsel.
Die neueste Aufgabe richtet sich an die Literatur-Kenner unter den Lesern.
Wer zuerst die komplette Lösung des Rätsels präsentiert, erhält wie immer 50 Euro.
Einsende-Schluss für das nachstehende Preisrätsel ist am 29. März 2011 (24 Uhr).
Für die Einsendung der Lösung ist die «Kommentar»-Funktion zu benützen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. – Viel Spaß und Erfolg! – –
.
 Für mein Gesamt-Oeuvre, das nicht nur zahlreiche epische und lyrische, sondern auch viele Werke der Malerei, ja sogar der Musik umfasst, hat mich die Kulturwelt mannigfach geehrt. Bereits während meiner Studentenzeit in England reifte in mir ein Leitgedanke heran, der später zum zentralen Thema meines ganzen Schaffens wurde: jener der intellektuellen Toleranz und des geistigen Brückenschlages zwischen politisch heterogenen Systemen. Mein philosophischer Idealismus, meine ebenso sehnsüchtige wie tröstliche Gottessuche, aber auch meine literarisch intensiv bewältigte Trauer über die menschliche Unvollkommenheit verbunden mit einem bilderreichen poetischen Mystizismus fanden dabei nicht nur international größte Beachtung, sondern führte in meiner Heimat fast zu einem Kultstatus meiner Person. – Also: Wer bin ich? ■
Für mein Gesamt-Oeuvre, das nicht nur zahlreiche epische und lyrische, sondern auch viele Werke der Malerei, ja sogar der Musik umfasst, hat mich die Kulturwelt mannigfach geehrt. Bereits während meiner Studentenzeit in England reifte in mir ein Leitgedanke heran, der später zum zentralen Thema meines ganzen Schaffens wurde: jener der intellektuellen Toleranz und des geistigen Brückenschlages zwischen politisch heterogenen Systemen. Mein philosophischer Idealismus, meine ebenso sehnsüchtige wie tröstliche Gottessuche, aber auch meine literarisch intensiv bewältigte Trauer über die menschliche Unvollkommenheit verbunden mit einem bilderreichen poetischen Mystizismus fanden dabei nicht nur international größte Beachtung, sondern führte in meiner Heimat fast zu einem Kultstatus meiner Person. – Also: Wer bin ich? ■
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über die Philosophie
Rudolf Christoph Eucken
.
Daß die Philosophie nicht nur voller Probleme, daß sie auch als Ganzes ein Problem ist und ein Problem bleibt, das zeigt schon die verschiedene Schätzung und die umstrittene Stellung, die ihr das menschliche Leben gibt. Einerseits heißt sie die Königin der Wissenschaften, und ein ihr geweihtes Leben dünkt die Höhe des menschlichen Daseins, Geister allerersten Ranges bemühten sich, ihr zu dienen, und in den Gesamtstand der Menschheit griff sie oft mit mächtiger Wirkung ein. Dabei zeigte dies Wirken mannigfachste Verzweigung. Bald entrang die Philosophie, wie bei Plato, dem trüben Gemenge des Alltags hohe Ideale und hielt sie dem Streben als feste Richtsterne vor, bald suchte sie, nach Aristoteles’ Art, allen Reichtum der Wirklichkeit in ein Ganzes zu fassen und das Leben gleichmäßig zu durchgliedern, bald auch war sie ein sicherer Halt und schließlich ein Trost gegen alle Sorgen und Nöte, so im späteren Altertum, dann wieder wirkte sie, wie in der Neuzeit, zur Befreiung der Geister und als eine Leuchte aufsteigender Kultur, zugleich vollzog sie eine gründliche Prüfung des überkommenen Lebensstandes und suchte sie die Menschheit über die Grenzen ihres Vermögens gewissenhaft aufzuklären. Alles Große bedurfte ihrer Hilfe und Mitarbeit; wo immer sie fehlte, da verlor das Leben an Ursprünglichkeit, an Freiheit, an Tiefe. In diesem Gedankengange erscheint die Philosophie als ein unentbehrliches Hauptstück des geistigen Besitzes der Menschheit.
Aber zugleich zeigt jeder Überblick der Erfahrung, daß ihr zu allen Zeiten zahlreiche Gegner erwuchsen, die sie für überflüssig erklärten, ja als schädlich verwarfen. So der Spezialforscher, der mit seiner Verteilung der Welt in einzelne Gebiete sein Werk abschließt, so der Praktiker, dem ihr Mühen und Grübeln eine Hemmung frischen und freudigen Handelns dünkt, so auch manche Anhänger der Religion, die von ihr eine Erschütterung des Glaubens und ein Übermaß menschlichen Selbstvertrauens befürchten. Gefährlicher aber als alle Bekämpfung von außenher ist die Unsicherheit der Philosophie bei sich selbst, das Auseinandergehen ihrer Arbeit, ihre Spaltung in verschiedene Sekten, deren jede, um sich selbst zu behaupten, alle übrigen glaubt vernichten zu müssen. Dieser Streit droht ohne Abschluß und ohne Ergebnis zu bleiben, er scheint im Laufe der Jahrhunderte eher zu wachsen als abzunehmen. Denn ob die Sophisten mit ihrem Subjektivismus oder Sokrates mit seiner Begriffslehre im Rechte waren, ob das höchste Gut auf dem Wege der Stoa oder auf dem Epikurs zu suchen sei, das steht noch immer in Frage. Wohl verließen die handelnden Personen selbst den Schauplatz, aber ihre Ideale blieben und setzten den Kampf mit unverminderter Leidenschaft fort, wie die Geister auf den katalaunischen Feldern. Von hier aus bleibt unverständlich, wie die Philosophie einen tiefen Einfluß auf das Denken und Leben zu gewinnen vermochte; liegt ein solcher Einfluß als eine unbestreitbare Tatsache vor, so stehen wir vor einem Rätsel, und es treibt mit Notwendigkeit dazu, uns über die Aufgabe wie die Stellung der Philosophie zu orientieren.
Jenen Widerspruch hat man wohl durch eine Fassung der Philosophie zu heben versucht, die sie allen annehmbar machen sollte; die Frage ist nur, ob sie dabei eine Selbständigkeit und einen Wert bewahren kann. Früher sowie heute wird oft der Philosophie kein anderes Ziel gesteckt als das, die Arbeit der einzelnen Wissenschaften zusammenzufügen, ihre Leistungen in ein Gesamtbild zu fassen; je weiter die Forschung sich verzweige, so heißt es, desto nötiger sei eine besondere Disziplin, welche für den Zusammenhang der Zweige sorge; indem die Philosophie als eine solche sowohl die Voraussetzungen, als die Methoden, als die Hauptergebnisse der Einzelwissenschaften überschaue und vergleiche, gewinne sie eine wichtige und unverwerfliche Aufgabe. Eine Aufgabe ist hier unverkennbar, aber jeder Versuch einer genaueren Fassung erzeugt Verwicklungen und treibt die Geister auseinander.
Wie ist jene überschauende und verbindende Tätigkeit zu denken? Bleibt sie ganz an den übermittelten Stand des Wissens gebunden, hat sie keinerlei Recht, von sich aus zu prüfen und weiterzubilden, so ist sie freilich aller Gefahr entronnen, aber mit der Gefahr hat sie auch alle eigentümliche Bedeutung eingebüßt. Denn bei solcher Beschränkung ist sie nicht mehr als ein Registrieren der Ergebnisse der Fachwissenschaften, eine bloße Enzyklopädie, die ein liberaler Sprachgebrauch Wissenschaft nennen mag, die aber damit noch nicht eine selbständige Wissenschaft wird. Auch ist nicht zu verstehen, wie von einer solchen Enzyklopädie eine so tiefe Erschütterung und eine so fruchtbare Weiterbildung des Denkens und Lebens ausgehen konnte, wie sie doch, denken wir nur an Plato und an Kant, von der Philosophie tatsächlich ausgegangen sind. Und wie soll es gehalten werden, wenn die einzelnen Wissenschaften sich nicht ohne weiteres zusammenschließen, wenn schroffe Konflikte entstehen, wenn zum Beispiel das eine Gebiet ebenso entschieden eine mechanische Kausalität verficht, wie das andere auf einer Freiheit des Handelns besteht? Soll die Philosophie einen derartigen Widerspruch ruhig ertragen und willig hinnehmen? ■Aus Rudolf Christoph Eucken, Einführung in die Hauptfragen der Philosophie (1911)
.
.
Das Zitat der Woche
.
Von der Seele der Pflanze
Gustav Theodor Fechner
.
Die ursprüngliche Natur-Ansicht der Völker, sowie der charakteristische und ästhetische Eindruck, den uns die Pflanzen unmittelbar machen, spricht viel mehr für die Seele der Pflanzen, als die unter uns herrschende, auf anerzogenen Vorstellungen beruhende Volksansicht gegen dieselbe.
Die Pflanzen sind uns zwar im ganzen unähnlicher als die Tiere, Stimmen doch aber gerade in den Hauptgrundzügen des Lebens noch mit uns und den Tieren so überein, daß wir, wenn auch auf einen großen Unterschied in der Art der Beseelung zwischen ihnen und uns, doch nicht auf den Grundunterschied von Beseelung und Nichtbeseelung selbst zu schließen berechtigt sind. Im Allgemeinen findet ein solches Verhältnis der Ergänzung beiderseits statt, daß das Seelenleben der Pflanzen Lücken ausfüllt, welche das der Menschen und Tiere lassen würde.
Daß die Pflanzen weder Nerven noch ähnliche Sinnesorgane zur Empfindung haben wie die Tiere, beweist doch nichts gegen ihr Empfinden, da sie auch anderes, wozu das Tier der Nerven und besonders gearteter Organe bedarf, ohne Nerven und ähnliche Organe nur in anderer Form zu leisten vermögen; überhaupt aber der Schluß, daß die besondere Form der tierischen Nerven und Sinnesorgane zur Empfindung nötig sei, auf unhaltbaren Gründen beruht.
Die gesamte teleologische Betrachtung der Natur gestaltet sich viel befriedigender, wenn man den Pflanzen Seele beimißt, als wenn man sie ihnen abspricht, indem eine große Menge Verhältnisse und Einrichtungen in der Natur hierdurch eine lebendige und inhaltsvolle Bedeutung gewinnen, die sonst tot und müßig liegen oder als leere Spielerei erscheinen.
Daß das Pflanzenreich den Zwecken des Menschen- und Tierreichs dient, kann doch nicht gegen darin waltende Selbstzwecke sprechen, da in der Natur sich der Dienst für andere und für eigene Zwecke überhaupt nicht unverträglich zeigt, auch das Tierreich ebensowohl den Zwecken des Pflanzenreichs zu dienen hat wie umgekehrt.Wenn die Pflanzen als beseelte Wesen schlimm gestellt scheinen, indem sie sich viel Unbill von Menschen und Tieren gefallen lassen müssen, ohne sich dagegen wehren zu können, so erscheint dies doch bloß so schlimm, wenn wir uns auf unseren menschlichen Standpunkt stellen, ganz anders dagegen, wenn wir das Pflanzenleben nach seinem eigenen inneren Zusammenhange auffassen. Auch legen wir diesem Einwande überhaupt mehr Gewicht bei, als er verdient.
Wenn man behauptet, daß die Pflanzen keine Seele haben, weil sie keine Freiheit und willkürliche Bewegung haben, so achtet man entweder nicht recht auf die Tatsachen, welche eine solche Freiheit in der Pflanze doch in ähnlichem Sinne wie im Tiere erkennen lassen, oder verlangt von der Pflanze etwas, was man bei Tieren auch nicht findet, indem von eigentlicher Freiheit doch auch bei Tieren nicht wohl die Rede sein kann.
Sofern Pflanzenreich und Tierreich durch ein Zwischenreich aneinander grenzen, wo die Unterschiede beider zweideutig werden, dieses Zwischenreich aber sowohl die unvollkommensten Pflanzen als Tiere enthält, kann man das Pflanzenreich dem Tierreiche nicht schlechthin als ein tiefer stehendes unterordnen; da es sich vielmehr von dem Zwischenreiche durch die höheren Pflanzen wieder zu erheben anfängt. Dies und der Umstand, daß das Pflanzenreich und Tierreich in der Schöpfungsgeschichte gleiches Datum der Entstehung haben, spricht dafür, daß das eine dem anderen auch in betreff der Beseelung nicht schlechthin untergeordnet sein wird.
Vermißt man die Zeichen der Zentralisation, verknüpfenden Einheit oder des selbständigen Abschlusses im Pflanzen-Organismus als Bedingung oder Ausdruck der Einheit und Individualität der Seele, so sieht man wieder nicht auf die rechten Punkte, oder verlangt Dinge von den Pflanzen, die man bei den Tieren auch nicht findet.
Es ist wahrscheinlich, daß das Seelenleben der Pflanzen noch viel mehr ein rein sinnliches ist als das der Tiere, welche, wenn auch nicht Vernunft und Selbstbewußtsein, doch noch Erinnerung des Vergangenen und Voraussicht des Zukünftigen haben, während das Pflanzenleben wahrscheinlich im Fortleben mit der Gegenwart aufgeht, ohne deshalb in der Allgemeinbeseelung aufzugehen. Statt daß aber das Sinnesleben der Pflanzen minder entwickelt als das der Tiere wäre, mag es noch mehr entwickelt sein. ■Aus Gustav Theodor Fechner: Nanna oder über das Seelenleben der Pflanzen, Leipzig 1848
.
.
Das Zitat der Woche
.
Von der Realität
Egon Friedell
.
Wer macht die Realität? Der »Wirklichkeitsmensch«? Dieser läuft hinter ihr her. Gewiß schafft auch der Genius nicht aus dem Nichts, aber er entdeckt eine neue Wirklichkeit, die vor ihm niemand sah, die also gewissermaßen vor ihm noch nicht da war. Die vorhandene Wirklichkeit, mit der der Realist rechnet, befindet sich immer schon in Agonie. Bismarck verwandelt das Antlitz Mitteleuropas durch Divination, Röntgenblick, Konjektur: durch Phantasie. Phantasie brauchen und gebrauchen Cäsar und Napoleon sogut wie Dante und Shakespeare. Die anderen: die Praktischen, Positiven, dem »Tatbestand« Zugewandten leben und wirken, näher betrachtet, gar nicht in der Realität. Sie bewegen sich in einer Welt, die nicht mehr wahr ist. Sie befinden sich in einer ähnlich seltsamen Lage wie etwa die Bewohner eines Sterns, der so weit von seiner Sonne entfernt wäre, daß deren Licht erst in ein oder zwei Tagen zu ihm gelangte: die Tagesbeleuchtung, die diese Geschöpfe erblickten, wäre sozusagen nachdatiert. In einer solchen falschen Beleuchtung, für die aber der Augenschein spricht, sehen die meisten Menschen den Tag. Was sie Gegenwart nennen, ist eine optische Täuschung, hervorgerufen durch die Unzulänglichkeit ihrer Sinne, die Langsamkeit ihrer Apperzeption. Die Welt ist immer von gestern.
Abgeschieden von diesen Sinnestäuschungen lebt der Genius, weswegen er weltfremd genannt wird. Dieses Schicksal trifft in gleichem Maße die Genies des Betrachtens und die Genies des Handelns: nicht nur Goethe und Kant, auch Alexander der Große und Friedrich der Große, Mohammed und Luther, Cromwell und Bismarck wurden am Anfang ihrer Laufbahn für Phantasten angesehen. Und »weltfremd« ist nicht einmal eine schlechte Bezeichnung, denn die erkalkte Welt der Gegenwart war ihnen in der Tat fremd geworden. Man ist daher versucht zu sagen: alle Menschen leben prinzipiell in einer imaginären, schimärischen, illegitimen, erdichteten Welt; bis auf einen: den Dichter.
Die großen Männer sind eine Art Fällungsmittel, das dem Leben zugesetzt wird. Kaum treten sie mit dem Dasein in Berührung, so beginnt es sich zu setzen und zu teilen, zu läutern und zu lösen, zu entmischen und durchsichtig zu werden. Vor ihren klaren Ekstasen entschleiert sich das Leben, und alles Dunkle sinkt schwer zu Boden. ■Aus Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit, München 1931
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Die treffenden Aussprüche des Aristoteles
Diogenes Laertios
.
Es werden folgende besonders treffende Aussprüche auf Aristoteles zurückgeführt.
Auf die Frage, was die Lügner für einen Gewinn von ihren Lügen haben, antwortete er: »Daß man ihnen nicht glaubt, auch wenn sie die Wahrheit sagen.« Als man ihm vorwarf, daß er einem Taugenichts ein Almosen gegeben, sagte er: »Mein Mitleid galt nicht seinem Verhalten, sondern dem Menschen.« Oft pflegte er zu seinen Freunden und Schülern, wo auch immer im Tageslicht er verweilte, zu sagen: »Das Gesicht empfängt sein Licht von der umgebenden Luft, die Seele aber das ihre von dem Unterricht.« Oft auch sagte er mit starker Betonung: »Die Athener hätten den Getreidebau und die Gesetze erfunden; allein das Getreide zwar wußten sie zu verwerten, nicht aber die Gesetze.« »Die Wurzeln der Bildung«, sagte er, »sind bitter, ihre Früchte aber sind süß.« Auf die Frage, was schnell veralte, sagte er: »Der Dank.« Gefragt, was die Hoffnung sei, sagte er: »Der Traum eines Wachenden.« Als ihm Diogenes eine getrocknete Feige reichte, sagte er sich, daß, wenn er sie nicht annähme, jener ein beißendes Wort gegen ihn in Bereitschaft hätte, er nahm sie also an mit den Worten, Diogenes sei nicht nur um seine Feige, sondern auch um sein Witzwort gekommen. Und als er ihm wieder eine reichte, nahm er sie, hob sie nach Knabenart hoch in die Luft und gab sie mit den Worten »O großer Himmelssohn« zurück.
Dreierlei, pflegte er zu sagen, ist nötig für die Erziehung und Geistesbildung: Naturanlage, Belehrung, Übung. Als er von einem Verleumder hörte, der ihn verunglimpfte, sagte er: »Wenn ich abwesend bin, mag er mir auch Geißelhiebe verabreichen.« Die Schönheit, pflegte er zu sagen, sei eine bessere Empfehlung als jeder Brief. Andere schreiben das Wort in dieser Fassung dem Diogenes zu, während er selbst die Wohlgestalt für ein Geschenk Gottes erklärt hätte. Sokrates erklärte sie angeblich für eine Gewaltherrschaft (Tyrannis) von kurzer Dauer, Piaton für ein Vorrecht der Natur, Theophrast für einen schweigenden Betrug, Theokrit für einen elfenbeinernen Schaden, Karneades für ein Königtum ohne Leibwächter.Auf die Frage nach dem Unterschied zwischen Gebildeten und Ungebildeten antwortete er: »Er ist so groß wie der zwischen Lebenden und Toten.« Die Bildung, sagte er, sei in glücklichen Zeiten eine Zierde, im Unglück eine Zuflucht. Diejenigen Eltern, die ihren Kindern eine gute Bildung gegeben hätten, seien weit achtungswerter als die, welche sie bloß zeugten: denn die letzteren schenkten ihnen nur das Leben, die ersteren aber den Vorzug, tadellos zu leben.
Zu einem, der sich seiner Abkunft aus einer großen Stadt rühmte, sagte er: »Nicht darauf kommt es an, sondern darauf, daß man eines großen Vaterlandes auch würdig sei.« Die Frage, was ist ein Freund?, beantwortete er mit der Erklärung: »Eine Seele, die in zwei Leibern wohnt.« Die Menschen, sagte er, seien teils so karg, als ob sie ewig leben, teils so verschwenderisch, als ob sie im nächsten Augenblick sterben würden. Als einer ihm die Frage vorlegte: »Wie kommt es, daß wir mit schönen Leuten uns gern recht lange unterhalten?«, entgegnete er: »So kann nur ein Blinder fragen.«
Als ihm einer mit der Frage kam, welcher Gewinn ihm aus der Philosophie erwachsen wäre, sagte er: »Daß ich ohne Befehl tue, was andere nur aus Furcht vor den Gesetzen tun.« Auf die Frage, wie die Schüler sich am besten in ihrem Fortschreiten förderten, antwortete er: »Wenn sie denen, die einen Vorsprung hätten, nacheilten, ohne auf die Rückständigen zu warten.« Einen Schwätzer, der ihn mit seinem Gewäsch überschüttet hatte und fragte: »Ich bin dir doch nicht zur Last gefallen?«, fertigte er mit den Worten ab: »Nicht im mindesten, denn ich habe gar nicht auf dich geachtet.« Auf den Vorwurf, den man ihm machte, daß er einem Unwürdigen eine Unterstützung habe zuteil werden lassen – denn auch in dieser Form tritt die Sache auf -, antwortete er: »Nicht dem Menschen galt meine Gabe, sondern der Menschlichkeit.« Auf die Frage, wie wir uns gegen unsere Freunde zu verhalten haben, erwiderte er: »Gerade so, wie wir wünschen, daß sie sich gegen uns verhalten.« Die Gerechtigkeit erklärte er für diejenige Seelentugend, die einem jeden zuweist, was ihm gebührt.
Als schönste Mitgabe für das Alter erklärte er die Bildung. Favorin berichtet im zweiten Buch seiner Denkwürdigkeiten, er habe immer wieder gesagt: »Viele Freunde, kein Freund«, ein Ausspruch, der sich auch im siebenten Buche der Ethik findet.
Das sind die Denksprüche, die ihm beigelegt werden. ■Aus Diogenes Laertios: Über Aristoteles; in: Ein Panorama europäischen Denkens – Texte aus drei Jahrtausenden (Hrg. L. Marcuse), Diogenes Verlag 1977
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Von der Gewissheit der Vernunft
Georg W. F. Hegel
.
Die Vernunft ist die Gewißheit des Bewußtseins, alle Realität zu sein; so spricht der Idealismus ihren Begriff aus. Wie das Bewußtsein, das als Vernunft auftritt, unmittelbar jene Gewißheit an sich hat, so spricht auch der Idealismus sie unmittelbar aus: Ich bin Ich, in dem Sinne, daß Ich, welches mir Gegenstand ist, nicht wie im Selbstbewußtsein überhaupt, noch auch wie im freien Selbstbewußtsein, dort nur leerer Gegenstand überhaupt, hier nur Gegenstand, der sich von den anderen zurückzieht, welche neben ihm noch gelten, sondern Gegenstand mit dem Bewußtsein des Nichtseins irgendeines anderen, einziger Gegenstand, alle Realität und Gegenwart ist.
Das Selbst-Bewußtsein ist aber nicht nur für sich, sondern auch an sich alle Realität erst dadurch, daß es diese Realität wird oder vielmehr sich als solche erweist. Es erweist sich so in dem Wege, worin zuerst in der dialektischen Bewegung des Meinens, Wahrnehmens und des Verstandes das Anderssein als an sich und dann in der Bewegung durch die Selbständigkeit des Bewußtseins in Herrschaft und Knechtschaft, durch den Gedanken der Freiheit, die skeptische Befreiung und den Kampf der absoluten Befreiung des in sich entzweiten Bewußtseins das Anderssein, insofern es nur für es ist, für es selbst verschwindet. Es traten zwei Seiten nacheinander auf, die eine, worin das Wesen oder das Wahre für das Bewußtsein die Bestimmtheit des Seins, die andere[, worin es] die hatte, nur für es zu sein. Aber beide reduzierten sich in eine Wahrheit, daß, was ist, oder das Ansich nur ist, insofern es für das Bewußtsein, und was für es ist, auch an sich ist. Das Bewußtsein, welches diese Wahrheit ist, hat diesen Weg im Rücken und vergessen, indem es unmittelbar als Vernunft auftritt, oder diese unmittelbar auftretende Vernunft tritt nur als die Gewißheit jener Wahrheit auf. Sie versichert so nur, alle Realität zu sein, begreift dies aber selbst nicht; denn jener vergessene Weg ist das Begreifen dieser unmittelbar ausgedrückten Behauptung. Und ebenso ist dem, der ihn nicht gemacht hat, diese Behauptung, wenn er sie in dieser reinen Form hört -denn in einer konkreten Gestalt macht er sie wohl selbst -unbegreiflich. ■
Aus Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, Bamberg/Würzburg 1807
.
.
Robert Zimmer: «Arthur Schopenhauer» (Biographie)
.
Ein durchweg zweideutiges Leben
Zum 150. Todesjahr von Arthur Schopenhauer
Günter Nawe
.
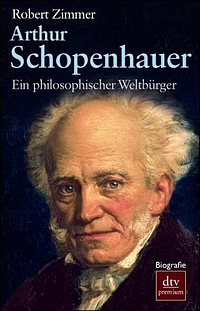 Rechtzeitig zum 150. Todesjahr des großen deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer hat Robert Zimmer eine großartige Biografie vorgelegt. Für den promovierten Philosophen war und ist Arthur Schopenhauer nicht nur ein bedeutender Philosoph, er war der wohl einzige Philosoph, der ein umfassendes Verständnis hatte für Musik und Kunst und Literatur (Shakespeare und Goethe zum Beispiel), und der selbst ein exzellenter Schriftsteller war. Dies alles beschreibt Zimmer im Kontext zu den Lebensdaten und der Werk- und Wirkungsgeschichte Schopenhauers. Und das in einer Art und Weise, die auch dem nicht philosophisch geschulten Leser Gewinn verspricht und Freude machen wird, und ohne ins populärwissenschaftliche Genre abzugleiten.
Rechtzeitig zum 150. Todesjahr des großen deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer hat Robert Zimmer eine großartige Biografie vorgelegt. Für den promovierten Philosophen war und ist Arthur Schopenhauer nicht nur ein bedeutender Philosoph, er war der wohl einzige Philosoph, der ein umfassendes Verständnis hatte für Musik und Kunst und Literatur (Shakespeare und Goethe zum Beispiel), und der selbst ein exzellenter Schriftsteller war. Dies alles beschreibt Zimmer im Kontext zu den Lebensdaten und der Werk- und Wirkungsgeschichte Schopenhauers. Und das in einer Art und Weise, die auch dem nicht philosophisch geschulten Leser Gewinn verspricht und Freude machen wird, und ohne ins populärwissenschaftliche Genre abzugleiten.
Denn es war für einen Denker und Gelehrten schon ein aufregendes Leben, das dieser 1788 in Danzig geborene Schopenhauer geführt hat. Eine Reihe von Lebensstationen gab es: Hamburg (hier erlernte er den Kaufmann-Beruf), Gotha und Weimar, Göttingen und Berlin, Rudolstadt und Dresden, und schließlich Frankfurt/Main. Dazu viele Reisen, schon als Kind mit Aufenthalten in Holland, England, Frankreich und der Schweiz. Später zwei Italienreisen. In Rudolstadt schrieb er seine Dissertation «Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde», Grundlage für sein späteres Hauptwerk «Die Welt als Wille und Vorstellung» (1818). In Weimar gab es dann die Auseinandersetzung mit Mutter Johanna und Schwester Adele, die mit einem unkittbaren Zerwürfnis endete. Mit Goethe, den er verehrte, hatte er Kontakt über die «Farbenlehre», der Schopenhauer allerdings selbstbewusst und überheblich eine eigene Schrift «Über das Sehn und die Farben» (1816) entgegenstellte. Ein «durchweg zweideutiges Leben» also. Am 21. September 1860 ist der Philosoph Arthur Schopenhauer in Frankfurt/Main gestorben.
Zimmer versteht es, alle diese Ereignisse korrespondieren zu lassen mit den Anschauungen dieses gern als pessimistisch, misanthropisch und frauenfeindlich apostrophierten Einzelgängers mit dem Pudel, der allerdings auch Liebesbeziehungen, unter anderem mit einer Choristin der Berliner Oper, und uneheliche Kinder hatte. Stattdessen war – nach Zimmer – der Philosoph ein kosmopolitischer Denker (mit gutem Grund trägt diese Biografie den Untertitel «Ein philosophischer Weltbürger»), der es verstanden hat, abendländisches Denken mit fernöstlichen Weisheiten in Verbindung zu bringen.
Dies und sein Eigenwille brachte ihn zwangsläufig in Konflikt mir der bisherigen Philosophie und ihren Vertretern, die er neben sich nicht gelten ließ – außer Kant, den die akademische Philosophie missverstanden habe, und mit dem einzig er – Schopenhauer – auf Augenhöhe denken könnte. So ist besonders die Auseindersetzung mit seinen «Erzfeinden» Hegel, Fichte und Schelling und mit der gesamten akademischen Philosophie bemerkenswert. Den Vorwurf: «Die Philosophie-Profeßoren haben redlich das Ihrige gethan, um dem Publiko die Bekanntschaft mit meinen Schriften wo möglich auf immer vor zu enthalten. Beinahe 40 Jahre hindurch bin ich ihr Caspar Hauser gewesen.» wird er bis in seine letzten Jahre aufrecht erhalten.. Er rächt sich, indem er vom «ekelhaften Hegeljargon» spricht, von der «Hegelei» und von «Hegelianischen Flausen», und auch an allen anderen kein gutes Haar lässt.
Auch am Leser übrigens nicht. «Meine letzte Zuflucht ist jetzt, ihn (den Leser) zu erinnern, daß er ein Buch, auch ohne es gerade zu lesen, doch auf mancherlei Art zu benutzen weiß. Es kann, so gut wie viel andere, eine Lücke seiner Bibliothek ausfüllen, wo es sich, sauber gebunden, gewiß gut ausnehmen wird. Oder auch er kann es seiner gelehrten Freundin auf die Toilette, oder den Theetisch legen. Oder endlich er kann ja, was gewiß das Beste von Allem ist und ich besonders rathe, es recensiren.» Auch wenn Schopenhauer gedichtet hat: «Daß von allem, was man liest, / Man neun Zehntel bald vergißt, / Ist ein Ding, das mich verdrießt./ Wer’s doch All auswendig wüßt’!»

Robert Zimmer erzählt in «Ein philosphischer Weltbürger» umfassend von Leben und Werk des Denkers Arthur Schopenhauer, der die deutsche Philosophie aus dem akademischen Elfenbeinturm befreit hat.
So war er, dieser Arthur Schopenhauer, der einmal von sich sagte: «Das Leben ist eine missliche Sache: ich habe mir vorgesetzt, es damit hinzubringen, über dasselbe nachzudenken.» Und das tat er gründlich und prononciert, sodass sein Werk, vor allem die «Parerga und Paralipomena» (1851) mit den «Aphorismen zur Lebensweisheit», eine Art «Steinbruch» sind, aus dem sich jeder, was immer er will herausschlagen kann. Zum Beispiel Sprachpuristen, die gern sein Diktum gegen die «Sprachverhunzung» zitieren: «Empörend ist es, die deutsche Sprache zerfetzt, zerzaust und zerfleichst zu sehen, und oben drauf den triumphirenden Unverstand, der selbstgefällig sein Werk belächelt.»
Robert Zimmer erzählt umfassend und verständlich, sodass der Leser ein sehr komplexes Bild von diesem kosmopolitischen Denker und Schriftsteller, auch vom Menschen Schopenhauer und vom Philosophen erhält, der die deutsche Philosophie des 19. Jahrhunderts maßgeblich erweitert hat. Vor allem hat er sie dank seiner verständlichen Sprache aus dem akademischen Elfenbeinturm befreit. ■
Robert Zimmer: Arthur Schopenhauer – Ein philosophischer Weltbürger, Biografie, 316 Seiten, Deutscher Taschenbuch Verlag, ISBN 978-3-423-24800-6
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über die rechte Erziehung
Immanuel Kant
.
Unsern Schulen fehlet fast durchgängig etwas, was doch sehr die Bildung der Kinder zur Rechtschaffenheit befördern würde, nämlich ein Katechismus des Rechts. Er müßte Fälle enthalten, die populär wären, sich im gemeinen Leben zutragen, und bei denen immer die Frage ungesucht einträte: ob etwas recht sei oder nicht? Beispielsweise wenn jemand, der heute seinem Kreditor bezahlen soll, durch den Anblick eines Notleidenden gerührt wird, und ihm die Summe, die er schuldig ist, und nun bezahlen sollte, hingibt: ist das recht oder nicht? Nein! Es ist unrecht, denn ich muß frei sein, wenn ich Wohltaten tun will. Und, wenn ich das Geld dem Armen gebe, so tue ich ein verdienstliches Werk; bezahle ich aber meine Schuld, so tue ich ein schuldiges Werk. Ferner, ob wohl eine Notlüge erlaubt sei? Nein! es ist kein einziger Fall gedenkbar, in dem sie Entschuldigung verdiente, am wenigsten vor Kindern, die sonst jede Kleinigkeit für eine Not ansehen, und sich öfters Lügen erlauben würden.
Gäbe es nun ein solches Buch schon, so könnte man, mit vielem Nutzen, täglich eine Stunde dazu aussetzen, die Kinder das Recht der Menschen, diesen Augapfel Gottes auf Erden, kennen, und zu Herzen nehmen zu lehren. –Was die Verbindlichkeit zum Wohltun betrifft: so ist sie nur eine unvollkommene’ Verbindlichkeit. Man muß nicht sowohl das Herz der Kinder weich machen, daß es von dem Schicksale des andern affiziert werde, als vielmehr wacker. Es sei nicht voll Gefühl, sondern voll von der Idee der Pflicht. Viele Personen wurden in der Tat hartherzig, weil sie, da sie vorher mitleidig gewesen waren, sich oft betrogen sahen. Einem Kinde das Verdienstliche der Handlungen begreiflich machen zu wollen, ist umsonst. Geistliche fehlen sehr oft darin, daß sie die Werke des Wohltuns als etwas Verdienstliches vorstellen. Ohne daran zu denken, daß wir in Rücksicht auf Gott nie mehr, als unsere Schuldigkeit tun können, so ist es auch nur unsere Pflicht, dem Armen Gutes zu tun.
Denn die Ungleichheit des Wohlstandes der Menschen kommt doch nur von gelegentlichen Umständen her. Besitze ich also ein Vermögen, so habe ich es auch nur dem Ergreifen dieser Umstände, das entweder mir selbst oder meinem Vorgänger geglückt ist, zu danken, und die Rücksicht auf das Ganze bleibt doch immer dieselbe.
Der Neid wird erregt, wenn man ein Kind aufmerksam darauf macht, sich nach dem Werte anderer zu schätzen. Es soll sich vielmehr nach den Begriffen seiner Vernunft schätzen. Daher ist die Demut eigentlich nichts anders, als eine Vergleichung seines Wertes mit der moralischen Vollkommenheit. […]
Ob aber der Mensch nun von Natur moralisch gut oder böse ist? Keines von beiden, denn er ist von Natur gar kein moralisches Wesen; er wird dieses nur, wenn seine Vernunft sich bis zu den Begriffen der Pflicht und des Gesetzes erhebt. Man kann indessen sagen, daß er ursprünglich Anreize zu allen Lastern in sich habe, denn er hat Neigungen und Instinkte, die ihn anregen, ob ihn gleich die Vernunft zum Gegenteile treibt. Er kann daher nur moralisch gut werden durch Tugend, also aus Selbstzwang, ob er gleich ohne Anreize unschuldig sein kann.
Laster entspringen meistens daraus, daß der gesittete Zustand der Natur Gewalt tut, und unsre Bestimmung als Menschen ist doch, aus dem rohen Naturstande als Tier herauszutreten. Vollkommne Kunst wird wieder zur Natur.
Es beruht alles bei der Erziehung darauf, daß man überall die richtigen Gründe aufstelle, und den Kindern begreiflich und annehmlich mache. Sie müssen lernen, die Verabscheuung des Ekels und der Ungereimtheit an die Stelle der des Hasses zu setzen; innern Abscheu, statt des äußern vor Menschen und der göttlichen Strafen, Selbstschätzung und innere Würde, statt der Meinung der Menschen, – innern Wert der Handlung und des Tun, statt der Worte, und Gemütsbewegung, – Verstand, statt des Gefühles, – und Fröhlichkeit und Frömmigkeit bei guter Laune, statt der grämischen, schüchternen und finstern Andacht eintreten zu lassen. ■Aus Immanuel Kant, Über Pädagogik, in: Werke in 12 Bänden (W.Weischedel/Hg.), Suhrkamp Verlag 1968 (Bd. 12)
.
Themenverwandte Links
Kindererziehung – Erziehung-Kinder-Familie – Mittelalterliche Erziehung – Eltern unter Druck – Erziehungsdefizite nehmen zu – Kinder stark machen – Kindeswohl oder Ehegattenwohl – Bildungsferne – Warum Kinder sich langweilen sollten – Gender Mainstreaming – Wochenendvati – Ganzheitliche Entwicklung der Kinder – Autoritäre Erziehung&Alkohol
.
.
Das Zitat der Woche
.
Von der Philosophie und der Logik
Friedrich Waismann
.
Der Philosoph macht nicht das, was der Logiker macht – nur weniger kompetent -, sondern etwas ganz und gar anderes. Ein philosophisches Argument ist keine Approximation eines logischen, noch ist das letztere ein Ideal, das der Philosoph anstrebt. Eine solche Darstellung gibt das, was wirklich vor sich geht, vollkommen falsch wieder. Philosophie ist keine Übung in formaler Logik, philosophische Argumente sind keine – wenn auch unzulängliche – Ketten logischer Folgerungen, noch können sie mit viel Mühe auf deduktive Formen gebracht werden. Hier wird das Ziel des Wissenschaftlers, neue Wahrheiten zu finden, mit dem Ziel des Philosophen, Einsicht zu gewinnen, verwechselt.
Da beides vollkommen verschieden ist, nimmt es kaum wunder, daß sich der Philosoph nicht in der Rüstung des Logikers bewegen kann. Nicht einmal dann, wenn der Logiker selbst den Kampf führt. Der Konflikt über das Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten in der Mathematik ist ein Konflikt zwischen zwei Parteien, von denen jede im Besitz klarer und genau definierter Begriffe ist. Dennoch scheint es keine Möglichkeit zu geben, die Kontroverse durch zwingende Argumente beizulegen. Wenn es wahr ist, daß philosophische Schwierigkeiten aus der unklaren Natur unserer alltäglichen Begriffe entstehen, wie kann es dann angehen, daß solche Konflikte in der exaktesten aller Wissenschaften ausbrechen? ■
Aus Friedrich Waismann, Wie ich Philosophie sehe, in: A. Kulenkampff (Hg.), Methodologie der Philosophie, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1979
.
.
Das Zitat der Woche
.
Vom Organismus als geistige Macht
Adolf Portmann
.
Eingliederung in ein teilweise unbekanntes Gesamtbild – das ist eine unbequeme und unbeliebte Forderung, und doch ist sie entscheidend. Sie wird heute oft in einem erschreckenden Mass vernachlässigt. Die Bilder vom Organismus geben sich in unseren Tagen meist als rational durchschaute. Sie wollen völlig verstandene Bilder sein. Der Organismus ist in diesen Konstruktionen auf das reduziert worden, was von ihm jederzeit rational fassbar ist, und diese Auffassung beherrscht denn auch den elementaren Unterricht der Gegenwart. Die Blüte der höheren Pflanze ist in dieser Betrachtungsweise eine Bestäubungseinrichtung mit einem weit ausgebauten, farben- und düftereichen Publizitätsdienst. Das Farbenkleid eines Vogels steht etwa im Dienst der Tarnung oder der Anlockung der Geschlechter oder es vermittelt das Erkennen von Artgenossen. Der Farbwechsel eines Fisches ist ein Auslöser für soziale Beziehungen, eine Kundgabe von Stimmungen. Dass in allen diesen Fällen gerade die eigenartigsten Tatsachen der Gestalt auch noch anderen Deutungen zugänglich wären, die nicht ausschliesslich der Sphäre der puren Erhaltung der Art oder des Individuums angehören, das sei im Augenblick nur angedeutet.
Selbst Forschungsrichtungen, welche die Gestaltung des Lebendigen sehr ernst nehmen, wie die Verhaltungsforschung der neuesten Zeit, sind in manchen ihrer Varianten auf den blossen Nachweis von funktionellem Sinn der äusseren Merkmale eingeengt, sie suchen nach «Rollen» in ganz bestimmten Lebensspielen. Sie machen deshalb bewusst oder unbewusst mit bei der Reduktion der organischen Erscheinung auf bloss funktional Verstandenes.
Die Gefahr einer Gestaltauffassung, die derart auf das rational Durchschaute reduziert ist, wird in unserer Zeit noch vergrössert durch einen Umstand, der eine immer drohendere Lage schafft: der technische Ausbau der Arbeitsmethoden führt heute immer weiter weg von einer umfassenden Betrachtung der Gesamterscheinung eines Organismus. Die zwangsläufige Entwicklung lenkt ab von der Gestalt. Sie zwingt den Forscher ins Submikroskopische, in den molekularen Bereich. Die Form ist dann nur noch Funktionsträger, der als durchschaut gilt; sie ist zuweilen dem Forscher überhaupt nur noch technischer Test für Verborgenes. Dadurch wird einer Reduktion der Vorstellung vom Lebendigen Vorschub geleistet, die oft noch weit unter das geht, was zur Zeit rational verstanden wird: eine Reduktion auf blosse biotechnisch bedeutungsvolle Ausschnitte.
Denken wir nun an die Notwendigkeit der äussersten Beschränkung im Unterricht, wie sie die nahe Zukunft aus Zeitgründen immer schärfer bringen wird – wie gross ist da die Gefahr, dass wir uns mehr und mehr auf einige schematische Robotbilder des Lebendigen beschränken. Nur eine neue Auffassung vom Organismus, von der eine wirkliche geistige Macht ausgeht, könnte einem solchen Verfall entgegenwirken. ■Aus Adolf Portmann, Wandlungen unseres Bildes vom Lebendigen, in: Wege zur neuen Wirklichkeit, Vortragsreihe, Verlag Hallwag Bern 1960
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über die Individualität
Max Horkheimer
.
Die Individualität wird beeinträchtigt, wenn jedermann beschließt, sich selbst zu helfen. Indem der gewöhnliche Mensch sich von der Teilnahme an politischen Angelegenheiten zurückzieht, tendiert die Gesellschaft dazu, zum Gesetz des Dschungels zurückzukehren, das alle Spuren von Individualität tilgt. Das absolut isolierte Individuum ist stets eine Illusion gewesen. Die am höchsten geschätzten persönlichen Qualitäten, wie Unabhängigkeit, Wille zur Freiheit, Sympathie und der Sinn für Gerechtigkeit, sind ebenso gesellschaftliche wie individuelle Tugenden.
Das vollentwickelte Individuum ist die Vollendung einer vollentwickelten Gesellschaft. Die Emanzipation des Individuums ist keine Emanzipation von der Gesellschaft, sondern die Erlösung der Gesellschaft von der Atomisierung, eine Atomisierung, die in Perioden der Kollektivierung und Massenkultur ihren Höhepunkt erreicht hat. ■
Aus Max Horkheimer, Zur Kritik der instrumentellen Vernunft, in: Vorträge und Aufzeichnungen, S. Fischer Verlag 1967
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über das Paradies
Nikos Kazantzakis
.
Als ich erwachte, mochte es Mittag sein. Ich blickte mich überall um. Was gab es nicht alles zu sehen! Ein kleines sauberes Zimmer mit Lehnstühlen, einem Waschtisch, Seife, Flaschen, Fläschchen, großen und kleinen Spiegeln. An den Wänden hingen bunte Kleider und eine große Menge Fotografien – Matrosen, Offiziere, Kapitäne, Polizisten, Tänzerinnen, halbnackte Frauen. Und neben mir im Bett lag warm, duftend, mit verwühltem Haar das weibliche Geschlecht.
He, <Sorbas>, flüsterte ich und schloß die Augen, <du kamst schon bei Lebzeiten ins Paradies. Hier ist es gut sein, hier bringen dich keine zehn Pferde weg.>Wie ich dir schon früher erklärte, hat jeder Mensch sein eigenes Paradies. Deins ist mit Büchern und großen Tintenflaschen vollgestopft. Für einen anderen besteht es aus Fässern voll Wein, Uso und Kognak. Einem dritten bedeuten ganze Berge von englischen Pfunden das Paradies. Mein Paradies ist jetzt ein kleines Zimmer mit bunten Röcken, Parfüms und wohlriechender Seife, ich liege in einem breiten Bett mit Sprungfedern und das weibliche Geschlecht mir zur Seite.
Aus Nikos Kazantzakis, Alexis Sorbas, Roman, Rowohlt Verlag 1976
.
.
Das Zitat der Woche
.
Vom inneren Gesetz der Wissenschaft
Nicolai Hartmann
.
Wissenschaft ist zu keiner Zeit ein feststehender Besitz, so sehr auch es dem in seiner Zeitlage Wurzelnden so erscheinen mag; sie ist stets im Werden, ist im Ganzen gesehen ein einziger großer Prozeß. Der Prozeß aber ist, wo immer er lebendig im Gange und nicht etwa bloßes Zehren von fremder Errungenschaft ist, notwendig ein Adäquationsprozeß, Annäherung an die Wahrheit. Das trifft auch dort noch zu, wo einseitige Richtungen sich zuspitzen. Der Halt an der Sache läßt es nicht anders zu; was unwahr ist, kann mit Gegebenem nicht zur Deckung gebracht werden, kann also dem fortschreitenden Problemstande nicht genügen.
Die Irrtümer in diesem Prozeß sind also nicht nur lehrreich, sie sind vielmehr ebenso positiv bewegende Momente wie die Einsichten; und zwar auf die Dauer stets solche, die sich auf die Wahrheit zu bewegen. Sie gerade zwingen zum tieferen Eindringen, ihre eigene Unhaltbarkeit drängt zur Berichtigung hin. In der Wissenschaft sind Irrtümer die Erfahrungen, die der objektive Geist an sich selber macht. Und seine Erfahrungen kommen ihm zugute.So ist es schon im Leben des Individuums. Die Erkenntnis wächst im Maße der begangenen Irrtümer und ihrer Berichtigungen. Der Mensch zahlt Lehrgeld, indem er fortschreitet. So ist es erst recht beim Erkenntnisprozeß im Großen, der als geschichtlicher den individuellen überlagert und in seine Bewegung einbettet. Und beide hängen zusammen: wie die jeweilige Errungenschaft des Wissens das Erkennen des Individuums trägt und bewegt, so bewegt dieses wiederum den Bestand des Wissens durch seine jeweilige Errungenschaft fort.
Die Bewegung des objektiven Geistes unterliegt somit in der Wissenschaft einem eigenen Gesetz, wie es auf keinem anderen Gebiet sein Analogon hat: sie mag im einzelnen von Irrtum zu Irrtum führen, sie führt dennoch in der Gesamtresultante unentwegt der Wahrheit zu – und zwar unabhängig davon, ob sie in bestimmter Frage zur Wahrheit gelangt oder nicht. ■Aus Nicolai Hartmann, Das Problem des geistigen Seins, Walter de Gruyter Verlag, Berlin 1949
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Vom Nihilismus
Gottfried Benn
.
Der Mensch ist gut, sein Wesen rational, und alle seine Leiden sind hygienisch und sozial bekämpfbar, dies einerseits, und andererseits die Schöpfung sei der Wissenschaft zugänglich, aus diesen beiden Ideen kam die Auflösung aller alten Bindungen, die Zerstörung der Substanz, die Nivellierung aller Werte, aus ihnen die innere Lage, die jene Atmosphäre schuf, in der wir alle lebten, von der wir alle bis zur Bitterkeit und bis zur Neige tranken: Nihilismus.
Dieser Begriff gewann in Deutschland Gestalt im Jahre 1885/86, als das Werk >Der Wille zur Macht< teils konzipiert, teils geschrieben wurde, dessen erstes Buch ja den Untertitel führt: >Der europäische Nihilismus<. Aber dieses Buch enthält schon eine Kritik dieses Begriffes und Entwürfe zu seiner Überwindung.
Wollen wir ihn noch weiter zurück verfolgen, wollen wir feststellen, wo und wann dieser schicksalhafte Begriff zum ersten Male in der europäischen Geistesgeschichte als Wort und seelisches Erlebnis auftritt, müssen wir uns, bekanntlich, nach Rußland wenden. Seine Geburtsstunde war der März 1862, der Monat, in dem der Roman >Väter und Söhne< von Iwan Turgenjew erschien. Weiter können auch russische Geschichtsforscher diesen Begriff nicht zurück verfolgen. Aber der Held dieses Romans, namens Basaroff, das ist schon der fertige Nihilist, und Turgenjew stellt ihn mit diesem Namen vor. Dieser Name wurde dann ungeheuer schnell populär, der Autor erzählt in einem Nachwort zu seinem Roman, wie er schon nach wenigen Monaten in aller Munde war, als er im Mai desselben Jahres nach Petersburg zurückkehrte, es war die Zeit der großen Brandstiftungen, des Brandes des Apraxinhofes, rief man ihm zu: »Da sehen Sie Ihre Nihilisten, sie stecken Petersburg in Brand.«Für unser Thema äußerst interessant ist nun, daß der Nihilismus dieses Basaroff eigentlich gar kein Nihilismus in absoluter Form war, kein Negativismus schlechthin, sondern ein fanatischer Fortschrittsglaube, ein radikaler Positivismus in Bezug auf Naturwissenschaft und Soziologie. Er ist zum erstenmal in der europäischen Literatur der siegesgewisse Mechanist, der schneidige Materialist, dessen etwas fragwürdige Enkel wir ja heute noch lebhaft tätig unter uns sehen – hören wir, welche vertrauten Klänge aus den sechziger Jahren zu uns herüberklingen: Ein tüchtiger Chemiker, hören wir, ist zwanzigmal wertvoller als der beste Poet. Ein Stück Käse ist mir lieber als der ganze Puschkin. Halten Sie nichts von der Kunst? Doch, von der Kunst, Geld zu machen und Hämorrhoiden zu kurieren! Jeder Schuhmacher ist ein größerer Mann als Goethe und Shakespeare. George Sand ist eine zurückgebliebene Frau, sie verstand nichts von Embryologie.
Und neben diesen Wahrheiten tritt das Kaschemmenmilieu in Leben und Kunst als letzter Schrei auf, hier und damals entstand also der Stil, den wir bis in gewisse moderne Opern und Opernbearbeitungen verfolgen können: der Kult des Athleten, der Hymnus auf den Normalmenschen, die kindische Gesellschaftskritik: die Gerichte sollen abgeschafft werden, die Erziehung soll abgeschafft werden, die alten Sprachen als ungenial verboten werden, dafür hat man es mit den Trieben: dreckig soll der Mensch sein, die Frauen soll man tauschen und von anderen erhalten lassen, trinken soll man, denn Trinken ist billiger als Essen, und außerdem stinkt man danach, ja, selbst den Dadaismus, dessen Auftreten in Zürich und Berlin unsere Gegenwart kürzlich so interessant fand, finden wir in einem Roman der sechziger Jahre, dem Roman >Was tun< von Tschernischewsky, schon vor: Kunst heißt, lesen wir dort, zwei Klaviere in einen Salon rücken, an jedes eine Dame setzen, um jedes soll sich ein Halbchor bilden, und jeder Beteiligte singt oder spielt dann gleichzeitig recht laut ein anderes Lied vor sich hin. Dies wurde als die Melodie der Revolution und die Orgie der Freiheit bezeichnet. Wir sehen also, die geistigen Auswirkungen des geschichtsphilosophischen Materialismus beginnen in den sechziger Jahren, sind also mindetens achtzig Jahre alt, also eigentlich sind sie das Alte und das Reaktionäre. Eigentlich, und damit stoßen wir in die Zukunft vor, ist heute aller Materialismus reaktionär, sowohl der der Geschichtsphilosophie wie der in der Gesinnung: nämlich rückwärts blickend, rückwärts handelnd, denn vor uns liegt ja schon ein ganz anderer Mensch und ein ganz anderes Ziel.Aus Gottfried Benn, Nach dem Nihilismus (Essay 1931)
.
Links. Gottfried Benn
Wie Gedichte entstehen – Hitler&Benn – Gedichte – Benn&Nationalsozialismus – Kleine Aster – Blinddarm – Herkunft Plagiat – Auf deine Lieder… –
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Von den Erinnerungen an die Liebe
Sören Kierkegaard
.
Cordelia, meine Cordelia, du meine Cordelia! […] Sie hat Phantasie, Seele, Leidenschaft, kurz, alle Substantialitäten, aber nicht subjektiv reflektiert. Davon hat ein Zufall mich heute so recht überzeugt. Ich weiß von der Firma Jansen, daß sie nicht musiziert, da das den Grundsätzen der Tante zuwider läuft. Ich habe das stets bedauert, denn die Musik ist immer ein gutes Kommunikationsmittel, wenn man sich einem jungen Mädchen nähern will, vorausgesetzt freilich, daß man so vorsichtig ist, nicht als Kenner aufzutreten.
Heute ging ich zu Frau Jansen hinauf, ich hatte die Tür halb geöffnet, ohne anzuklopfen, eine Unverschämtheit, die mir oftmals zugute kommt und die ich, wenn es nottut, durch eine Lächerlichkeit wettmache, dadurch nämlich, daß ich an die offene Tür klopfe – sie saß dort allein am Fortepiano – sie schien heimlich zu spielen – es war eine kleine schwedische Melodie – sie spielte ohne Geläufigkeit, sie wurde ungeduldig, doch dann erklangen wieder sanftere Töne.
Ich machte die Tür zu und blieb draußen, auf den Wechsel ihrer Stimmungen lauschend, es war zuweilen eine Leidenschaft in ihrem Spiel, die an Jungfer Mettelil erinnerte, welche die Goldharfe schlug, daß die Milch aus ihren Brüsten sprang. Es war etwas Wehmütiges, aber auch etwas Dithyrambisches in ihrem Vortrag. – Ich hätte vorstürzen, diesen Augenblick ergreifen können – es wäre Torheit gewesen. –
Die Erinnerung ist nicht nur ein Mittel der Konservierung, sondern auch der Vermehrung, was von Erinnerung durchdrungen ist, wirkt doppelt. – Man findet in Büchern, zumal in Gesangbüchern, oft eine kleine Blume – ein schöner Augenblick war es, der den Anlaß gegeben hat, sie in das Buch zu legen, aber schöner noch ist doch die Erinnerung.
Sie macht offenbar ein Geheimnis daraus, daß sie spielt, oder spielt sie etwa nur diese kleine schwedische Melodie – hat diese etwa ein besonderes Interesse für sie? Das alles weiß ich nicht, deshalb aber ist dieses Ereignis für mich von großer Wichtigkeit. Wenn ich nun einmal vertraulicher mit ihr rede, dann lenke ich sie ganz heimlich auf diesen Punkt hin und lasse sie in diese Fallgrube stürzen. ■Aus Sören Kirkegaard, Das Tagebuch des Verführers (Entweder-Oder, 1843), Deutscher Taschenbuch Verlag
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Vom Christsein in problematischer Welt
Emerich Coreth
.
Von größter Bedeutung ist, daß die Christen in unserer Zeit ihre Sendung und Verantwortung gegenüber den brennenden Problemen der heutigen Welt erkennen und in Angriff nehmen. Auf die Probleme des materiellen Fortschritts in der technisch-industrialisierten Welt, auf den erschreckenden Sinnverlust in dieser modernen Gesellschaft wurde schon hingewiesen, und darauf, daß der christliche Glaube hier gültige Antwort zu geben hat.
Aber es geht nicht nur um transzendente Sinngebung, sondern auch um die weltimmanenten Probleme selbst, das ungeheuere soziale Problem der heutigen Menschheit, das Gefälle zwischen arm und reich, die grauenhafte Not und das Elend, in dem Hunderte Millionen von Menschen in unterentwickelten Ländern leben – und täglich an Hunger sterben – gegenüber dem Wohlstand der Industrienationen. Die Kirche hat sich aus dem Geist Christi auf die Seite der Armen, der Unterdrückten, der Benachteiligten zu stellen, und sie tut es in zunehmendem Maße. Sicher hat das Evangelium nicht für alle konkreten sozialen und wirtschaftlichen Fragen fertige Patentlösungen anzubieten. Wohl aber kann ein Christentum, das die Botschaft Jesu ernst nimmt, nicht nur ewiges Heil schenken, sondern auch – in einer heillosen Welt – irdisches Heil zu vermitteln helfen: aus dem Geist christlicher Liebe, durch den Einsatz für Friede und Gerechtigkeit, das Sein-für-andere, wie es Christus gelebt und gelehrt hat.
Zwar ist es nicht richtig, das Christsein auf die horizontale Ebene zu reduzieren und darüber die vertikale Dimension zu vergessen oder zu verschweigen, aber ebenso unrichtig und einseitig wäre es, Christsein nur in der vertikalen ohne die horizontale Dimension verwirklichen zu wollen. Beides gehört zusammen: Liebe zu Gott und zu den Menschen, Religion und Einsatz für den Mitmenschen. Christliche Liebe ist aber mehr als bloße »Mitmenschlichkeit«, weil sie im Glauben an Gott gründet, den Gott aller Menschen, der das Heil aller will und in seiner Liebe alle umfängt. Nur aus Gott, der uns – uns alle – zuvor geliebt hat, kann echte, selbstlos dienende und helfende Liebe zu den Menschen Mut und Kraft, Geduld und Zuversicht schöpfen.
Solche Überlegungen zur Weltsendung des christlichen Glaubens in unserer Zeit gehören mit hinein in mein Verständnis des Christseins. Diese Aspekte und Dimensionen der christlichen Botschaft sind die Entfaltung des einen Notwendigen, die folgerichtige Ausstrahlung und Auswirkung des einzig Zentralen. So bleibt schließlich meine Antwort auf die Frage, warum ich Christ bin, auf die Mitte bezogen, aus der das Ganze lebt. Die Antwort heißt ganz einfach: weil ich glaube.Aus Emerich Coreth, Christsein aus Herkunft und Berufung, in: W.Jens (Hrsg.), Warum ich Christ bin, Kindler Verlag 1979
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Von den beherrschenden Gedanken der herrschenden Klasse
Karl Marx
.
Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken, d.h. die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. Die Klasse, die die Mittel zur materiellen Produktion zu ihrer Verfügung hat, disponiert damit zugleich über die Mittel zur geistigen Produktion, so daß ihr damit zugleich im Durchschnitt die Gedanken derer, denen die Mittel zur geistigen Produktion abgehen, unterworfen sind. Die herrschenden Gedanken sind weiter nichts als der ideelle Ausdruck der herrschenden materiellen Verhältnisse, die als Gedanken gefaßten, herrschenden materiellen Verhältnisse; also die Verhältnisse, die eben die eine Klasse zur herrschenden machen, also die Gedanken ihrer Herrschaft. Die Individuen, welche die herrschende Klasse ausmachen, haben unter anderem auch Bewußtsein und denken daher; insofern sie also als Klasse herrschen und den ganzen Umfang einer Geschichtsepoche bestimmen, versteht es sich von selbst, daß sie dies in ihrer ganzen Ausdehnung tun, also unter anderem auch als Denkende, als Produzenten von Gedanken herrschen, die Produktion und Distribution der Gedanken ihrer Zeit regeln; daß also ihre Gedanken die herrschenden Gedanken der Epoche sind.
Zu einer Zeit z.B. und in einen Lande, wo königliche Macht, Aristokratie und Bourgeoisie sich um die Herrschaft streiten, wo also die Herrschaft geteilt ist, zeigt sich als herrschender Gedanke die Doktrin von der Teilung der Gewalten, die nun als ein »ewiges Gesetz« ausgesprochen wird. – Die Teilung der Arbeit, die wir als eine der Hauptmächte der bisherigen Geschichte vorfinden, äußert sich nun auch in der herrschenden Klasse als Teilung der geistigen und materiellen Arbeit, so daß innerhalb dieser Klasse der eine Teil als die Denker dieser Klasse auftritt (die aktiven konzeptiven Ideologen derselben, welche die Ausbildung der Illusion dieser Klasse über sich selbst zu ihrem Hauptnahrungszweige machen), während die anderen sich zu diesen Gedanken und Illusionen mehr passiv und rezeptiv verhalten, weil sie in der Wirklichkeit die aktiven Mitglieder dieser Klasse sind und weniger Zeit dazu haben, sich Illusionen und Gedanken über sich selbst zu machen. Innerhalb dieser Klasse kann diese Spaltung derselben sich sogar zu einer gewissen Entgegensetzung und Feindschaft beider Teile entwickeln, die aber bei jeder praktischen Kollision, wo die Klasse selbst gefährdet ist, von selbst wegfällt, wo denn auch der Schein verschwindet, als wenn die herrschenden Gedanken nicht die Gedanken der herrschenden Klasse wären und eine von der Macht dieser Klasse unterschiedene Macht hätten.Die Existenz revolutionärer Gedanken in einer bestimmten Epoche setzt bereits die Existenz einer revolutionären Klasse voraus […]. Löst man nun bei der Auffassung des geschichtlichen Verlaufs die Gedanken der herrschenden Klasse von der herrschenden Klasse los, verselbständigt man sie, bleibt dabei stehen, daß in einer Epoche diese und jene Gedanken geherrscht haben, ohne sich um die Bedingungen der Produktion und um die Produzenten dieser Gedanken zu kümmern, läßt man also die den Gedanken zugrunde liegenden Individuen und Weltzustände weg, so kann man z.B. sagen, daß während der Zeit, in der die Aristokratie herrschte, die Begriffe Ehre, Treue etc., während der Herrschaft der Bourgeoisie die Begriffe Freiheit, Gleichheit etc. herrschten. Die herrschende Klasse selbst bildet sich dies im Durchschnitt ein. Diese Geschichtsauffassung, die allen Geschichtsschreibern vorzugsweise seit dem 18. Jahrhundert gemeinsam ist, wird notwendig auf das Phänomen stoßen, daß immer abstraktere Gedanken herrschen, d.h. Gedanken, die immer mehr die Form der Allgemeinheit annehmen.
Jede neue Klasse nämlich, die sich an die Stelle einer vor ihr herrschenden setzt, ist genötigt, schon um ihren Zweck durchzuführen, ihr Interesse als das gemeinschaftliche Interesse aller Mitglieder der Gesellschaft darzustellen, d.h. ideell ausgedrückt: ihren Gedanken die Form der Allgemeinheit zu geben, sie als die einzig vernünftigen, allgemein gültigen darzustellen. […] Die revolutionierende Klasse tritt von vornherein, schon weil sie einer Klasse gegenübersteht, nicht als Klasse, sondern als Vertreterin der ganzen Gesellschaft auf, sie erscheint als die ganze Masse der Gesellschaft gegenüber der einzigen herrschenden Klasse. Sie kann dies, weil im Anfang ihr Interesse wirklich noch mehr mit dem gemeinschaftlichen Interesse aller übrigen nicht herrschenden Klassen zusammenhängt, sich unter dem Druck der bisherigen Verhältnisse noch nicht als besonderes Interesse einer besonderen Klasse entwickeln konnte. Ihr Sieg nutzt daher auch vielen Individuen der übrigen, nicht zur Herrschaft kommenden Klasse, aber nur insofern, als er diese Individuen jetzt in den Stand setzt, sich in die herrschende Klasse zu erheben. ■Aus Karl Marx, Über die Produktion des Bewußtseins, in: Die deutsche Ideologie (1846)
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über die Begehrsucht
Buddha
.
Wahrlich, durch Begehrsucht bedingt, durch Begehrsucht veranlaßt, durch Begehrsucht bewogen, eben bloß aus Begehrsucht streiten Fürsten mit Fürsten, Adelige mit Adeligen, Priester mit Priestern, Hausväter mit Hausvätern, streitet die Mutter mit dem Sohn, der Sohn mit der Mutter, der Vater mit dem Sohn, der Sohn mit dem Vater, streitet Bruder mit Bruder, Bruder mit Schwester, Schwester mit Bruder, Freund mit Freund. Und so in Streit, Zank und Zwist geraten greifen sie sich gegenseitig mit Fäusten, Stöcken und Schwertern an. Dabei nun erleiden sie den Tod oder tödliche Schmerzen. Das aber ist der Unsegen der Begehrsucht, die sichtbare Leidensanhäufung, durch Begehrsucht bedingt, durch Begehrsucht veranlaßt, durch Begehrsucht erzeugt, durch Begehrsucht verursacht.
Und fernerhin: durch Begehrsucht bedingt, durch Begehrsucht veranlaßt, durch Begehrsucht bewogen, eben bloß aus Begehrsucht brechen die Menschen in Häuser ein, rauben, plündern Häuser, verüben Wegelagerei, gehen zu den Frauen anderer. Solche nehmen die Fürsten fest und verhängen mancherlei Strafen über sie. Und so erleiden sie den Tod oder tödliche Schmerzen. Das aber ist der Unsegen der Begehrsucht, die sichtbare Leidensanhäufung, durch Begehrsucht bedingt, durch Begehrsucht veranlaßt, durch Begehrsucht erzeugt, durch Begehrsucht verursacht.
Und fernerhin: durch Begehrsucht bedingt, durch Begehrsucht veranlaßt, durch Begehrsucht bewogen, eben bloß aus Begehrsucht führen die Menschen einen üblen Wandel in Werken, Worten und Gedanken. Und in Werken, Worten und Gedanken einen üblen Wandel führend, geraten sie beim Zerfall des Körpers, nach dem Tode, in ein niederes Dasein, auf leidvolle Fährte, in verstoßene Welt, zur Hölle. Das aber ist der Unsegen der Begehrsucht, die jenseitige Leidensanhäufung, durch Begehrsucht bedingt, durch Begehrsucht veranlasst, durch Begehrsucht erzeugt, durch Begehrsucht verursacht. ■
Aus Nyanatiloka, Das Wort des Buddha, Beyerlein&Steinschulte Verlag 1906
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Von der Natur in der Krankheit
Paracelsus
.
Die Natur ist es, die dem Kranken die Arznei gibt. So Natur die Arznei gibt, muß sie den Kranken erkennen. Denn ohne Erkenntnis kann sie ihm nichts geben. Nun liegt die Erkenntnis nit im Arzt, sondern in der Natur. So Natur sich kennt, stellt sie das Rezept zusammen. Krankheit und Arznei kommen beide aus der Natur und nit vom Arzt. Von diesen beiden soll der Arzt lernen. Was sie ihn lehren, soll er tun. Lehren sie ihn nichts, so kann und weiß er nichts. Denn beide, Arznei und Krankheit, unterliegen der Natur, die ihr eigener Arzt ist.
Die Natur allein lehrt den Arzt, nit der Mensch. So nun in der Natur so viel liegt, ist es vonnöten, darüber zu handeln, wer die Natur sei. Das ist eben Gegenstand der Philosophie. Bei der Definition, was Philosophie sei, gibt es einen Streit zwischen mir und meinen Gegnern. Was sie für Philosophie halten, halte ich für eine Drüse, das heißt, sie sind wie ein Arzt, der seine Kunst aus den Drüsen nimmt, die außen am Leibe wachsen, ihm gleichsehen, aber nicht gleich sind. Derartig sind diese Arztphilosophen… Daß sie etwas von meiner Philosophie halten, ist nit gut möglich. Darum wird meine Philosophie von ihnen nit gebraucht, auch nit von andern Narren.
Der Arzt soll vor allem Himmel und Erde kennen, ihre Materie, Art und ihr Wesen. So er darüber unterrichtet ist, mag er mit dem Studium der Arznei beginnen. Denn nach dieser Erfahrung, diesem Wissen und dieser Kunst beginnt der Arzt. Mein Unterfangen und Grundsatz ist, daß die Arzneikunst so geübt werde, daß aus dem äußern Arzt der innere geboren werde und wo der äußere nit sei, da sei auch der innere nit, und was der innere treibt, führt und lernt aus sich selbsten, das ist umsonst. ■Aus Paracelsus, Paragranum (1529)
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über den Menschen
Georg Christoph Lichtenberg
.
Jede Größe ist sich selbst gleich, sagt er; und wiegt endlich die Sonne mit allen Planeten ab. Er weiß die Zeit der Bedeckung entfernter Planeten und weiß den Untergang einer Welt nicht, die seinen Körper ausmacht. Ich bin nach Gottes Bild geschaffen, sagt er, und dort schlurft er den Urin des unsterblichen Lama. Staunt eine Bienenzelle mit Verwunderung an und kann selbst Peterskirchen bauen. Wirft Hirsenkörner durch das Ohr einer Nadel oder bestreicht sie mit einem Stein und findet auf dem Meer seinen Weg. Nennt Gott bald das tätigste Wesen, bald den Unbeweglichen, gibt dem Engel bald Sonnenlicht zum Gewand und bald Vielfraß-Pelz (Kamtschatka), betet bald Mäuse und Würmer an, glaubt hier an einen Gott, vor dem tausend Jahre sind wie der Tag, der gestern vergangen ist, und bald an gar keinen. Ermordet sich selbst und vergöttert sich selbst, kastriert sich selbst, brennt und hurt sich zu Tode, tut Gelübde der Keuschheit, und verbrennt einer … wegen Troja. Frißt seine Mitbrüder, seinen Mist. (Mehr verdaut und besser geordnet.) ■
Aus G.Ch. Lichtenberg, Aphorismen, Göttingen 177
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über die romantische Welt
Novalis
.
Wir leben in einem kolossalen (im Großen und im Kleinen) Roman. Betrachtung der Begebenheiten um uns her. Romantische Orientierung, Beurteilung und Behandlung des Menschenlebens.
Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder. Romantisieren ist nichts als eine qualitative Potenzierung. Das niedere Selbst wird mit einem besseren Selbst in dieser Operation identifiziert. So wie wir selbst eine solche qualitative Potenzreihe sind. Diese Operation ist noch ganz unbekannt. Indem ich dem Gemeinen eine hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es. ■
Aus Novalis, «Fragmente» (1800)
.
.
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über die Wahrheit in der Wissenschaft
Paul Häberlin
.
Wahrheit ist eine strenge Herrin. Wo es um Erkenntnis geht, da darf keine andre Rücksicht walten. Vieles ist brauchbar, was gar nicht wahr ist, und was wahr ist, braucht nicht wirtschaftlich verwendbar zu sein. Eine Wissenschaft, die nach solcher Verwendbarkeit schielt, läßt sich von ihrer eigentlichen Bestimmung ablenken, und sei es auch nur dadurch, daß sie sich ihre Aufgaben oder ihre Forschungsgebiete von außen her vorschreiben läßt. Es gibt nicht nur eine Politisierung der Wissenschaft, deren Bedenklichkeit wir alle einsehen, sondern auch eine Kommerzialisierung oder Ökonomisierung, die nicht minder an das Herz der Wissenschaft greift.
Lassen Sie mich ein Beispiel nennen, das mir selber naheliegt: die Psychologie. Die Anwendung psychologischer Einsichten auf das Wirtschaftsleben, auf den Verkehr, auf die Behandlung der Menschen ist möglich, und gegen «angewandte Psychologie» in diesem $inne möchte ich nichts sagen. Etwas anderes aber ist es, wenn Psychologie selber wesentlich unter dem Gesichtspunkt solcher Verwendung arbeitet. Dann fragt sie nicht mehr – wie sie als Wissenschaft ausschließlich immer müßte – nach der Wahrheit über den Menschen als Menschen, sondern sie fragt nach dem Menschen gerade nur so weit, als er für die Wirtschaft in Betracht kommt, wenn sie sich nicht gar darauf beschränkt, zu fragen, wie er, der Mensch, als Subjekt oder vor allem als Objekt der Wirtschaft verwendbar sei.
Derartiges Fragen aber wird dem Menschen, und der Aufgabe der Wissenschaft vom Menschen, in doppelter Weise nicht gerecht. Einmal kann die psychologische Wahrheit überhaupt nicht angegangen, geschweige denn gefördert werden, wenn nicht von vornherein und jederzeit der ganze Mensch im Blickfeld steht, nicht nur das, was an ihm ökonomisch in Betracht kommt. Vor allem aber tötet solche Einstellung den Willen zur Wahrheit selbst. Denn sie ist zufrieden, wenn sie gewisse menschliche Züge oder Verhaltensweisen festgestellt hat, welche ihr wirtschaftspraktisch relevant erscheinen. Das ist, grob gesagt, nicht anders, als wenn etwa Botanik sich damit begnügen wollte, festzustellen, welche Pflanzen oder Pflanzenteile eßbar oder sonstwie verwendbar seien, oder wie man sie zu diesem Zweck behandeln müsse. Daß es da Hintergründe, Rätsel, Geheimnisse, Probleme gibt, auf die es eigentlich ankommt und denen gegenüber jedes zufriedene Haltmachen ein Verrat an der wissenschaftlichen Ehrfurcht vor der Wahrheit ist, dies sieht solches Genügen an der Aufdeckung von Verwendbarkeiten nicht; ja es hindert, darnach überhaupt zu fragen. Wahrheit läßt nicht mit sich markten; wer nicht für sie ist, ist wider sie. ■Aus Paul Häberlin, Philosophie und Wirtschaft, Zürich 1948
.
.
Das Zitat der Woche
.
Von den Hauptnährmitteln der Seele
Ludwig Klages
.
Welches sind die Hauptnährmittel der Seele? Das Wunder, die Liebe und das Vorbild. Das Wunder findet die Seele z.B. in der Landschaft, in der Dichtung, in der Schönheit. Man gewähre ihr also die Landschaft, die Dichtung, die Schönheit und sehe, ob sie daran erblühe. Die Liebe im weitesten Wortsinn, wozu auch gehört Verehrung, Anbetung, Bewunderung, ja jede Art von herzlicher Anerkennung, wärmt wahrhaft wirksam nur aus dem Liebenden. Das ewige Bild dieser Seelenführerschaft ist das Bild der liebenden Mutter mit dem geliebten Kinde. Man gebe also der Seele alle Strahlen mütterlicher Liebe und sehe, wie sie daran erblühe. Das Vorbild sind Götter, Dichter und Helden. Man lasse die Seele des Anblicks der Heroen teilhaftig werden und sehe, wie sie daran erblüht.
Und wenn sie an keinem dieser drei erblüht, dann ist ihr keine Blühkraft gegeben, und kein Seelenführer kann solche hervorzaubern. Denn dies ist das Geheimnis der Seele, daß sie nur im Geben reicher wird. Nicht die Liebe, die eins empfängt, sondern die Liebe, die durch empfangene Liebe in ihm selbst entzündet wurde, die ist es, welche die Seele nährt. Und alle Wunder und Vorbilder der Welt bleiben bloß eine Theatervorstellung, wenn sie nicht in der Seele das geheime Wunder und den geheimen Helden zu wecken vermögen. ■
Aus Ludwig Klages, Briefe über Ethik (1918)
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über den Menschen als staatliches Wesen
Johann J. Bachofen
.
Aristoteles hat es schon gesagt: «Der Mensch ist ein staatliches Wesen», und es werden wohl noch zweitausend Jahre vergehen, ehe man dieselbe Idee kürzer und besser ausdrückt. Der Staat ist der innersten Natur des Menschen selbst entnommen. Er ist nicht Erfindung eines verdorbenen Geschlechts, nicht der Deckmantel unserer Schadhaftigkeit; er ist vielmehr die Verkörperung der besseren Menschennatur; nicht ein Damm gegen größeren Verfall, sondern die Verbrüderung zur Erreichung der höchsten Zwecke, eine Vereinigung aller besseren Kräfte in jeder Wissenschaft, jeder Kunst, jeder Tugend, jeder Vollendung.
Da aber das Ziel einer solchen Verbrüderung nicht in einer Generation, nicht in vielen erreicht werden kann, so ist der Staat nicht bloß die Verbrüderung der lebenden Menschen, sondern der Lebenden und der Toten und derer, die noch geboren werden!
Jeder einzelne Staat ist ferner bloß eine teilweise Verbrüderung in der großen und allgemeinen Verbrüderung der ganzen Menschheit, ein Glied zur Bildung der großen Kette, welche die niederen mit den höheren Naturen, die sichtbare mit der unsichtbaren Welt verbindet. Das ist der Zweck, das die Bestimmung des Staates; fürwahr eine Bestimmung, die in sich selbst die höchste Seite der menschlichen Natur offenbart!
Beneiden wir also die Anhänger jenes naturrechtlichen Systems nicht um die zerstörte Vollkommenheit ihres ersten Zustandes, noch um ihr verlorenes Paradies. Denn für uns besteht nun die Geschichte, zumal die des Rechts, nicht in der traurigen Entfaltung eines immer tieferen Verfalls, sondern in dem steten Fortgang der Entwicklung zu größerer Vollkommenheit. ■Aus Johann Jakob Bachofen, Basler Antrittsrede zur Rechts-Professur 1841
.
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über Gefühl und Anschauung
Friedrich Schleiermacher
.
Anschauung ohne Gefühl ist nichts und kann weder den rechten Ursprung noch die rechte Kraft haben, Gefühl ohne Anschauung ist auch nichts: beide sind nur dann und deswegen etwas, wenn und weil sie ursprünglich eins und ungetrennt sind. Jener erste geheimnisvolle Augenblick, der bei jeder sinnlichen Wahrnehmung vorkommt, ehe noch Anschauung und Gefühl sich trennen, wo der Sinn und sein Gegenstand gleichsam ineinander geflossen und eins geworden sind, ehe noch beide an ihren ursprünglichen Platz zurückkehren – ich weiß, wie unbeschreiblich er ist, und wie schnell er vorübergeht, ich wollte aber, ihr könntet ihn festhalten und auch in der höheren und göttlichen religiösen Tätigkeit des Gemüts ihn wieder erkennen. Könnte und dürfte ich ihn doch aussprechen, andeuten wenigstens, ohne ihn zu entheiligen! Flüchtig ist er und durchsichtig, wie der erste Duft, womit der Tau die erwachten Blumen anhaucht, schamhaft und zart wie ein jungfräulicher Kuß, heilig und fruchtbar wie eine bräutliche Umarmung; ja nicht wie dies, sondern er ist als dieses selbst. Schnell und zauberisch entwickelt sich eine Erscheinung, eine Begebenheit zu einem Bilde des Universums.
So wie sie sich formt, die geliebte und immer gesuchte Gestalt, flieht ihr meine Seele entgegen, ich umfange sie nicht wie einen Schatten, sondern wie das heilige Wesen selbst. Ich liege am Busen der unendlichen Welt: ich bin in diesem Augenblick ihre Seele, denn ich fühle alle ihre Kräfte und ihr unendliches Leben, wie mein eigenes, sie ist in diesem Augenblicke mein Leib, denn ich durchdringe ihre Muskeln und ihre Glieder wie meine eigenen, und ihre innersten Nerven bewegen sich nach meinem Sinn und meiner Ahndung wie die meinigen. Die geringste Erschütterung, und es verweht die heilige Umarmung, und nun erst steht die Anschauung vor mir als eine abgesonderte Gestalt; ich messe sie, und sie spiegelt sich in der offenen Seele wie ein Bild der sich entwindenden Geliebten in dem aufgeschlagenen Auge des Jünglings, und nun erst arbeitet sich das Gefühl aus dem Innern empor und verbreitet sich wie die Röte der Scham und der Lust auf seiner Wange. ■
Aus Friedrich Schleiermacher, Über die Religion – Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern, Berlin 1799
.
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über die Entwicklung zur Demokratie
Alexis de Tocqueville
.
Seit die Bürger anfingen, den Grund und Boden nicht mehr als Lehen zu besitzen, und seit der mittlerweile aufgekommene Reichtum an beweglichen Gütern Einfluß und Macht verlieh, gibt es keine Entwicklungen auf dem Gebiet der Künste, keine Vervollkommnungen in Handel und Gewerbe, die nicht neue Bausteine zur Gleichheit unter den Menschen geliefert hätten. Von diesem Augenblick an sind alle Entwicklungen, alle neuen Bedürfnisse, alle Wünsche, die sich befriedigen wollen, nur Schritte auf dem Wege zur allgemeinen Nivellierung. Die Neigung zum Luxus, die Liebe zum Krieg, die Herrschaft der Mode, die künstlichsten wie die tiefsten Leidenschaften des menschlichen Herzens scheinen miteinander darauf hin zu arbeiten, die Reichen arm und die Armen reich zu machen.
Seit die geistige Arbeit zu einer Quelle des Reichtums und der Macht wurde, muß man jede Entwicklung der Wissenschaft, jede neue Erkenntnis, jede neue Vorstellung als einen Keim der dem Volk zubereiteten Macht betrachten. Dichtkunst, Beredsamkeit, Witz, Einbildungskraft, Gedankentiefe, alle die Gaben, die der Himmel nach Belieben austeilt, förderten die Demokratie, und selbst wenn sie sich im Besitze der Gegner der Demokratie befanden, dienten sie doch ihrer Sache, indem sie Zeugnis gaben von der natürlichen Größe des Menschen; alle Errungenschaften der Demokratie breiteten sich mit denen der Zivilisation und der Bildung aus, und die Literatur wurde zu einem jedermann offenen Arsenal, aus dem sich die Schwachen und die Armen täglich bewaffneten.
Durchläuft man die Seiten unserer Geschichte, so findet man in den letzten siebenhundert Jahren keine bedeutenden Ereignisse, die nicht die Entwicklung der Gleichheit gefördert hätten. ■Aus Alexis de Tocqueville, Demokratie in Amerika, Paris 1840
.
.
.
.
Das Zitat der der Woche
.
Von der Notwendigkeit des Handelns
Noam Chomsky
.
Wer nichts weiß, kann niemanden verraten. Er geht sorglos durchs Leben. Wir aber, die wir in einer Tradition stehen – der europäischen – und diese Tradition fortsetzen, wir haben mit Wissen und Einsicht, wir haben bei vollem Bewusstsein betrogen; wir haben die Kriege sorgfältig analysiert, bevor sie erklärt wurden. Aber wir haben sie nicht verhindert. (Und viele von uns wurden zu deren Propagandisten, sobald sie erklärt waren.) Wir beschreiben, wie die Armen von den Reichen ausgeplündert werden. Und wir leben unter den Reichen. Wir leben von der Beute und verkuppeln den Reichen Ideen.
Noam Chomsky
Wir haben Folterungen beschrieben und unsere Namen unter Resolutionen gegen die Folter gesetzt, aber wir haben sie nicht verhindert. (Und wir selber wurden zu Folterknechten, wenn höhere Interessen das verlangten, und machten uns zu den Ideologen der Tortur.) Und nun analysieren wir wieder die Weltlage, wir schreiben über die Kriege und erklären, warum die Massen arm sind und hungern. Aber mehr tun wir nicht. Wir sind nicht die Träger des Bewusstseins. Wir sind die Huren des Verstandes.
Aus Noam Chomsky, Über Erkenntnis und Freiheit, Suhrkamp/Frankfurt 1973
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Vom Glauben und vom Wissen
Christian Nürnberger
.
Wir stehen, was die letzten Fragen betrifft, wieder da, wo wir vor 250 Jahren aufgebrochen sind, um diese Fragen durch das Unternehmen Wissenschaft einer endgültigen Klärung zuzuführen. Dieses Unternehmen entdeckt heute seine Unzuständigkeit für eine solche Klärung. Die Unzuständigkeit resultiert aus der mittlerweile erfolgten Selbstbeschränkung bei der Wahrheitssuche. Die Wissenschaft verlangt aus guten Gründen, bevor sie etwas als wissenschaftlich bewiesenes Faktum anerkennt, dass dieses Faktum jederzeit an jedem Ort der Welt unter Befolgung der angegebenen Methode reproduzierbar nachgewiesen werden kann. Dadurch entzieht sie aber weite Teile der Wirklichkeit dem wissenschaftlichen Zugriff, denn jeder weiß aus seinem eigenen Leben, dass vieles, meist sogar das Wesentliche, aus einmaligen, unwiederholbaren, für andere kaum kontrollierbaren Ereignissen besteht.
Das, was uns in unserem Innersten existenziell betrifft – Liebe, Leid, Hass, Freundschaft, Vertrauen, Freude, Trauer, Glück, Freiheit, Religion – also das eigentlich Interessante in unserem Leben, ist dieser Art von rigider Wissenschaft prinzipiell unzugänglich. Daher kann sie auch keine negative oder positive oder sonst wie geartete Aussage über diesen Teil der Realität machen und rück-überweist uns zu Philosophie, Theologie und Ethik. Insofern liegt in der Selbstbeschränkung heutiger Wissenschaft die stärkste Kritik am Bultmannschen Theologie-Ansatz. Das allzu dogmatische Anlegen wissenschaftlicher Kriterien an den Glauben könnte eine voreilige Unterwerfung gewesen sein.
Weil die ganze Wirklichkeit größer ist als jener Teilbereich, der wissenschaftlichen Methoden zugänglich ist, steht die Tür zu Religion und Glaube wieder offen. An Wunder glauben zu sollen, wird uns dennoch weiterhin als Zumutung erscheinen, aber die Frage, was Menschen intellektuell zugemutet werden kann, spielt keine besonders große Rolle, wenn es um Gott und die Wahrheit geht, denn das menschliche Fassungsvermögen ist immer zu klein für Gott, und darum sind wir damit sowieso und immerzu überfordert.
Selbst wenn es Gott nicht geben sollte, scheitern wir an den letzten Fragen, denn der Urknall trägt dazu gar nichts bei. Was war vorher? Was hat ihn bewirkt? Eben darauf haben wir keine Antwort. Wer aber daraus folgert, gerade deshalb müsse man annehmen, ein Schöpfergott stecke hinter dem Urknall, denn von nichts kommt nichts, verkennt, dass die letzte Frage damit nur um ein weiteres, allerletztes Glied nach hinten verschoben wird, denn woher kommt Gott? Wie ist er entstanden? Die Antwort, er sei nicht entstanden, sondern seit ewiger Zeit immer schon dagewesen, überfordert uns vielleicht noch mehr als die Vorstellung, der Kosmos sei aus dem Nichts entstanden. So oder so stoßen wir an eine Erkenntnisgrenze, die, wenn überhaupt, nur durch religiöse Offenbarung oder durch Glauben zu überwinden ist.
Daher gilt auch in der Wissensgesellschaft weiter die alte Volksweisheit, wonach es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gebe, als sich unsere Schulweisheit träumen lässt. Uns wird also, wo es um letzte Wahrheiten geht, sowieso mehr zugemutet, als wir fassen können. Daher wäre eine Theologie, die den Glauben so lange zurechtvernünftelt, bis er endlich vom begrenzten menschlichen Verstand erfasst und vom letzten Allerwelts-Atheisten akzeptiert werden kann, wertlos und überflüssig. Und eine Theologie, welche die gesamte Bibel einfach nur deshalb »erledigte«, weil sie angeblich inkompatibel zum aufgeklärten Bewusstsein sei, überschritte ihre Grenzen.
Glaube und Wissen werden wir daher nie zur Deckungsgleichheit bringen können, sollten es auch gar nicht versuchen, denn es sind zwei verschiedene Kategorien, die auseinanderzuhalten sind. Ginge Glaube in Wissen auf, wäre er kein Glaube mehr. Verzichteten wir aber darauf, Glaubensinhalte mit dem Wissen zu konfrontieren und zu prüfen, handelte es sich nicht mehr um echten Glauben, sondern um unsicheres Wissen, Noch-nicht-Wissen, Unwissen, Vermutung oder schlicht um zum Glauben erhobene Ignoranz, welche oft auch noch frech das grundgesetzlich verbriefte Recht der Religionsfreiheit für sich reklamiert, um unter diesem Schutz allerhand Teufeleien auszuhecken.
Die Tür zum Glauben ist offen, auch in der Wissens- und Hightech-Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Aber wer den Weg zu dieser Tür weisen, gar deren Schwelle überschreiten will und verlangt, ihm auf diesem Weg zu folgen, muss sich kritisch fragen lassen, warum er glaubt, dass es die richtige Tür ist. Echter Glaube, der auch heute noch ernst genommen und respektiert werden will, muss allen seit der Aufklärung vorgebrachten religionskritischen Einwänden standhalten. Das aber gelingt nur, wenn sich der Glaubende bemüht, das Niveau der Aufklärung zu erklimmen und Anschluss zu halten an den jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Diskussion.Aus: Christian Nürnberger, Glaube und Wissen, in: Jesus für Zweifler, Gütersloher Verlagshaus 2007
.
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über den Neoliberalismus
Urs Marti
.
Konflikte nehmen in einer Gesellschaft im gleichen Maß zu wie der Abstand zwischen Reichtum und Armut, Macht und Ohnmacht; auf dieser Einsicht baut das politische Denken seit Jahrtausenden auf. Manche Indizien sprechen dafür, dass es um die Stabilität moderner Gesellschaften nicht zum Besten steht. Gewiss, die revolutionäre Linke ist, wo sie überhaupt eine Rolle spielt, minoritär, von einigen lateinamerikanischen Ländern vielleicht abgesehen. Doch dem Neoliberalismus als der derzeit wohl konsistentesten Doktrin zur Verteidigung der kapitalistischen Marktwirtschaft ist es bislang nicht gelungen, ein konsensfähiges politisches Projekt zu formulieren oder gar umzusetzen. Derweil nimmt der Abstand zwischen Reich und Arm absurde Ausmaße an, der Mittelstand fürchtet den Abstieg, und niemand kann sich mit der Hoffnung trösten, der Markt belohne Fleiß und bestrafe Faulheit […]
Indizien der Destabilisierung sind derzeit aber nicht revolutionäre Bewegungen, eher Pathologien unterschiedlicher Art, Frustrationen und Ressentiments. Demokratische Verfahren mutieren zu marktähnlichen Mechanismen, und häufig drängt sich der Eindruck auf, nachgefragt wurde primär, was den größten Unterhaltungswert verspricht. Beliebt ist der grobe Ton, das Aufhetzen, die Verunglimpfung und moralische Diskreditierung der Gegenseite. Es entbehrt nicht der Ironie, wenn in einem Klima der permanenten Mobilisierung gegen ganze Menschengruppen, denen das Recht auf Partizipation und Inklusion abgesprochen wird, linke Argumente als bloßer Ausdruck einer veralteten Ideologie des Klassenkampfs «widerlegt» werden. Der Klassenkampf ist keine Erfindung der Linken, allenfalls besitzt, wer linke Anliegen vertritt, ein etwas feineres Sensorium für das soziale Konfliktpotenzial, das in der Unvereinbarkeit von Interessen liegt. Dieses Potenzial wird durch weltfremde Utopien einer ausschließlich aus Eigentümern, Konsumenten und Investoren bestehenden Gemeinschaft nicht entschärft. Während die als Neoliberalismus bezeichnete Doktrin in ihrem Selbstverständnis eher eine Wissenschaftskritik ist als eine Wissenschaft, sind ökonomische Theorien, auf die er sich stützt, in den letzten Jahrzehnten regelmäßig falsifiziert worden. Statt sich jedoch mit empirischen Falsifikationen auseinanderzusetzen, ziehen es Neoliberale vor, jeden Versuch, aufgrund rationaler Reflexion alternative Ordnungen zu entwerfen, der Sünde des »Konstruktivismus« zu bezichtigen.
Wenn Krisensymptome nicht oder nur verzehrt wahrgenommen werden, so auch deshalb, weil rationale Diskussionen über die Wünschbarkeit und Realisierbarkeit von Alternativen im politischen Tagesstreit kaum auf Interesse stoßen. In dieser Situation hat die revolutionäre Linke naturgemäß einen schweren Stand. Ihre Konzeption eines freiheitlichen Sozialismus ist vorderhand nicht mehr als eine Hypothese, und Projekte einer revolutionären Politik können nicht mehrheitsfähig werden, wenn es nicht gelingt, den die politische Auseinandersetzung prägenden Irratiopalismus zu überwinden. Immerhin ist zu konstatieren, dass zumindest in der akademischen Welt die Bereitschaft, Marx’ Theorie ernsthaft zu diskutieren, zugenommen hat. In einem kürzlich erschienenen Buch, dessen Herausgeber man wohl dem Lager der Ordoliberalen zurechnen darf, steht zu lesen, Marx habe den zeitgenössischen Liberalismus gerade deshalb abgelehnt, weil ihm die individuelle Freiheit so überaus wichtig gewesen sei. Ebenso wird konstatiert, sein Werk biete «eine lebhaft sprudelnde Quelle der Inspiration, aus der freilich – wenn nicht alles täuscht – gegenwärtig kaum geschöpft wird» (Pies/Leschke: Karl Marx’ kommunistischer Individualismus, Tübingen 2005). Diesem Befund kann man nur beipflichten.
Revolution heißt Veränderung sozialer Institutionen, Neuverteilung der Macht mittels Neudefinition von Rechten, insbesondere Partizipations- und Eigentumsrechten. Revolution in diesem Sinne hat nichts zu tun mit einer moralischen Läuterung oder einer kulturellen Wiedergeburt. Der Liberalismus ist für den Marxismus eine notwendige Stufe der Zivilisationsgeschichte, hinter die zurückzugehen so sinnlos wie verhängnisvoll wäre. Die Revolution verändert nicht den Menschen, sie schafft ein anderes Anreizsystem, sie verändert die Bedingungen, unter denen Menschen handeln, sich entfalten, Wissen sammeln und nutzen können, sie zielt auf die Schaffung neuer Formen der Kooperation, worin in den Worten von Marx und Engels «die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist». ♦Aus Urs Marti, Freiheit, Recht und Revolution, in: Zukunft der Demokratie, Das postkapitalistische Projekt, Rotpunkt Verlag 2008
.
.
.
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über das glückliche Leben
Seneca
.
Wo es sich um Fragen der Menschheit handelt, sind wir nicht in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass der Mehrzahl das Bessere gefalle: der Standpunkt der großen Masse lässt gerade den Schluss auf das Schlimmste zu. Wir müssen also fragen, was zu tun das Beste, nicht was das Gebräuchlichste ist, und was uns den Besitz ununterbrochenen dauernden Glücks sichert, nicht was dem großen Haufen, diesem verwerflichsten Ausleger der Wahrheit, genehm ist.
Zur großen Masse rechne ich aber ebensogut gekrönte Häupter wie Menschen im Kittel. Denn ich blicke nicht auf die Farbenpracht der Kleider, die dem Körper ein stattliches Aussehen verleihen; ich traue nicht den Augen, wo es sich um den Menschen handelt; ich habe eine bessere und zuverlässigere Leuchte, um Wahres und Falsches zu unterscheiden: es ist des Geistes Wert, den der Geist auffinden soll. Ist er – der Geist – einmal dazu gekommen, ruhig aufzuatmen und Einkehr in sich zu halten, wie wird er sich dann unter dem selbstbereiteten Druck der Folterqualen die Wahrheit gestehen! «Alles», wird er sagen, «was ich bisher getan, o möchte es doch ungetan sein; überschlage ich im Geiste alles, was ich gesagt habe, so beneide ich die Stummen; alles, was ich mir gewünscht habe, erscheint mir wie ein Fluch aus dem Munde der Feinde; alles, was ich gefürchtet habe, gute Götter, wieviel geringer war das anzuschlagen als das, was ich mit heißem Verlangen mir vergebens herbeiwünschte! Mit vielen habe ich in Feindschaft gestanden und habe mich, dem Hasse entsagend, wieder mit ihnen versöhnt, sofern überhaupt unter Übeltätern von Versöhnung die Rede sein kann: meine Feindschaft mit mir selbst steht noch auf schwachen Füßen. Ich habe mir redlich Mühe gegeben, mich aus der großen Menge herauszuheben und durch irgendwelchen Geistesvorzug die Augen auf mich zu lenken. Und der Erfolg? Er war kein anderer als der, dass ich mich wohlgezielten Angriffen ausgesetzt sah und den Böswilligen die Blöße zeigte, wo sie mich packen konnten. Siehst du sie, die meine Beredsamkeit preisen, meinem Reichtum nachlaufen, um meine Gunst buhlen, meine Macht in den Himmel heben? Sie alle sind nichts anderes als entweder meine Feinde oder, was dasselbe besagt, sie können es sein; die Schar der Bewunderer ist nicht größer oder kleiner als der Neider. Warum richte ich mein Sinnen und Trachten nicht vielmehr auf etwas gut Erprobtes, dessen ich mir innerlich bewusst bin, statt auf etwas, womit ich nach außen hin Staat mache? All das, was die Augen auf sich zieht, was die Vorübergehenden haltmachen lässt, was der eine dem anderen staunend zeigt – es ist nichts als äußerer Glanz ohne jeden inneren Wert.»Schauen wir also aus nach einem nicht äußerlich glänzenden Gut, sondern einem solchen, das in sich gefestigt und gleichmäßig ist und seine höhere Schönheit von weniger bemerkbarer Seite zeigt! Das lasst uns ausfindig machen. Und es liegt nicht in der Ferne; man muss nur wissen, wohin man die Hand strecken soll. Jetzt tappen wir gleichsam im Finsteren, haben das sehnsüchtig Gesuchte unmittelbar vor uns und gehen dicht daran vorüber. Doch um dir lange Umwege zu ersparen, will ich mich nicht auf die Meinungen anderer einlassen – denn es wäre eine zeitraubende Sache, sie aufzuzählen und zu widerlegen: lass dir meine Ansicht genügen. Wenn ich aber sage: meine Ansicht, so binde ich mich damit nicht an irgendeinen einzelnen Meister der Stoa; auch ich habe das Recht der eigenen Meinung. Daher werde ich mich an diesen oder jenen anschließen, werde einen anderen auffordern, einzelne Punkte seiner Meinung bestimmt hervorzuheben, und werde, wenn ich etwa erst zuletzt aufgerufen werde, nichts von dem, wofür sich meine Vorgänger ausgesprochen haben, verwerfen und nur erklären: «Ich stimme dafür, nur mit folgendem Zusatz.»
Dabei halte ich mich, worin die Stoiker alle übereinstimmen, an die Natur. Von ihr nicht abzuirren, nach ihrem Gesetz und Beispiel sich zu bilden, das ist Weisheit. Glücklich also ist dasjenige Leben, das mit seiner Natur in vollem Einklang steht. Dies Ziel zu erreichen ist aber nicht anders möglich, als wenn zuvörderst der Geist gesund und im dauernden Besitz dieser seiner Gesundheit ist, wenn er ferner tapfer und voll Feuer ist, sodann auch im Leiden ein schönes Muster von Ergebenheit, in die Umstände sich schickend, achtsam auf den Körper und seine Bedürfnisse, doch nicht bis zur Ängstlichkeit, voll Bedacht auch für alles, was sonst zum Leben gehört, ohne die mindeste Überschätzung, bereit, des Schicksals Gaben zu nutzen, nicht aber, um sich zu ihrem Sklaven zu machen.
Als Folge davon stellt sich – das ist dir auch ohne ausdrücklichen Hinweis darauf klar – andauernde Ruhe, verbunden mit dem Gefühl der Freiheit, ein, unter Fernhaltung von allem, was uns reizt oder in Schrecken versetzt. Denn ist der Reiz der Sinnengenüsse verschwunden, so stellt sich statt dessen, was kleinlich, hinfällig und eben durch seine Lasterhaftigkeit schädlich ist, eine erstaunlich frohe Stimmung ein, unerschütterlich und sich immer gleichbleibend, sodann Friede und Eintracht der Seele sowie hochherzige Gesinnung, verbunden mit Sanftmut; denn wilde Rohheit hat ihren Ursprung immer nur in der Schwäche.Aus Seneca, Über das glückliche Leben, Brief an den Bruder Gallio, Rom 58 n.Chr.
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Von den Künstlern
Erasmus von Rotterdam
.
Von den Künstlern? Was sie ja alle auszeichnet, ist just die Selbstgefälligkeit, und eher ließe sich einer sein väterliches Gut absprechen als sein Talent, besonders was Schauspieler, Sänger, Redner und Dichter sind: Je weniger einer kann, desto frecher belobigt er sich, desto stolzer geht er einher, macht er sich breit. Und nun weiß man: jedes Kraut hat seinen Fresser, oder anders: je ärger der Schund, desto stärker der Beifall, zieht doch stets das Geringste am meisten, denn, wie ich sagte, die Mehrzahl der Menschen ist eingeschworen auf die Torheit. Wenn also dem größten Stümper der größte Erfolg bei sich selbst und beim Publikum in den Schoß fällt, wozu sollte sich einer noch gründlich schulen? Schulung kostet erstens Geld, dann macht sie unnatürlich und befangen, und findet schließlich nicht halb soviel Anklang.Nun sehe ich aber, dass die Natur nicht bloß dem einzelnen seinen Dünkel, sondern auch jeder Nation, um nicht zu sagen jeder Stadt, einen Gesamtdünkel eingepflanzt hat. Drum wollen die Engländer wissen, neben anderen finde man Schönheit, Musik und einen guten Tisch nur bei ihnen. Die Schotten sind stolz auf ihren Adel und auf die Verwandtschaft mit dem Königshaus, aber auch auf ihre dialektischen Kniffe. Die Franzosen haben die Höflichkeit gepachtet. Die Pariser maßen sich in der Theologie eine besondere Meisterschaft an und lassen fast niemand neben sich gelten. Die Italiener haben Literatur und Beredsamkeit an sich gerissen und schmeicheln sich alle, auf der ganzen Welt die einzigen Nichtbarbaren zu sein, zumal aber die Römer, die noch immer von jenem alten Rom träumen. Die Venezianer beglückt der Glaube an ihre Vornehmheit. Die Griechen spielen sich als die Erfinder der Wissenschaften auf und machen viel Wesens aus ihren alten berühmten Helden. Der Türke und die ganze echte Barbarenbande wähnt gar, die beste Religion zu haben und verlacht die Christen als abergläubisch. Die Juden – noch köstlicher – warten auch jetzt noch unentwegt auf ihren Messias und halten an ihrem Moses bis heute krampfhaft fest. Die Spanier gönnen keinem den Heldenlorbeer. Die Deutschen trutzen auf ihre Hünengestalt und die Kenntnis der Magie.
Ich spare mir Details: ihr seht wohl schon, wieviel Freude dem einzelnen und der gesamten Menschheit die Selbstgefälligkeit schenkt.
Von ähnlicher Art ist ihre Schwester Schmeichelei – jene nämlich ist am Werk, wenn einer sich selber streichelt; tut er dasselbe einem andern, steht diese hinter ihm. – Freilich genießt sie heutzutage keinen guten Ruf, aber doch nur bei denen, die sich an den Namen statt an die Sache halten. Sie meinen, mit der Schmeichelei stehe die Treue auf schlechtem Fuße, und doch könnten sie schon von den Tieren lernen, dass dem nicht so ist: keines schmeichelt so wie der Hund, aber auch keines ist so treu; keines kokettiert so wie das Eichhörnchen, aber keines ist dem Menschen so zugetan. Oder meint ihr, mit reißenden Löwen oder wilden Tigern oder fauchenden Pantern wäre ihm besser gedient? Es gibt zwar eine bösartige Schmeichelei, mit welcher hinterlistige, hämische Gesellen ihre armen Mitmenschen ins Verderben locken; aber von dieser Art ist meine nicht. Sie stammt aus der Herzensgüte und Unschuld und steht der Tugend viel näher als ihr Gegenstück, die Schroffheit und die, wie Horaz sagt, widerhaarige und unfreundliche Pedanterie. Sie richtet den Niedergeschlagenen auf, streichelt den Traurigen, stupft den Saumseligen, weckt den Stumpfsinnigen; Krankheit erleichtert sie, Trotz bricht sie, Liebesbande knüpft sie und schon geknüpfte festigt sie; sie weiß die Jungen zum Lernen zu verlocken, die Alten zu erheitern, die Fürsten ohne Kränkung, im Gewande des Lobes, zu ermahnen und zu belehren, kurzum: sie bringt es zuwege, dass jeder sich selbst angenehmer und wertvoller wird – und das ist beim Glück ja die Hauptsache. Und wie selbstlos sieht es doch aus, wenn ein Esel den andern krault! Vergessen wir zudem nicht, dass die Schmeichelei eine große Rolle in der löblichen Redekunst spielt, eine größere noch in der Heilkunst, die größte in der Poesie und dass sie überhaupt den Verkehr der Menschen versüßt und würzt.Aus Erasmus von Rotterdam, Das Lob der Torheit, Paris 1511
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über die Ungewissheit der Wissenschaft
Agrippa von Nettesheim
.
Ihr habet aus dem, was ich von Anfang bis hierher gesaget, gehöret, dass die Wissenschaften und Künste nichts anders sind, als Menschenüberlieferungen und von uns nur in törichter Leichtgläubigkeit angenommen, und dass solche insgesamt aus nichts anders als aus zweifelhaftigen Dingen und Ungewissen Meinungen genommen und durch scheinbare Demonstrationes dargetan werden; ja dass sie alle, so viel derer sind, ungewiss und betrüglich, ich könnte fast sagen schädlich und gottlos sind. Daher ist es gottlos, zu glauben, dass sie uns zu unserer Seligkeit was dienlich sein könnten. Vor diesem hatten die Heiden diesen Aberglauben, dass, wann sie einen sahen, der eine Kunst oder Wissenschaft erfunden hatte oder darinnen exzellieret, demselben taten sie göttliche Ehre an und rechneten ihn unter die Zahl der Götter; sie weiheten ihm Tempel und Altäre und beteten ihn unter gewissen Figuren [177] an, wie der Vulcanus bei den Ägyptiern, weil er der erste Philosophus war, und die Principia naturae dem Feuer zuschriebe, so war er hernach gar als ein Feuer geehret; und der Äsculapius (wie Celsus dafür hält), weil er die annoch rauhe Medizin ein wenig subtiler zu traktieren wusste, so ward er deswegen unter die Götter gezählet. Also ist diese und keine andere Gottheit der Wissenschaften bei ihnen, als welche die alte Schlange, die dergleichen Götterkünstlerin ist, unseren ersten Eltern versprochen hat, wann sie saget: Eiritis sicut Dii, scientes bonum et malum. Das ist: Ihr werdet sein wie die Götter, sobald ihr Gutes und Böses wisset. In dieser Schlange mag sich rühmen, wer sich einer Wissenschaft: rühmet; denn fürwahr niemand wird können einer Wissenschaft fähig sein und dieselbe besitzen, als aus Gunst und Favor dieser Schlange, deren Lehre nichts anderes als Zauberei und Gaukelei und deren Final endlich böse ist; also dass auch bei dem geimeinen Mann ein Sprichwort entstanden: Omnes scientes insanire. Alle die was wissen, die seien närrisch und unsinnig. Denen pflichtet auch Aristoteles bei, wann er sagt: Nullam magnam esse scientiam sine mixtura dementiae. Jedwede grosse Wissenschaft sei mit einer Torheit vermischet. Und Augustinus selbsten bezeuget, dass manche, durch Begierde viel zu wissen, ihre Vernunft verloren haben.
Es ist kein Ding auf der Welt der christlichen Religion und dem Glauben so zuwider, als die Wissen schaft, und ist nichts, das sich weniger miteinander vertragen kann, als diese beiden; denn wir wissen aus den Kirchenhistorien, und hat es auch die Erfahrung gegeben, wie die Wissenschaften, nachdem der Glaube an Christum aufkommen, verfallen sind, also dass fast der grösste oder doch der vornehmsten Teil gänzlich zugrunde gangen ist. Denn die zauberischen Künste meistenteils, die die grössten und vornehmsten gewesen sind, die haben sich dergestalt verloren, dass keine Spuren mehr da sind; und von allen der Philosophorum [178] Sekten ist nicht mehr übrig geblieben, als nur allein die peripatetische und zwar auch ganz verstümmelt und unvollkommen. Und hat sich die Kirche niemals besser befunden und mehr in stiller Zufriedenheit gelebet, als zu der Zeit, da man von Künsten und Wissenschaften nichts gewusst hat oder doch, da dieselben in eine Enge gebracht worden sind, nämlich da keine Grammatica gewesen, als nur bei dem Alexander Gallo, keine Dialectica, als bei dem Petro Hispano, keine Rhetorica, als bei dem Laurentio Aquilegio, ein klein Fasciculus oder Bändchen war genug für die Historie, für die mathematischen Disziplinen genügte die Ausrechnung des Kirchenkalenders, allen andern Disziplinen auch stunde der einige Isidorus für. Anjetzo aber, da wieder so viel Sprachen aufgekommen, so viel rhetorische Orationes geschrieben und so viel alte Bücher aufs neue das Tageslicht gesehen haben, und die Wissenschaften wieder excolieret worden, da sehe man nur, wie die Kirche in ihrer Ruhe ist turbieret worden, und was für neue Sekten und Ketzereien nacheinander an den Tag kommen sind, ja es ist keine Art unter den Menschen weniger geschickt Gottes heilige Lehre an sich zu nehmen, als diejenige, so sich in allerhand Wissenschaften vertiefet hat, denn diese bleiben oftermals so obstinat und halsstarrig auf ihrer Meinung, dass sie dem Heiligen Geist keinen Baum lassen wollen, und trauen ihren eigenen Kräften und Köpfen so viel zu, dass sie der reinen Wahrheit keinesweges welchen wollen, lassen auch nichts zu, als was mit syllogistischen Schlüssen erwiesen werden kann, und was sie nicht durch ihre Kräfte und Fleiss nachgrübeln mögen, das verachten sie und lachen es aus. Darum hat Christus diese seine heilige Lehre für den Weisen und Klugen verborgen und hat sie den Kleinen und Geringen offenbaret, nämlich denenjenigen, die geistlich arm sind und mangelnder Wissenschaft; denenjenigen, welche reinen Herzens und nicht mit diesen vergeblichen Meinungen und Wissenschaften beflecket sind; deren Seelen wie ein Blatt weissen Papieres sind, auf dem noch nichts geschrieben stehet von menschlichen Traditionen; denenjenigen, welche friedfertig sind und nicht gerne streiten oder mit ihren zänkischen Syllogismis die Wahrheit verjagen, denenjenigen, welche wegen der Wahrheit und Gerechtigkeit Verfolgung leiden und als Esel von den argen Sophisten verlachet werden oder als Grünschnäbel, verrufen in den Schulen, entfernt von den Lehrstühlen, verjagt von den Universitäten, als Ketzer verleumdet und verfolgt, auch wohl grausam am Leben gestrafet. ■
Aus Agrippa von Nettesheim, Von der Ungewissheit und Eitelkeit der Wissenschaften, Köln 1527
.
.
Das Zitat der Woche
.
Von den Sinnesdaten
George Edward Moore
.
Einige Philosophen haben, so meine ich, bezweifelt, ob es überhaupt solche Dinge gibt, wie sie andere Philosophen als »Sinnesdaten« oder »Sensa« diskutiert haben. Und ich halte es für durchaus möglich, daß einige Philosophen (darunter früher auch ich selbst) diese Ausdrücke in einem solchen Sinne verwendet haben, daß man wirklich bezweifeln kann, ob es so etwas gibt. Aber es gibt überhaupt keinen Zweifel, daß es Sinnesdaten in dem Sinne gibt, in dem ich den Ausdruck jetzt verwende. Ich sehe im Augenblick eine große Anzahl von ihnen, und fühle andere. Und um dem Leser deutlich zu machen, was ich mit Sinnesdaten meine, brauche ich ihn nur zu bitten, seine eigene rechte Hand zu betrachten. Wenn er das tut, wird er imstande sein, etwas herauszugreifen (und wenn er nicht gerade doppelt sieht, nur ein einziges Ding), und er wird dabei feststellen, daß es auf den ersten Blick eine natürliche Annahme ist, zu meinen, daß dieses Ding nun zwar nicht mit seiner ganzen rechten Hand, aber dafür mit dem Teil ihrer Oberfläche identisch ist, den er gerade sieht; andererseits aber wird er (wenn er ein wenig nachdenkt) in der Lage sein zu sehen, daß es zweifelhaft ist, ob dies mit dem fraglichen Teil der Oberfläche seiner Hand identisch sein kann. Dinge dieser Art (in einer gewissen Hinsicht), zu der das Ding gehört, das er sieht, wenn er seine Hand betrachtet, und im Hinblick auf die er verstehen kann, wie einige Philosophen zu der Annahme kamen, dies, was er da sieht, sei nun ein Teil der Oberfläche seiner Hand, während andere angenommen haben, daß dies nicht so sein kann, solche Dinge bezeichne ich als »Sinnesdaten«. Ich definiere den Ausdruck also so, daß es eine offene Frage bleibt, ob das Sinnesdatum, das ich jetzt sehe, wenn ich meine Hand betrachte, und das ein Sinnesdatum meiner Hand ist, mit dem Teil ihrer Oberfläche, den ich im Augenblick tatsächlich sehe, nun identisch ist oder nicht.
Daß das, was ich im Hinblick auf dieses Sinnesdatum weiß, wenn ich weiß: »Dies ist eine menschliche Hand«, nicht darin besteht, daß es selbst eine menschliche Hand ist, scheint mir gewiß zu sein, weil ich weiß, daß meine Hand viele Teile hat (z. B. die Innenseite und die Knochen), die ganz sicherlich nicht Teile dieses Sinnesdatums sind. Ich halte es also für gewiß, daß die Analyse der Aussage »Dies ist eine menschliche Hand« wenigstens im groben die Form hat: »Es gibt ein und nur ein Ding, von dem gilt, daß es eine menschliche Hand ist, und daß diese Oberfläche ein Teil ihrer Oberfläche ist.« Mit anderen Worten, und um meine Ansicht in die Terminologie, die zu der Wendung »Theorie der repräsentativen Wahrnehmung« gehört, zu bringen: Ich behaupte, daß es ganz gewiß ist, daß ich nicht direkt meine Hand wahrnehme, und daß wenn man sagt (wie man zutreffend sagen kann), daß ich sie »wahrnehme«, dies bedeutet, daß ich (in einem anderen und fundamentaleren Sinne) etwas wahrnehme, was (in einem angemessenen Sinne) meine Hand repräsentiert, nämlich einen bestimmten Teil ihrer Oberfläche.
Dies ist alles, was ich bei der Analyse der Aussage »Dies ist eine menschliche Hand« für gesichert halte. Wir haben gesehen, daß ihre Analyse eine Aussage der Form »Dies ist Teil der Oberfläche einer menschlichen Hand« einschließt (wobei »Dies« natürlich eine andere Bedeutung hat als in der ursprünglichen Aussage, die- jetzt analysiert worden ist). Aber diese Aussage ist ohne Zweifel auch eine Aussage über das Sinnesdatum, das ich sehe, und das ein Sinnesdatum von meiner Hand ist. Und daher stellt sich die weitere Frage:
Wenn ich weiß »Dies ist Teil der Oberfläche einer menschlichen Hand«, was weiß ich dann über das fragliche Sinnesdatum? Weiß ich in diesem Falle tatsächlich über das fragliche Sinnesdatum, daß es selbst Teil der Oberfläche einer menschlichen Hand ist? Oder gilt vielleicht für diese neue Aussage dasselbe, was wir im Falle von »Dies ist eine menschliche Hand« herausgefunden haben, wo das, was ich über das Sinnesdatum wußte, sicherlich nicht darin bestand, daß es selbst eine menschliche Hand war, und wissen wir auch hier nicht im Hinblick auf das Sinnesdatum, daß es selbst Teil der Oberfläche einer Hand ist? Und wenn es so ist, was weiß ich dann über das Sinnesdatum selbst? Dies ist die Frage, auf die, wie mir scheint, bisher noch kein Philosoph eine Antwort vorgeschlagen hat, die der gesicherten Wahrheit irgendwie nahekommt. Es scheint mir hier drei und nur drei Typen von Antwortmöglichkeiten zu geben; und gegen jede bisher vorgeschlagene Antwort einer dieser Typen scheint es mir schwerwiegende Einwände zu geben.
Beim ersten Typ gibt es nur eine Antwort, nämlich daß ich in diesem Falle wirklich weiß, daß das Sinnesdatum selbst Teil der Oberfläche einer menschlichen Hand ist. Mit anderen Worten: daß ich zwar nicht meine Hand direkt wahrnehme, einen Teil ihrer Oberfläche aber in der Tat direkt wahrnehme, daß das Sinnesdatum selbst dieser Teil ihrer Oberfläche ist, und nicht bloß etwas, was (in einem Sinne, der noch näher zu bestimmen wäre) diesen Teil ihrer Oberfläche »repräsentiert«; daß also der Sinn, in dem ich diesen Teil der Oberfläche meiner Hand »wahrnehme«, nicht selber wieder ein Sinn ist, der durch Bezug auf einen dritten, noch fundamentaleren [ultimate] Sinn von »wahrnehmen« definiert werden müßte, welch letzterer dann der einzige wäre, in dem die Wahrnehmung direkt ist, nämlich der, in dem ich das Sinnesdatum wahrnehme.
Wenn diese Ansicht wahr ist (was ich so gerade noch für möglich halte), scheint es mir sicher zu sein, daß wir eine Ansicht aufgeben müssen, die von den meisten Philosophen für eine gesicherte Wahrheit gehalten worden ist, nämlich die Ansicht, daß unsere Sinnesdaten immer wirklich die Eigenschaften haben, die sie uns in ihrer sinnfälligen Erscheinung zu haben scheinen. Denn ich weiß, daß, wenn jemand anders durch ein Mikroskop die Oberfläche betrachten würde, die ich mit dem bloßen Auge sehe, das von ihm erblickte Sinnesdatum ganz andere sinnfällige Eigenschaften haben würde als mein Sinnesdatum, und zwar solche, die mit den sinnfälligen Eigenschaften meines Sinnesdatums unverträglich sind: und doch muß, wenn mein Sinnesdatum identisch mit der Oberfläche ist, die wir beide sehen, auch sein Sinnesdatum identisch mit dem meinen sein. Mein Sinnesdatum kann also mit dieser Oberfläche nur dann identisch sein, wenn es mit seinem Sinnesdatum identisch ist; und weil sein Sinnesdatum ihm sinnfällige Eigenschaften zu haben scheint, die mit den mir erscheinenden sinnfälligen Eigenschaften meines Sinnesdatums unverträglich sind, kann sein Sinnesdatum mit dem meinen nur dann identisch sein, wenn das fragliche Sinnesdatum entweder die Eigenschaften nicht besitzt, die es mir sinnfällig zu haben scheint, oder die, die es ihm sinnfällig zu haben scheint. Ich glaube jedoch nicht, daß dies ein durchschlagender Einwand gegen Auffassungen dieses ersten Typs ist. Ein weit schwerwiegenderer Einwand scheint mir der zu sein, daß, wenn wir etwas doppelt sehen (ein sogenanntes »double Image« von ihm haben), wir sicherlich zwei Sinnesdaten haben, von denen jedes ein Sinnesdatum von der gesehenen Oberfläche ist, und daß also nicht beide identisch mit ihr sein können; daß es nun aber andererseits doch so scheint, als ob – wenn jemals ein Sinnesdatum identisch mit der Oberfläche ist, von der es ein Sinnesdatum ist – eben dies auch für jedes dieser sogenannten »Bilder« gelten müßte. Es sieht also letzten Endes doch so aus, als ob jedes Sinnesdatum nur ein »Repräsentant« der Oberfläche wäre, von der es ein Sinnesdatum ist. ■Aus George Edward Moore, Eine Verteidigung des Common Sense (1925), in: Geschichte der Philosophie / 20. Jahrhundert, Reclam Verlag 1981
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über die Verfallsgeschichte von Kunst, Religion und Philosophie
Jürgen Habermas
.
Die Konstellation der bürgerlichen Kultur im Zeitalter ihrer klassischen Entfaltung war, wenn eine grobe Andeutung gestattet ist, gekennzeichnet durch die Auflösung traditionalistischer Weltbilder, also einmal durch den Rückzug der Religion in den Bezirk privatisierter Glaubensmächte, sodann durch das Bündnis einer empiristischen und einer rationalistischen Philosophie mit der neuen Physik, und schließlich durch eine autonom gewordene Kunst, die komplementäre Auffangstellungen für die Opfer der bürgerlichen Rationalisierung einnimmt.
Die Kunst ist das Reservat für eine – sei es auch nur virtuelle – Befriedigung jener Bedürfnisse, die im materiellen Lebensprozeß der bürgerlichen Gesellschaft gleichsam illegal werden: ich meine das Bedürfnis nach einem mimetischen Umgang mit Natur, der äußeren ebenso wie der des eigenen Leibes; das Bedürfnis nach solidarischem Zusammenleben, überhaupt nach dem Glück einer kommunikativen Erfahrung, die den Imperativen der Zweckrationalität enthoben ist und der Phantasie ebenso Spielraum läßt wie der Spontaneität des Verhaltens. Diese Konstellation der bürgerlichen Kultur war keineswegs stabil; sie währte, wie der Liberalismus selber, sozusagen nur einen Moment und verfiel dann der Dialektik der Aufklärung (oder vielmehr dem Kapitalismus als deren unwiderstehlichem Vehikel). Schon Hegel verkündet in seinen «Vorlesungen über die Ästhetik» den Verlust der Aura der Kunst. Indem er Kunst und Religion als beschränkte Formen des absoluten Wissens, welche die Philosophie als das freie Denken des absoluten Geistes durchdringt, begreift, setzt er die Dialektik einer «Aufhebung» in Gang, die alsbald die Grenzen der Hegelschen Logik überschreitet. Hegels Schüler vollziehen eine profane Kritik erst der Religion und dann der Philosophie, um schließlich die Aufhebung der Philosophie und deren Verwirklichung in der Aufhebung der politischen Gewalt terminieren zu lassen: das ist die Geburtsstunde der Marxschen Ideologiekritik. Was in der Hegelschen Konstruktion noch verschleiert war, tritt nun hervor: die Sonderstellung, die die Kunst unter den Gestalten des absoluten Geistes insofern einnimmt, als sie nicht, wie die subjektivierte Religion und eine szientifizierte Philosophie, Aufgaben für das ökonomische und das politische System übernimmt, sondern residuale Bedürfnisse, die im »System der Bedürfnisse«, eben der bürgerlichen Gesellschaft, nicht befriedigt werden können, auffängt. Deshalb blieb die Sphäre der Kunst von Ideologiekritik eigentümlich verschont – bis in unser Jahrhundert. Als auch sie schließlich der Ideologiekritik verfiel, stand die ironische Aufhebung von Religion und Philosophie bereits vor Augen.Die Religion ist heute nicht einmal mehr Privatsache; aber im Atheismus der Massen sind auch die utopischen Gehalte der Überlieferung untergegangen. Die Philosophie ist ihres metaphysischen Anspruchs entkleidet, aber im herrschenden Szientismus sind auch die Konstruktionen zerfallen, vor denen eine schlechte Realität sich rechtfertigen mußte. Inzwischen steht gar eine «Aufhebung» der Wissenschaft vor der Tür, die zwar den Schein der Autonomie zerstört, aber weniger um diskursiver Steuerung als vielmehr einer Funktionalisierung des Wissenschaftssystems für naturwüchsige Interessen zu weichen (siehe W.Pohrt: Wissenschaftspolitik. In diesem Zusammenhang steht auch Adornos Kritik einer falschen Aufhebung der Kunst, welche zwar die Aura zerstört, aber mit der herrschaftlichen Organisation des Kunstwerks zugleich dessen Wahrheitsanspruch liquidiert.)
Die Enttäuschung an der falschen Aufhebung, sei es der Religion, der Philosophie oder der Kunst, kann eine Reaktion des Innehaltens, wenn nicht des Zögerns derart hervorrufen, daß man eher gegen das Praktischwerden des absoluten Geistes überhaupt mißtrauisch wird als seiner Liquidierung zustimmt. Damit verbindet sich eine Option für die esoterische Rettung der wahren Momente.Aus Jürgen Habermas: Die Aktualität Walter Benjamins (1972), Essay, in: Politik, Kunst, Religion, Reclam Verlag 1978
.
Themenverwandte Links
Foucault statt Habermas – Philosophieblog – Habermas zum Achzigsten – Habermas am Handy – Jürgen Habermas – Sozialphilosophie (Habermas) – UltimateHerosWelt – Wissenswerkstatt – Habermas wird 80 – Momentmal
Das Zitat der Woche
.
Über die Natur
Alexander von Humboldt
.
Wer die Resultate der Naturforschung nicht in ihrem Verhältnis zu einzelnen Stufen der Bildung oder zu den individuellen Bedürfnissen des geselligen Lebens, sondern in ihrer großen Beziehung auf die gesamte Menschheit betrachtet; dem bietet sich, als die erfreulichste Frucht dieser Forschung, der Gewinn dar, durch Einsicht in den Zusammenhang der Erscheinungen den Genuß der Natur vermehrt und veredelt zu sehen. Eine solche Veredlung ist aber das Werk der Beobachtung, der Intelligenz und der Zeit, in welcher alle Richtungen der Geisteskräfte sich reflektieren. Wie seit Jahrtausenden das Menschengeschlecht dahin gearbeitet hat, in dem ewig wiederkehrenden Wechsel der Weltgestaltungen das Beharrliche des Gesetzes aufzufinden und so allmählich durch die Macht der Intelligenz den weiten Erdkreis zu erobern, lehrt die Geschichte den, welcher den uralten Stamm unseres Wissens durch die tiefen Schichten der Vorzeit bis zu seinen Wurzeln zu verfolgen weiß. Diese Vorzeit befragen heißt dem geheimnissvollen Gange der Ideen nachspüren, auf welchem dasselbe Bild, das früh dem inneren Sinne als ein harmonisch geordnetes Ganzes, Kosmos, vorschwebte, sich zuletzt wie das Ergebnis langer, mühevoll gesammelter Erfahrungen darstellt.
In diesen beiden Epochen der Weltansicht, dem ersten Erwachen des Bewußtseins der Völker und dem endlichen, gleichzeitigen Anbau aller Zweige der Kultur, spiegeln sich zwei Arten des Genusses ab. Den einen erregt, in dem offenen kindlichen Sinne des Menschen, der Eintritt in die freie Natur und das dunkle Gefühl des Einklangs, welcher in dem ewigen Wechsel ihres stillen Treibens herrscht. Der andere Genuß gehört der vollendeteren Bildung des Geschlechts und dem Reflex dieser Bildung auf das Individuum an: er entspringt aus der Einsicht in die Ordnung des Weltalls und in das Zusammenwirken der physischen Kräfte. So wie der Mensch sich nun Organe schafft, um die Natur zu befragen und den engen Raum seines flüchtigen Daseins zu überschreiten; wie er nicht mehr bloß beobachtet, sondern Erscheinungen unter bestimmten Bedingungen hervorzurufen weiß; wie endlich die Philosophie der Natur, ihrem alten dichterischen Gewande entzogen, den ernsten Charakter einer denkenden Betrachtung des Beobachteten annimmt: treten klare Erkenntnis und Begrenzung an die Stelle dumpfer Ahnungen und unvollständiger Induktionen. Die dogmatischen Ansichten der vorigen Jahrhunderte leben dann nur fort in den Vorurteilen des Volks und in gewissen Disziplinen, die, in dem Bewußtsein ihrer Schwäche, sich gern in Dunkelheit hüllen. Sie erhalten sich auch als ein lästiges Erbteil in den Sprachen, die sich durch symbolisierende Kunstwörter und geistlose Formen verunstalten. Nur eine kleine Zahl sinniger Bilder der Phantasie, welche, wie vom Dufte der Urzeit umflossen, auf uns gekommen sind, gewinnen bestimmtere Umrisse und eine erneuerte Gestalt.
Die Natur ist für die denkende Betrachtung Einheit in der Vielheit, Verbindung des Mannigfaltigen in Form und Mischung, Inbegriff der Naturdinge und Naturkräfte, als ein lebendiges Ganzes. Das wichtigste Resultat des sinnigen physischen Forschens ist daher dieses: in der Mannigfaltigkeit die Einheit zu erkennen; von dem Individuellen alles zu umfassen, was die Entdeckungen der letzteren Zeitalter uns darbieten; die Einzelheiten prüfend zu sondern und doch nicht ihrer Masse zu unterliegen: der erhabenen Bestimmung des Menschen eingedenk, den Geist der Natur zu ergreifen, welcher unter der Decke der Erscheinungen verhüllt liegt. Auf diesem Wege reicht unser Bestreben über die enge Grenze der Sinnenwelt hinaus; und es kann uns gelingen, die Natur begreifend, den rohen Stoff empirischer Anschauung gleichsam durch Ideen zu beherrschen.
Wenn wir zuvörderst über die verschiedenen Stufen des Genusses nachdenken, welchen der Anblick der Natur gewährt; so finden wir, daß die erste unabhängig von der Einsicht in das Wirken der Kräfte, ja fast unabhängig von dem eigenthümlichen Charakter der Gegend ist, die uns umgibt. Wo in der Ebene, einförmig, gesellige Pflanzen den Boden bedecken und auf grenzenloser Ferne das Auge ruht; wo des Meeres Wellen das Ufer sanft bespülen und durch Ulfen und grünenden Seetang ihren Weg bezeichnen: überall durchdringt uns das Gefühl der freien Natur, ein dumpfes Ahnen ihres „Bestehens nach inneren ewigen Gesetzen”. In solchen Anregungen ruht eine geheimnißvolle Kraft; sie sind erheiternd und lindernd, stärken und erfrischen den ermüdeten Geist, besänftigen oft das Gemüt, wenn es schmerzlich in seinen Tiefen erschüttert oder vom wilden Drange der Leidenschaften bewegt ist. Was ihnen ernstes und feierliches beiwohnt, entspringt aus dem fast bewußtlosen Gefühle höherer Ordnung und innerer Gesetzmäßigkeit der Natur; aus dem Eindruck ewig wiederkehrender Gebilde, wo in dem Besondersten des Organismus das Allgemeine sich spiegelt; aus dem Kontraste zwischen dem sittlich Unendlichen und der eigenen Beschränktheit, der wir zu entfliehen streben. In jedem Erdstriche, überall wo die wechselnden Gestalten des Tier- und Pflanzenlebens sich darbieten, auf jeder Stufe intelleKtueller Bildung sind dem Menschen diese Wohltaten gewährt.
Ein anderer Naturgenuß, ebenfalls nur das Gefühl ansprechend, ist der, welchen wir, nicht dem bloßen Eintritt in das Freie (wie wir tief bedeutsam in unserer Sprache sagen), sondern dem individuellen Charakter einer Gegend, gleichsam der physiognomischen Gestaltung der Oberfläche unseres Planeten verdanken. Eindrücke solcher Art sind lebendiger, bestimmter und deshalb für besondere Gemütszustände geeignet. Bald ergreift uns die Größe der Naturmassen im wilden Kampfe der entzweiten Elemente oder, ein Bild des Unbeweglich-Starren, die Öde der unermesslichen Grasfluren und Steppen, wie in dem gestaltlosen Flachlande der Neuen Welt und des nördlichen Asiens; bald fesselt uns, freundlicheren Bildern hingegeben, der Anblick der bebauten Flur, die erste Ansiedelung des Menschen, von schroffen Felsschichten umringt, am Rande des schäumenden Gießbachs. Denn es ist nicht sowohl die Stärke der Anregung, welche die Stufen des individuellen Naturgenusses bezeichnet, als der bestimmte Kreis von Ideen und Gefühlen, die sie erzeugen und welchen sie Dauer verleihen. ■
Aus Alexander von Humboldt, Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, 1858
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über den Schein der Wahrheit
Friedrich Nietzsche
.
Auf welchen Standpunkt der Philosophie man sich heute auch stellen mag: von jeder Stelle aus gesehn ist die Irrtümlichkeit der Welt, in der wir zu leben glauben, das Sicherste und Festeste, dessen unser Auge noch habhaft werden kann – wir finden Gründe über Gründe dafür, die uns zu Mutmaßungen über ein betrügerisches Prinzip im »Wesen der Dinge« verlocken möchten. Wer aber unser Denken selbst, also »den Geist« für die Falschheit der Welt verantwortlich macht – ein ehrenhafter Ausweg, den jeder bewußte oder unbewußte advocatus dei geht –: wer diese Welt samt Raum, Zeit, Gestalt, Bewegung, als falsch erschlossen nimmt: ein solcher hätte mindestens guten Anlaß, gegen alles Denken selbst endlich Mißtrauen zu lernen: hätte es uns nicht bisher den allergrößten Schabernack gespielt? und welche Bürgschaft dafür gäbe es, daß es nicht fortführe, zu tun, was es immer getan hat? In allem Ernste: die Unschuld der Denker hat etwas Rührendes und Ehrfurcht Einflößendes, welche ihnen erlaubt, sich auch heute noch vor das Bewußtsein hinzustellen, mit der Bitte, daß es ihnen ehrliche Antworten gebe: zum Beispiel ob es »real« sei, und warum es eigentlich die äußere Welt sich so entschlossen vom Halse halte, und was dergleichen Fragen mehr sind.
Der Glaube an »unmittelbare Gewißheiten« ist eine moralische Naivität, welche uns Philosophen Ehre macht: aber – wir sollen nun einmal nicht »nur moralische« Menschen sein! Von der Moral abgesehn, ist jener Glaube eine Dummheit, die uns wenig Ehre macht! Mag im bürgerlichen Leben das allzeit bereite Mißtrauen als Zeichen des »schlechten Charakters« gelten und folglich unter die Unklugheiten gehören: hier unter uns, jenseits der bürgerlichen Welt und ihres Jas und Neins – was sollte uns hindern, unklug zu sein und zu sagen: der Philosoph hat nachgerade ein Recht auf »schlechten Charakter«, als das Wesen, welches bisher auf Erden immer am besten genarrt worden ist – er hat heute die Pflicht zum Mißtrauen, zum boshaftesten Schielen aus jedem Abgrunde des Verdachts heraus. – Man vergebe mir den Scherz dieser düsteren Fratze und Wendung: denn ich selbst gerade habe längst über Betrügen und Betrogenwerden anders denken, anders schätzen gelernt und halte mindestens ein paar Rippenstöße für die blinde Wut bereit, mit der die Philosophen sich dagegen sträuben, betrogen zu werden. Warum nicht? Es ist nicht mehr als ein moralisches Vorurteil, daß Wahrheit mehr wert ist als Schein; es ist sogar die schlechtest bewiesene Annahme, die es in der Welt gibt. Man gestehe sich doch so viel ein: es bestünde gar kein Leben, wenn nicht auf dem Grunde perspektivischer Schätzungen und Scheinbarkeiten; und wollte man, mit der tugendhaften Begeisterung und Tölpelei mancher Philosophen, die »scheinbare Welt« ganz abschaffen, nun, gesetzt ihr könntet das – so bliebe mindestens dabei auch von eurer »Wahrheit« nichts mehr übrig! Ja, was zwingt uns überhaupt zur Annahme, daß es einen wesenhaften Gegensatz von »wahr« und »falsch« gibt? Genügt es nicht, Stufen der Scheinbarkeit anzunehmen und gleichsam hellere und dunklere Schatten und Gesamttöne des Scheins – verschiedene valeurs, um die Sprache der Maler zu reden? Warum dürfte die Welt, die uns etwas angeht – nicht eine Fiktion sein? Und wer da fragt: »aber zur Fiktion gehört ein Urheber?« – dürfte dem nicht rund geantwortet werden: Warum? Gehört dieses »Gehört« nicht vielleicht mit zur Fiktion? Ist es denn nicht erlaubt, gegen Subjekt, wie gegen Prädikat und Objekt, nachgerade ein wenig ironisch zu sein? Dürfte sich der Philosoph nicht über die Gläubigkeit an die Grammatik erheben? Alle Achtung vor den Gouvernanten: aber wäre es nicht an der Zeit, daß die Philosophie dem Gouvernanten-Glauben absagte?
Aus Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, darin: Der freie Geist, Sils-Maria/Schweiz 1885
Das Zitat der Woche
.
Über das Menschenleben
Max Stirner
.
Von dem Augenblicke an, wo er das Licht der Welt erblickt, sucht ein Mensch aus ihrem Wirrwarr, in welchem auch er mit allem Andern bunt durcheinander herumgewürfelt wird, sich herauszufinden und sich zu gewinnen.
Doch wehrt sich wiederum Alles, was mit dem Kinde in Berührung kommt, gegen dessen Eingriffe und behauptet sein eigenes Bestehen.
Mithin ist, weil Jegliches auf sich hält, und zugleich mit Anderem in stete Kollision gerät, der Kampf der Selbstbehauptung unvermeidlich.
Siegen oder Unterliegen, – zwischen beiden Wechselfällen schwankt das Kampfgeschick. Der Sieger wird der Herr, der Unterliegende der Untertan: jener übt die Hoheit und «Hoheitsrechte», dieser erfüllt in Ehrfurcht und Respekt die «Untertanenpflichten».
Aber Feinde bleiben beide und liegen immer auf der Lauer: sie lauern einer auf die Schwäche des andern, Kinder auf die der Eltern, und Eltern auf die der Kinder (z.B. ihre Furcht), der Stock überwindet entweder den Menschen oder der Mensch überwindet den Stock.
Im Kindheitsalter nimmt die Befreiung den Verlauf, daß Wir auf den Grund der Dinge oder «hinter die Dinge» zu kommen suchen: daher lauschen Wir Allen ihre Schwächen ab, wofür bekanntlich Kinder einen sichern Instinkt haben, daher zerbrechen Wir gerne, durchstöbern gern verborgene Winkel, spähen nach dem Verhüllten und Entzogenen, und versuchen Uns an Allem. Sind Wir erst dahinter gekommen, so wissen Wir Uns sicher; sind Wir z.B. dahinter gekommen, daß die Rute zu schwach ist gegen Unsern Trotz, so fürchten Wir sie nicht mehr, «sind ihr entwachsen». Hinter der Rute steht, mächtiger als sie, unser – Trotz, unser trotziger Mut. Wir kommen gemach hinter alles, was Uns unheimlich und nicht geheuer war, hinter die unheimlich gefürchtete Macht der Rute, der strengen Miene des Vaters usw., und hinter allem finden Wir Unsere – Ataraxie, d.h. Unerschütterlichkeit, Unerschrockenheit, unsere Gegengewalt, Übermacht, Unbezwingbarkeit. Was Uns erst Furcht und Respekt einflößte, davor ziehen Wir Uns nicht mehr scheu zurück, sondern fassen Mut. Hinter allem finden Wir Unsern Mut, Unsere Überlegenheit; hinter dem barschen Befehl der Vorgesetzten und Eltern steht doch Unser mutiges Belieben oder Unsere überlistende Klugheit. Und je mehr Wir Uns fühlen, desto kleiner erscheint, was zuvor unüberwindlich dünkte. Und was ist Unsere List, Klugheit, Mut, Trotz? Was sonst als – Geist!Eine geraume Zeit hindurch bleiben Wir mit einem Kampfe, der später Uns so sehr in Atem setzt, verschont, mit dem Kampfe gegen die Vernunft. Die schönste Kindheit geht vorüber, ohne daß Wir nötig hätten, Uns mit der Vernunft herumzuschlagen. Wir kümmern Uns gar nicht um sie, lassen Uns mit ihr nicht ein, nehmen keine Vernunft an. Durch Überzeugung bringt man Uns zu nichts, und gegen die guten Gründe, Grundsätze usw. sind Wir taub; Liebkosungen, Züchtigungen und Ähnlichem widerstehen Wir dagegen schwer.
Dieser saure Lebenskampf mit der Vernunft tritt erst später auf, und beginnt eine neue Phase: in der Kindheit tummeln Wir Uns, ohne viel zu grübeln.
Geist heißt die erste Selbstfindung, die erste Entgötterung des Göttlichen, d.h. des Unheimlichen, des Spuks, der «oberen Mächte». Unserem frischen Jugendgefühl, diesem Selbstgefühl, imponiert nun nichts mehr: die Welt ist in Verruf erklärt, denn Wir sind über ihr, sind Geist.
Jetzt erst sehen Wir, daß Wir die Welt bisher gar nicht mit Geist angeschaut haben, sondern nur angestiert.
An Naturgewalten üben Wir Unsere ersten Kräfte. Eltern imponieren Uns als Naturgewalt; später heißt es: Vater und Mutter sei zu verlassen, alle Naturgewalt für gesprengt zu erachten. Sie sind überwunden. Für den Vernünftigen, d.h. «Geistigen Menschen», gibt es keine Familie als Naturgewalt: es zeigt sich eine Absagung von Eltern, Geschwistern usw. Werden diese als geistige, vernünftige Gewalten «wiedergeboren», so sind sie durchaus nicht mehr das, was sie vorher waren.
Und nicht bloß die Eltern, sondern die Menschen überhaupt werden von dem jungen Menschen besiegt: sie sind ihm kein Hindernis, und werden nicht berücksichtigt: denn, heißt es nun: Man muß Gott mehr gehorchen, als den Menschen.
Alles «Irdische» weicht unter diesem hohen Standpunkte in verächtliche Ferne zurück: denn der Standpunkt ist der – himmlische.
Die Haltung hat sich nun durchaus umgekehrt, der Jüngling nimmt ein geistiges Verhalten an, während der Knabe, der sich noch nicht als Geist fühlte, in einem geistlosen Lernen aufwuchs. Jener sucht nicht der Dinge habhaft zu werden, z.B. nicht die Geschichtsdata in seinen Kopf zu bringen, sondern der Gedanken, die in den Dingen verborgen liegen, also z.B. des Geistes der Geschichte; der Knabe hingegen versteht wohl Zusammenhänge, aber nicht Ideen, den Geist; daher reiht er Lernbares an Lernbares, ohne apriorisch und theoretisch zu verfahren, d.h. ohne nach Ideen zu suchen.
Hatte man in der Kindheit den Widerstand der Weltgesetze zu bewältigen, so stößt man nun bei Allem, was man vorhat, auf eine Einrede des Geistes, der Vernunft, des eigenen Gewissens. «Das ist unvernünftig, unchristlich, unpatriotisch» u. dergl., ruft Uns das Gewissen zu, und – schreckt Uns davon ab. – Nicht die Macht der rächenden Eumeniden, nicht den Zorn des Poseidon, nicht den Gott, so fern er auch das Verborgene sieht, nicht die Strafrute des Vaters fürchten Wir, sondern das – Gewissen.
Wir «hängen nun Unsern Gedanken nach» und folgen ebenso ihren Geboten, wie Wir vorher den elterlichen, menschlichen folgten. Unsere Taten richten sich nach Unseren Gedanken (Ideen, Vorstellungen, Glauben), wie in der Kindheit nach den Befehlen der Eltern.
Indes gedacht haben Wir auch schon als Kinder, und waren unsere Gedanken keine fleischlosen abstrakten, absoluten, d.h. nichts als Gedanken, ein Himmel für sich, eine reine Gedankenwelt, logische Gedanken.
Im Gegenteil waren es nur Gedanken gewesen, die Wir Uns über eine Sache machten: Wir dachten Uns das Ding so oder so. Wir dachten also wohl: die Welt, die Wir da sehen, hat Gott gemacht; aber Wir dachten («erforschten») nicht die «Tiefen der Gottheit selber»; Wir dachten wohl: «das ist das Wahre an der Sache», aber Wir dachten nicht das Wahre oder die Wahrheit selbst, und verbanden nicht zu Einem Satze «Gott ist die Wahrheit». Die «Tiefen der Gottheit, welche die Wahrheit ist», berührten Wir nicht. Bei solchen rein logischen, d.h. theologischen Fragen: «Was ist Wahrheit» hält sich Pilatus nicht auf, wenngleich er im einzelnen Falle darum nicht zweifelt, zu ermitteln, «was Wahres an der Sache ist», d.h. ob die Sache wahr ist.
Jeder an eine Sache gebundene Gedanke ist noch nicht nichts als Gedanke, absoluter Gedanke.
Den reinen Gedanken zu Tage zu fördern, oder ihm anzuhängen, das ist Jugendlust, und alle Lichtgestalten der Gedankenwelt, wie Wahrheit, Freiheit, Menschentum, der Mensch usw. erleuchten und begeistern die jugendliche Seele.
Ist aber der Geist als das Wesentliche erkannt, so macht es doch einen Unterschied, ob der Geist arm oder reich ist, und man sucht deshalb reich an Geist zu werden: es will der Geist sich ausbreiten, sein Reich zu gründen, ein Reich, das nicht von dieser Welt ist, der eben überwundenen. So sehnt er sich denn alles in allem zu werden, d.h. obgleich Ich Geist bin, bin Ich doch nicht vollendeter Geist, und muß den vollkommenen Geist erst suchen.
Damit verliere Ich aber, der Ich Mich soeben als Geist gefunden hatte, sogleich Mich wieder, indem Ich vor dem vollkommenen Geiste, als einem Mir nicht eigenen, sondern jenseitigen Mich beuge und meine Leerheit fühle.Aus Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, Leipzig 1844
Das Zitat der Woche
.
Über die drei Forderungen an den Menschen
Friedrich Schiller
.
Ebenso wie der griechische Bildhauer die unnütze und hinderliche Last der Gewänder hinweg wirft, um der menschlichen Natur mehr Platz zu machen, so entbindet der griechische Dichter seine Menschen von dem ebenso unnützen und ebenso hinderlichen Zwang der Konvenienz und von allen frostigen Anstandsgesetzen, die an dem Menschen nur künsteln und die Natur an ihm verbergen. Die leidende Natur spricht wahr, aufrichtig und tief eindringend zu unserm Herzen in der Homerischen Dichtung und in den Tragikern; alle Leidenschaften haben ein freies Spiel und die Regel des Schicklichen hält kein Gefühl zurück. Die Helden sind für alle Leiden der Menschheit so gut empfindlich als andere und eben das macht sie zu Helden, dass sie das Leiden stark und innig fühlen, und doch nicht davon überwältigt werden. Sie lieben das Leben so feurig wie wir andern, aber diese Empfindung beherrscht sie nicht so sehr, dass sie es nicht hingeben können, wenn die Pflichten der Ehre oder der Menschlichkeit es fordern. Philoktet erfüllt die griechische Bühne mit seinen Klagen; selbst der wütende Herkules unterdrückt seinen Schmerz nicht. Die zum Opfer bestimmte Iphigenia gesteht mit rührender Offenheit, dass sie von dem Licht der Sonne mit Schmerzen scheide. Nirgends sucht der Grieche in der Abstumpfung und Gleichgültigkeit gegen das Leiden seinen Ruhm, sondern in Ertragung desselben bei allem Gefühl für dasselbe. Selbst die Götter der Griechen müssen der Natur einen Tribut entrichten, sobald sie der Dichter der Menschheit näher bringen will. Der verwundete Mars schreit vor Schmerz so laut auf, wie zehntausend Mann und die von einer Lanze geritzte Venus steigt weinend zum Olymp und verschwört alle Gefechte.
Diese zarte Empfindlichkeit für das Leiden, diese warme, aufrichtige, wahr und offen daliegende Natur, welche uns in den griechischen Kunstwerken so tief und lebendig rührt, ist ein Muster der Nachahmung für alle Künstler und ein Gesetz, das der griechische Genius der Kunst vorgeschrieben hat. Die erste Forderung an den Menschen macht immer und ewig die Natur, welche niemals darf abgewiesen werden; denn der Mensch ist – ehe er etwas anderes ist – ein empfindendes Wesen. Die zweite Forderung an ihn macht die Vernunft, denn er ist ein vernünftig empfindendes Wesen, eine moralische Person und für diese ist es Pflicht, die Natur nicht über sich herrschen zu lassen, sondern sie zu beherrschen. Erst alsdann, wenn erstlich der Natur ihr Recht ist angetan worden und wenn zweitens die Vernunft das ihrige behauptet hat, ist es dem Anstand erlaubt, die dritte Forderung an den Menschen zu machen und ihm, im Ausdruck sowohl seiner Empfindungen als seiner Gesinnungen, Rücksicht gegen die Gesellschaft aufzulegen und sich als ein zivilisiertes Wesen zu zeigen.
Aus Friedrich Schiller, Über das Pathetische, Leipzig 1801
Das Zitat der Woche
.
Von der Evidenz der Werte
Friedrich Waismann
.
Gibt es wirklich eine Evidenz, die uns mit untrüglicher Sicherheit verkündet, wo ein Wert vorliegt? – Die Anrufung der Evidenz als letzten Ankergrund der Erkenntnis muß heute jeden redlichen Denker mit einem gewissen Mißtrauen erfüllen. Auf keinem Gebiet hat man der Evidenz eine solche Bedeutung beigemessen wie in der Mathematik und Logik. Aber gerade auf diesem Gebiet hat sich gezeigt, daß vermeintlich absolut evidente Wahrheiten Irrtümer sind, die durch eine feinere (logische) Kritik ans Licht gezogen werden. Hier ein paar Beispiele:
Es scheint erstens evident zu sein, daß das Ganze größer ist als der Teil. Es scheint zweitens evident zu sein, daß zwei Mengen von gleichem Umfang sind, wenn es möglich ist, ihre Elemente ein-eindeutig aufeinander abzubilden, d.h. so, daß jedem Element der ersten Menge ein Element der zweiten und jedem Element der zweiten Menge ein Element der ersten entspricht. Und doch führen diese zwei Sätze, die uns so evident, so einleuchtend erscheinen, sogleich auf einen logischen Widerspruch. Wenn man z. B. zwei Strecken von ungleicher Länge aufeinander projiziert, so entspricht jedem Punkt der einen Strecke genau ein Punkt der anderen und umgekehrt; es gibt keinen Punkt, der dabei leer ausgeht. Man müßte also sagen, daß die beiden Strecken gleichviel Punkte enthalten – und doch stellt die eine Strecke offenbar einen echten Teil der anderen dar.
Es scheint evident zu sein, daß eine stetige Kurve in jedem Punkte eine bestimmte Fortschreitungsrichtung hat, und doch hat Weierstraß die mathematische Welt
mit der Entdeckung einer Kurve überrascht, die überall stetig ist und doch nirgends eine bestimmte Richtung besitzt.
Es scheint evident zu sein, daß jedem Prädikat ein Umfang entspricht, die Klasse der Dinge, die unter das Prädikat fallen. Und doch führt dieses scheinbar evidente Prinzip zu Antinomien, wie Russell an einem bestimmten Beispiel gezeigt hat.
Was halten Sie von dem folgenden Satz: Es ist möglich, die ganze unendliche Ebene derart mit Quadraten von abnehmender Größe zu überdecken, daß 1. kein noch so kleiner Bezirk der Ebene von diesen bedeckenden Quadraten freibleibt und daß 2. die Flächensumme aller zur Bedeckung verbrauchten Quadrate beliebig klein ist, z. B. kleiner als 1 Quadratmillimeter? Sie werden sagen: Unsinn, das ist ganz unmöglich! Und doch ist das eine jedem Mathematiker vollkommen geläufige Tatsache, auf die zuerst E. Borel aufmerksam gemacht hat.
Angesichts solcher Erfahrungen ist es verständlich, daß der Kenner der exakten Wissenschaft heute außerordentlich vorsichtig ist, wenn er eine Behauptung durch Berufung auf die Evidenz verteidigen hört. Wenn schon in der Geometrie und Logik, wo die Kraft der Evidenz den höchsten Grad zu besitzen scheint, Evidenztäuschungen vorkommen – was soll man da erst von der Evidenz auf dem Gebiet der Wertungen halten, wo die Überzeugungen der Menschen so notorisch auseinander gehen?
Wir wollen indessen nicht vorschnell urteilen. Vielleicht gibt es doch eine Intuition, ein inneres Schauen, durch das uns der Unterschied zwischen Wert und Unwert offenbar wird. Vielleicht haben doch die Philosophen recht, welche sich auf eine solche intuitive Quelle der Moral berufen.Diese Philosophen versichern uns, daß die Menschen in ihren Urteilen über Wert und Unwert übereinstimmen, obwohl manchmal Irrtümer unterlaufen und es sogar einzelne Menschen geben mag, die wertblind sind. Ist damit die Situation auf dem Gebiet moralischer Wertungen richtig gekennzeichnet? Kann ein Beobachter, der von einem anderen Stern niederstiege und die Menschen sorgfältig betrachtete – ich meine nicht nur ihre Worte, sondern ihre Handlungen und Gefühle – mit diesem Bericht übereinstimmen? Würde er auch nur ein Gebiet von Wertungen entdecken, über die alle Menschen einig sind? Nehmen Sie ein Gebot wie »Du sollst nicht töten«. Ist das allgemein anerkannt? Nein, denn das Töten im Krieg ist ja erlaubt. Aber wie, das ist vielleicht nur Opportunismus, Ducken vor der Staatsmacht und nicht der Ausdruck der inneren Überzeugung? Nehmen wir einen anderen Fall. Wenn es einen menschlichen Unhold gäbe, der von der größten Gemeingefährlichkeit ist, ein Menschenschlächter im Stil Dschingis-Khans, der dabei über eine furchtbare Intelligenz verfügte, die ihn seinen Zeitgenossen überlegen macht – würden da nicht viele aus aufrichtigem Herzen erklären, es sei nur ein Verdienst, ein solches Scheusal aus der Welt zu schaffen? Und würde es nicht andere geben, die auch das Töten dieses Menschen für Sünde hielten? Denken Sie an die endlosen Diskussionen, ob der Staat das Recht habe, einen Menschen zum Tod zu verurteilen. Wie steht es mit der Frage, ob man einen unheilbar Kranken auf sein eigenes Verlangen töten darf? Ist Selbstmord unmoralisch? Denken Sie an Weinfinger, der Selbstmord beging, weil er fühlte, daß die verbrecherischen Elemente in seiner Natur die Überhand gewannen – der also Selbstmord beging, weil er das Ethische liebte: war das nun ethisch oder nicht?
Aber, so werden Sie sagen, es gibt eben Ausnahmen; und dies nur darum, weil das Motiv in diesen Fällen Leidverminderung ist. Leidverminderung ist das wahre ethische Gesetz, das wir alle anerkennen. Aber dazu ist erstens zu sagen, daß viele meinen, daß Leid vertiefe, also wertvoll sei, und daß zweitens die Frage ist, was man als wertvoller betrachten will, ein gleichmäßig temperiertes Leben mit geringen Gefühlsschwankungen, oder ein Leben, in die Tiefen bewegt, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt.
Aber dann ist doch Glücksmehrung etwas, das ungeteilt als gut gilt? Halt! Der Begriff des Glücks ist selbst wieder von moralischen Forderungen abhängig und in die Farbe eines ethischen Ideals getaucht. Glück ist doch etwas viel Komplizierteres als bloßes Wohlgefühl oder gegenwärtige Lust. Bedenken wir, wie verschieden das »Glück« aussieht, je nachdem hedonistische, heroische, asketische Ideale die Herrschaft haben. Die Formel, gut sei das, was das Glück vermehrt, sagt gar nichts, solange nicht näher erklärt wird, worin das Glück und die Glücksmehrung bestehen soll; und das bestimmen die Bekenner verschiedener Ethiken in verschiedener Weise. Ich frage nun wieder: gibt es eine wissenschaftliche Entscheidung, welches Glück das wertvolle, rechte Glück ist? Ist Glück das Glück des Kriegers, des Kampfes und Siegs? Ist Glück die Abtötung der sinnlichen Freuden, die Erforschung des Gewissens und das Suchen nach Gott? Ist Glück das gute Gewissen, das Gefühl der erfüllten Pflicht? Ist Glück, wie die Stoiker meinten, die »Meeresstille des Gemüts«? Ist Glück die Liebe? Ist Glück die heitere Zufriedenheit der Unschuld, das idyllische Behagen? Ist Glück der dionysische Rausch, in dem ein göttliches Licht die Welt erfüllt, wir uns eins fühlen mit dem Universum und die Musik der Sternenkreise vernehmen? Besteht das Glück in jenen seltenen Viertelstunden, in denen uns eine lichte, schwerelose Heiterkeit erfüllt, das Glück, das auf Taubenfüßen kommt? Oder ist das Glück das Glück des Schaffens? Wenn Gott zu einer Seele spräche: »Wähle dir das Leben und die Glücksform, die du haben willst!« – könnte sie erkennen und entdecken, welches Glück das beste ist?
Nun könnte man sagen: Gut ist, was zur Glücksmehrung in einem dieser Sinne führt, indem man sich das Glück durch eine Disjunktion dieser Beschreibungen definiert denkt. Aber damit wäre wieder nichts geholfen: denn die Ideale kämpfen miteinander, und wer das Glück in dem Behagen und in der Idylle sieht, kann nicht das Glück des Kampfes predigen, und was gut in seinem Sinne heißt, ist bös im Sinne des anderen. »Gut ist, was glücksmehrend ist.« Ja, hier scheinen alle übereinzustimmen; aber nur in den Worten, nicht in dem, was sie mit den Worten meinen, und geht man auf die Meinung zurück, so zerrinnt jene anscheinende Einhelligkeit.Aus Friedrich Waismann, Ethik und Wissenschaft, in: Wille und Motiv, Reclam 1983
Das Zitat der Woche
.
Über die Dummheit
Robert Musil
.
Im Leben versteht man unter einem dummen Menschen gewöhnlich einen, der »ein bißchen schwach im Kopf« ist. Außerdem gibt es aber auch die verschiedenartigsten geistigen und seelischen Abweichungen, von denen selbst eine unbeschädigt eingeborene Intelligenz so behindert und durchkreuzt und irregeführt werden kann, daß es im ganzen auf etwas hinausläuft, wofür dann die Sprache wieder nur das Wort Dummheit zur Verfügung hat. Dieses Wort umfaßt also zwei im Grunde sehr verschiedene Arten: eine ehrliche und schlichte Dummheit und eine andere, die, ein wenig paradox, sogar ein Zeichen von Intelligenz ist. Die erstere beruht eher auf einem schwachen Verstand, die letztere eher auf einem Verstand, der bloß im Verhältnis zu irgend etwas zu schwach ist, und diese ist die weitaus gefährlichere.
Die ehrliche Dummheit ist ein wenig schwer von Begriff und hat, was man eine »lange Leitung« nennt. Sie ist arm an Vorstellungen und Worten und ungeschickt in ihrer Anwendung. Sie bevorzugt das Gewöhnliche, weil es sich ihr durch seine öftere Wiederholung fest einprägt, und wenn sie einmal etwas aufgefaßt hat, ist sie nicht geneigt, es sich so rasch wieder nehmen zu lassen, es analysieren zu lassen oder selbst daran zu deuteln. Sie hat überhaupt nicht wenig von den roten Wangen des Lebens! Zwar ist sie oft unbestimmt in ihrem Denken, und die Gedanken stehen ihr vor neuen Erfahrungen leicht ganz still, aber dafür hält sie sich auch mit Vorliebe an das sinnlich Erfahrbare, das sie gleichsam an den Fingern abzählen kann. Mit einem Wort, sie ist die liebe »helle Dummheit«, und wenn sie nicht manchmal auch so leichtgläubig, unklar und zugleich so unbelehrbar wäre, daß es einen zur Verzweiflung bringen kann, so wäre sie eine überaus anmutige Erscheinung.
Ich mag mir nicht versagen, diese Erscheinung noch mit einigen Beispielen auszuzieren, die sie auch von anderen Seiten zeigen und die ich Bleulers Lehrbuch der Psychiatrie entnommen habe: Ein Imbeziller drückt, was wir mit der Formel »Arzt am Krankenbett« abtäten, mit den Worten aus: »Ein Mann, der hält dem ändern die Hand, der liegt im Bett, dann steht da eine Nonne.« Es ist die Ausdrucksweise eines malenden Primitiven! Eine nicht ganz klare Magd betrachtet es als schlechten Scherz, wenn man ihr zumutet, sie solle ihr Erspartes der Kasse übergeben, wo es Zinsen trage: So dumm werde niemand sein, ihr noch etwas dafür zu bezahlen, daß er ihr das Geld aufbewahre! gibt sie zur Antwort; und es drückt sich darin eine ritterliche Gesinnung aus, ein Verhältnis zum Geld, das man vereinzelt noch in meiner Jugend an vornehmen alten Leuten hat wahrnehmen können! Einem dritten Imbezillen endlich wird es symptomatisch aufgeschwärzt, daß er behauptet, ein Zweimarkstück sei weniger wert als ein Markstück und zwei halbe, denn – so lautet seine Begründung: man müsse es wechseln, und dann bekäme man zu wenig heraus! Ich hoffe, nicht der einzige Imbezille in diesem Saal zu sein, der dieser Werttheorie für Menschen, die beim Wechseln nicht aufpassen können, herzlich zustimmt!
Um aber nochmals auf das Verhältnis zur Kunst zurückzukehren, die schlichte Dummheit ist wirklich oft eine Künstlerin. Statt auf ein Reizwort mit einem ändern Wort zu erwidern, wie es in manchen Experimenten einstens sehr üblich war, gibt sie gleich ganze Sätze zur Antwort, und man mag sagen, was man will, diese Sätze haben etwas wie Poesie in sich! Ich wiederhole, indem ich zuerst das Reizwort nenne, einige von solchen Antworten:
»Anzünden: Der Bäcker zündet das Holz an.
Winter: Besteht aus Schnee.
Vater: Der hat mich einmal die Treppe hinuntergeworfen.
Hochzeit: Dient zur Unterhaltung.
Garten: In dem Garten ist immer schön Wetter.
Religion: Wenn man in die Kirche geht.
Wer war Wilhelm Tell: Man hat ihn im Wald gespielt; es waren verkleidete Frauen und Kinder dabei.
Wer war Petrus: Er hat dreimal gekräht.«
Die Naivität und große Körperlichkeit solcher Antworten, der Ersatz höherer Vorstellungen durch das Erzählen einer einfachen Geschichte, das wichtige Erzählen von Überflüssigem, von Umständen und Beiwerk, dann wieder das abkürzende Verdichten wie in dem Petrus-Beispiel, das sind uralte Praktiken der Dichtung; und wenn ich auch glaube, daß ein Zuviel davon, wie es recht in Schwang ist, den Dichter dem Idioten annähert, so ist doch auch das Dichterische in diesem nicht zu verkennen, und es fällt ein Licht darauf, daß der Idiot in der Dichtung mit einer eigentümlichen Freude an seinem Geist dargestellt werden kann.Zu dieser ehrlichen Dummheit steht nun die anspruchsvolle höhere in einem wahrhaft nur zu oft schreienden Gegensatz. Sie ist nicht sowohl ein Mangel an Intelligenz als vielmehr deren Versagen aus dem Grunde, daß sie sich Leistungen anmaßt, die ihr nicht zustehen; und sie kann alle schlechten Eigenschaften des schwachen Verstandes an sich haben, hat aber außerdem auch noch alle die an sich, die ein nicht im Gleichgewicht befindliches, verwachsenes, ungleich bewegliches, kurz, ein jedes Gemüt verursacht, das von der Gesundheit abweicht. Weil es keine »genormten« Gemüter gibt, drückt sich, richtiger gesagt, in dieser Abweichung ein ungenügendes Zusammenspiel zwischen den Einseitigkeiten des Gefühls und einem Verstand aus, der zu ihrer Zügelung nicht hinreicht. Diese höhere Dummheit ist die eigentliche Bildungskrankheit (aber um einem Mißverständnis entgegenzutreten: sie bedeutet Unbildung, Fehlbildung, falsch zustande gekommene Bildung, Mißverhältnis zwischen Stoff und Kraft der Bildung), und sie zu beschreiben, ist beinahe eine unendliche Aufgabe. Sie reicht bis in die höchste Geistigkeit; denn ist die echte Dummheit eine stille Künstlerin, so die intelligente das, was an der Bewegtheit des Geisteslebens, vornehmlich aber an seiner Unbeständigkeit und Ergebnislosigkeit mitwirkt. Schon vor Jahren habe ich von ihr geschrieben: »Es gibt schlechterdings keinen bedeutenden Gedanken, den die Dummheit nicht anzuwenden verstünde, sie ist allseitig beweglich und kann alle Kleider der Wahrheit anziehen. Die Wahrheit dagegen hat jeweils nur ein Kleid und einen Weg und ist immer im Nachteil.« Die damit angesprochene Dummheit ist keine Geisteskrankheit, und doch ist sie die lebensgefährlichste, die dem Leben selbst gefährliche Krankheit des Geistes.
Wir sollten sie gewiß jeder schon in uns verfolgen, und nicht erst an ihren großen geschichtlichen Ausbrüchen erkennen. Aber woran sie erkennen? Und welches unverkennbare Brandmal ihr aufdrücken?! Die Psychiatrie benutzt heute als Hauptkennzeichen für die Fälle, die sie angehen, die Unfähigkeit, sich im Leben zurechtzufinden, das Versagen vor allen Aufgaben, die es stellt, oder auch plötzlich vor einer, wo es nicht zu erwarten wäre. Auch in der experimentellen Psychologie, die es vornehmlich mit dem Gesunden zu tun hat, wird die Dummheit ähnlich definiert. »Dumm nennen wir ein Verhalten, das eine Leistung, für die alle Bedingungen bis auf die persönlichen gegeben sind, nicht vollbringt«, schreibt ein bekannter Vertreter einer der neuesten Schulen dieser Wissenschaft. Dieses Kennzeichen der Fähigkeit sachlichen Verhaltens, der Tüchtigkeit also, läßt für die eindeutigen »Fälle« der Klinik oder der Affenversuchsstation nichts zu wünschen übrig, aber die frei herumlaufenden »Fälle« machen einige Zusätze nötig, weil das richtige oder falsche »Vollbringen der Leistung« bei ihnen nicht immer so einleuchtend ist. Erstens liegt doch in der Fähigkeit, sich allezeit so zu verhalten, wie es ein lebenstüchtiger Mensch unter gegebenen Umständen tut, schon die ganze höhere Zweideutigkeit der Klugheit und Dummheit, denn das »sachgemäße«, »sachkundige« Verhalten kann die Sache zum persönlichen Vorteil benutzen oder ihr dienen, und wer das eine tut, pflegt den, der das andre tut, für dumm zu halten. (Aber medizinisch dumm ist eigentlich nur, wer weder das eine noch das andere kann.) Und zweitens läßt sich auch nicht leugnen, daß ein unsachliches Verhalten, ja sogar ein unzweckmäßiges, oft notwendig sein kann, denn Objektivität und Unpersönlichkeit, Subjektivität und Unsachlichkeit haben Verwandtschaft miteinander, und so lächerlich die unbeschwerte Subjektivität ist, so lebens-, ja denkunmöglich ist natürlich ein völlig objektives Verhalten; beides auszugleichen, ist sogar eine der Hauptschwierigkeiten unserer Kultur. Und schließlich wäre auch noch einzuwenden, daß sich gelegentlich keiner so klug verhält, wie es nötig wäre, daß jeder von uns also, wenn schon nicht immer, so doch von Zeit zu Zeit dumm ist. Es ist darum auch zu unterscheiden zwischen Versagen und Unfähigkeit, gelegentlicher oder funktioneller und beständiger oder konstitutioneller Dummheit, zwischen Irrtum und Unverstand. Es gehört das zum wichtigsten, weil die Bedingungen des Lebens heute so sind, so unübersichtlich, so schwer, so verwirrt, daß aus den gelegentlichen Dummheiten der einzelnen leicht eine konstitutionelle der Allgemeinheit werden kann. Das führt die Beobachtung also schließlich auch aus dem Bereich persönlicher Eigenschaften hinaus zu der Vorstellung einer mit geistigen Fehlern behafteten Gesellschaft. Man kann zwar, was psychologisch-real im Individuum vor sich geht, nicht auf Sozietäten übertragen, also auch nicht Geisteskrankheiten und Dummheit, aber man dürfte heute wohl vielfach von einer »sozialen Imitation geistiger Defekte« sprechen können; die Beispiele dafür sind recht aufdringlich.
Mit diesen Zusätzen ist der Bereich der psychologischen Erklärung natürlich wieder überschritten worden. Sie selbst lehrt uns, daß ein kluges Denken bestimmte Eigenschaften hat, wie Klarheit, Genauigkeit, Reichtum, Löslichkeit trotz Festigkeit und viele andere, die sich aufzählen ließen; und daß diese Eigenschaften zum Teil angeboren sind, zum Teil neben den Kenntnissen, die man sich aneignet, auch als eine Art Denkgeschicklichkeit erworben werden; bedeuten doch ein guter Verstand und ein geschickter Kopf so ziemlich das gleiche. Hierbei ist nichts zu überwinden als Trägheit und Anlage, das läßt sich auch schulen, und das komische Wort »Denksport« drückt nicht einmal so übel aus, worauf es ankommt.
Die »intelligente« Dummheit hat dagegen nicht sowohl den Verstand als vielmehr den Geist zum Widerpart, und wenn man sich darunter nicht bloß ein Häuflein Gefühle vorstellen will, auch das Gemüt. Weil sich Gedanken und Gefühle gemeinsam bewegen, aber auch weil sich in ihnen der gleiche Mensch ausdrückt, lassen sich Begriffe wie Enge, Weite, Beweglichkeit, Schlichtheit, Treue auf das Denken wie auf das Fühlen anwenden; und mag der daraus entstehende Zusammenhang selbst noch nicht ganz klar sein, so genügt es doch, um sagen zu können, daß zum Gemüt auch Verstand gehört und daß unsere Gefühle nicht außer Verbindung mit Klugheit und Dummheit sind. Gegen diese Dummheit ist durch Vorbild und Kritik zu wirken.
Die damit vorgetragene Auffassung weicht von der üblichen Meinung ab, die durchaus nicht falsch, wohl aber äußerst einseitig ist und nach der ein tiefes, echtes Gemüt des Verstandes nicht brauchte, ja durch ihn bloß verunreinigt würde. Die Wahrheit ist, daß an schlichten Menschen gewisse wertvolle Eigenschaften, wie Treue, Beständigkeit, Reinheit des Fühlens und ähnliche ungemischt hervortreten, aber das doch eigentlich nur tun, weil der Wettbewerb der anderen schwach ist; und ein Grenzfall davon ist uns vorhin im Bilde des freundlich zusagenden Schwachsinns zu Gesicht gekommen. Nichts liegt mir ferner, als das gute, rechtschaffene Gemüt mit diesen Ausführungen erniedrigen zu wollen — sein Fehlen hat sogar geziemlichen Anteil an der höheren Dummheit! — aber noch wichtiger ist es heute, ihm den Begriff des Bedeutenden voranzusetzen, was ich freilich nur noch gänzlich utopischerweise erwähne.
Das Bedeutende vereint die Wahrheit, die wir an ihm wahrnehmen können, mit den Eigenschaften des Gefühls, die unser Vertrauen haben, zu etwas Neuem, zu einer Einsicht, aber auch zu einem Entschluß, zu einem erfrischten Beharren, zu irgend etwas, das geistigen und seelischen Gehalt hat und uns oder anderen ein Verhalten »zumutet«; so ließe sich sagen, und was im Zusammenhang mit der Dummheit das wichtigste ist, das Bedeutende ist an der Verstandes- wie an der Gefuhlsseite der Kritik zugänglich. Das Bedeutende ist auch der gemeinsame Gegensatz von Dummheit und Roheit, und das allgemeine Mißverhältnis, worin heute die Affekte die Vernunft zerdrücken, statt sie zu beflügeln, schmilzt im Begriff der Bedeutung zu. Genug von ihm, ja vielleicht schon mehr, als zu verantworten sein möchte! Denn sollte noch etwas hinzugefugt werden müssen, so könnte es nur das eine sein, daß mit allem Gesagten durchaus noch kein sicheres Erkennungs- und Unterscheidungszeichen des Bedeutenden gegeben ist und daß wohl auch nicht leicht ein ganz genügendes gegeben werden könnte. Gerade das führt uns aber auf das letzte und wichtigste Mittel gegen die Dummheit: auf die Bescheidung.
Gelegentlich sind wir alle dumm; wir müssen gelegentlich auch blind oder halbblind handeln, oder die Welt stünde still; und wollte einer aus den Gefahren der Dummheit die Regel ableiten: »Enthalte dich in allem des Urteils und des Entschlusses, wovon du nicht genug verstehst!«, wir erstarrten! Aber diese Lage, von der heute recht viel Aufhebens gemacht wird, ist ähnlich einer, die uns auf dem Gebiet des Verstandes längst vertraut ist. Denn weil unser Wissen und Können unvollendet ist, müssen wir in allen Wissenschaften im Grunde voreilig urteilen, aber wir bemühen uns und haben es erlernt, diesen Fehler in bekannten Grenzen zu halten und bei Gelegenheit zu verbessern, wodurch doch wieder Richtigkeit in unser Tun kommt. Nichts spricht eigentlich dagegen, dieses exakte und stolzdemütige Urteilen und Tun auch auf andere Gebiete zu übertragen; und ich glaube, der Vorsatz: Handle, so gut du kannst und so schlecht du mußt, und bleibe dir dabei der Fehlergrenzen deines Handelns bewußt! wäre schon der halbe Weg zu einer aussichtsvollen Lebensgestaltung.
Aber ich bin mit diesen Andeutungen schon eine Weile am Ende meiner Ausführungen, die, wie ich schützend vorgekehrt habe, nur eine Vorstudie bedeuten sollen. Und ich erkläre mich, den Fuß auf der Grenze, außerstande, weiter zu gehen; denn einen Schritt über den Punkt, wo wir halten, hinaus, und wir kämen aus dem Bereich der Dummheit, der selbst theoretisch noch abwechslungsreich ist, in das Reich der Weisheit, eine öde und im allgemeinen gemiedene Gegend. ■Aus Robert Musil, Über die Dummheit, Vortrag, Wien 1937, Alexander Verlag Berlin
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über die geistige Situation der Zeit
Karl Jaspers
.
Man hat die Gegenwart mit der Zeit des untergehenden Altertums verglichen, mit der der hellenischen Staaten, in denen das Griechentum versank, oder mit dem dritten nachchristlichen Jahrhundert, in dem die antike Kultur überhaupt zusammenbrach. Jedoch bestehen wesentliche Unterschiede. Damals handelte es sich nm eine Welt, die einen kleinen Raum der Erdoberfläche einnahm und die Zukunft des Menschen auch noch außer sich hatte. Heute, wo der Erdball ganz ergriffen ist, muß, was an Menschsein bleibt, in die Zivilisation eintreten, die das Abendland geschaffen hat. Damals ging die Bevölkerung zurück, heute ist sie in nie dagewesener Vervielfachung angewachsen. Damals war in der Zukunft auch die Bedrohung von außen, heute ist äußere Bedrohung für das Ganze partikular, und der Untergang kann nur von innen her erfolgen, wenn er das Ganze treffen sollte. Der handgreifliche Unterschied gegenüber dem dritten Jahrhundert aber ist, daß damals die Technik stagnierte und zu verfallen begann, während sie heute in unerhörtem Tempo ihre unaufhaltsamen Fortschritte macht. Chance wie Gefahr sind hier unabsehbar. Das äußerlich sichtbare Neue, das allem menschlichen Dasein von jetzt an seine Grundlagen und damit neue Bedingungen stellen muß, ist diese Entfaltung der technischen Welt. Zum erstenmal hat eine wirkliche Naturbeherrschung begonnen.
Wollte man sich unsere Welt verschüttet denken, so würden spätere Grabungen zwar keine Schönheiten zutage fördern wie die der Antike, deren Straßenpflaster noch uns entzückt. Aber es würde gegenüber allen früheren Zeiten schon aus den letzten Jahrzehnten so viel Eisen und Beton zu finden sein, daß man noch spät es sehen könnte: der Mensch hatte jetzt den Planeten in ein Netz seiner Apparatur eingesponnen. Dieser Schritt ist gegenüber allen früheren Zeiten so groß wie der erste Schritt zur Werkzeugbildung überhaupt: die Perspektive einer Verwandlung des Planeten in eine einzige Fabrik zur Ausnutzung seiner Stoffe und Energien wird sichtbar. Der Mensch hat das zweitemal die Natur durchbrochen und sie verlassen, um in ihr ein Werk hinzustellen, das sie als Natur nicht nur niemals geschaffen hätte, sondern das nun mit ihr wetteifert an Wirkungsmacht. Nicht schon in der Sichtbarkeit seiner Stoffe und Apparate ist dies Werk vor Augen, sondern erst in der Wirklichkeit ihrer Funktion; der Ausgräber könnte an den Resten von Funktürmen nicht mehr die durch sie hergestellte Allgegenwart der Ereignisse und Nachrichten auf der Erdoberfläche ermitteln.
Was das Neue sei, durch das unsere Jahrhunderte und durch dessen Vollendung unsere Gegenwart gegen das Vergangene sich absetzen, ist auch mit der Weise der Entgötterung der Welt und dem Prinzip der Technisierung keineswegs begriffen. Noch ohne klares Wissen wird immer entschiedener bewußt, in einem Augenblick der Weltwende zu stehen, die nicht an einer der partikularen geschichtlichen Epochen der vergangenen Jahrtausende gemessen werden kann. Wir leben in einer geistig unvergleichlich großartigen, weil an Möglichkeiten und Gefahren reichen Situation, doch müßte sie, würde ihr niemand genug tun können, zur armseligsten Zeit des versagenden Menschen werden.
Im Blick auf die vergangenen Jahrtausende scheint der Mensch vielleicht am Ende. Oder er ist als gegenwärtiges Bewußtsein am Anfang Wienur im Beginn seines Werdens, aber mit erworbenen Mitteln und der Möglichkeit einer realen Erinnerung auf einem neuen, schlechthin anderen Niveau.
Wurde bisher von Situation gesprochen, so in einer abstrakten Unbestimmtheit. Letzthin ist nur der einzelne in einer Situation. Von da übertragend denken wir die Situation von Gruppen, Staaten, der Menschheit, von Institutionen wie Kirche, Universität, Theater, von objektiven Gebilden wie Wissenschaft, Philosophie, Dichtung. Wie wir den Willen einzelner diese als ihre Sache ergreifen sehen, ist dieser Wille mit seiner Sache in einer Situation.
Situationen sind entweder ungewußt und werden wirksam, ohne daß der Betroffene weiß, wie es zugeht. Oder sie werden als gegenwärtige von einem seiner selbst bewußten Willen gesehen, der sie übernehmen, nutzen und wandeln kann. Die Situation als bewußt gemachte ruft auf zu einem Verhalten. Durch sie geschieht nicht automatisch ein Unausweichliches, sondern sie bedeutet Möglichkeiten und Grenzen der Möglichkeiten: was in ihr wird, hängt auch von dem ab, der in ihr steht, und davon, wie er sie erkennt. Das Erfassen der Situation ist von solcher Art, daß es sie schon ändert, sofern es Appell an Handeln und Sichverhalten möglich macht. Eine Situation zu erblicken ist der Beginn, ihrer Herr zu werden, sie ins Auge zu fassen, schon der Wille, der um ein Sein ringt. Wenn ich die geistige Situation der Zeit suche, so will ich ein Mensch sein; solange ich diesem Menschsein noch gegenüberstehe, denke ich über seine Zukunft und Verwirklichung nach; sobald ich aber selbst es bin, suche ich es denkend zu verwirklichen durch Erhellung der faktisch ergriffenen Situation in meinem Dasein.
Es fragt sich jeweils, welche Situation ich meine:
Das Sein des Menschen steht erstens als Dasein in ökonomischen, soziologischen, politischen Situationen, von deren Realität alles andere abhängt, wenn es auch durch sie allein nicht schon wirklich wird.
Das Dasein des Menschen als Bewußtsein steht zweitens in dem Raum dessen, was wißbar ist. Das geschichtlich erworbene, nun vorhandene Wissen in seinem Inhalt und in der Weise, wie gewußt und wie das Wissen methodisch geschieden und erweitert wird, ist Situation als die mögliche Klarheit des Menschen.
Was er selbst wird, ist drittens situationsbedingt durch die Menschen, die ihm begegnen, und durch die Glaubensmöglichkeiten, welche an ihn appellieren.
Wenn ich die geistige Situation suche, muß ich also beachten faktisches Dasein, mögliche Klarheit des Wissens, appellierendes Selbstsein in seinem Glauben, in denen allen der jeweils einzelne sich findet.Aus Karl Jaspers, Die geistige Situation der Zeit, De Gruyter Verlag 1931
Das Zitat der Woche
.
Über die Emanzipation von Musik und Dichtung
Günther Patzig
.
Es mag sein, daß Dichtung als gebundene Form der Rede ihren Ursprung in magischen Vorstellungen hatte, daß ohne ein Ritual eine Tradition poetischer Sprachgestaltung nicht hätte entstehen können: Das bedeutet nicht, daß Dichtung demgegenüber nicht ihr Eigenrecht und Eigengesetz haben und entwickeln könnte. Musik und Gesang mögen nach den verschiedenen Hypothesen ihren Ursprung in der rhythmischen Akzentuierung von Arbeitsvorgängen bei gemeinsamen Arbeiten des Stammes haben, oder sie mögen in biologischen Präformationen als Medium der sexuellen Annäherung, vergleichbar dem Balzverhalten anderer Gattungen von Lebewesen, begründet sein: Das ist zwar ein interessantes Faktum, wenn es eins ist, das nicht vergessen werden sollte, wenn man über Musik und Dichtung spricht; aber es kann nicht zur Definition dessen, was Musik ist und welchen Normen sie unterstellt ist, dienen.
Das Sachgebiet Dichtung und das Sachgebiet Musik haben sich von ihren gesellschaftlichen oder biologischen Entstehungsbedingungen längst emanzipiert. Auch die Wissenschaft, Natur- wie Geisteswissenschaften, muß sich in ihrer inneren Sachbestimmtheit von den »leitenden Interessen« distanzieren. Das wissenschaftliche Interesse ist verschieden vom gesellschaftlichen Interesse an der Wissenschaft, daher kann das gesellschaftliche Interesse weder zur Definition noch zum Kriterium der Objektivität der Wissenschaft herangezogen werden.
Wie ein Segelflugzeug auf die Motorwinde oder ein Schleppflugzeug angewiesen ist, um seinen Flug beginnen zu können, so ist die Wissenschaft auf gesellschaftliches Interesse angewiesen, um in Gang zu kommen. Hat sie aber erst einmal die Region erreicht, in der sie vom Aufwind des Wahrheitsstrebens erfaßt wird, so gehorcht sie, wie das Segelflugzeug, ihren eigenen Gesetzen.Aus Günther Patzig, Erklären und Verstehen, Bemerkungen zum Verhältnis von Natur- und Geisteswissenschaften, in Neue Rundschau 84/3 1973
Das Zitat der Woche
.
Über das Spiel in der Kunst
Hans-Georg Gadamer
.
Was ist die anthropologische Basis unserer Erfahrung von Kunst? […] Insbesondere geht es um den Begriff Spiel. Die erste Evidenz, die wir uns da verschaffen müssen, ist, daß Spiel eine elementare Funktion des menschlichen Lebens ist, so daß menschliche Kultur ohne ein Spielelement überhaupt nicht denkbar ist. Daß menschliche Religionsübung im Kult ein Spielelement einschließt, ist seit langem von Denkern wie Huizinga, Guardini und anderen betont worden. Es ist lohnend, sich die elementare Gegebenheit des menschlichen Spielens in ihren Strukturen zu vergegenwärtigen, damit das Spielelement der Kunst nicht nur negativ, als Freiheit von Zweckbindungen, sondern als freier Impuls sichtbar wird. Wann reden wir von Spiel, und was ist darin impliziert? Sicherlich als erstes das Hin und Her einer Bewegung, die sich ständig wiederholt – man denke einfach an gewisse Redeweisen, wie etwa «das Spiel der Lichter» oder «das Spiel der Wellen», wo ein solches ständiges Kommen und Gehen, ein Hin und Her vorliegt, d. h. eine Bewegung, die nicht an ein Bewegungsziel gebunden ist. Das ist es offenbar, was das Hin und Her so auszeichnet, daß weder das eine noch das andere Ende das Ziel der Bewegung ist, in der sie zur Ruhe kommt. Es ist ferner klar, daß zu einer solchen Bewegung Spielraum gehört. Das wird uns für die Frage der Kunst besonders zu denken geben. Die Freiheit der Bewegung, die hier gemeint ist, schließt ferner ein, daß diese Bewegung die Form der Selbstbewegung haben muß. Selbstbewegung ist der Grundcharakter des Lebendigen überhaupt. Das hat schon Aristoteles, das Denken aller Griechen formulierend, beschrieben. Was lebendig ist, hat den Antrieb der Bewegung in sich selber, ist Selbstbewegung. Das Spiel erscheint nun als eine Selbstbewegung, die durch ihre Bewegung nicht Zwecke und Ziele anstrebt, sondern die Bewegung als Bewegung, die sozusagen ein Phänomen des Überschusses, der Selbstdarstellung des Lebendigseins, meint. Das ist es in der Tat, was wir in der Natur sehen – das Spiel der Mücken etwa oder all die bewegenden Schauspiele des Spiels, die wir in der Tierwelt, insbesondere bei Jungtieren, beobachten können. All das entstammt offenkundig dem elementaren Überschußcharakter, der in der Lebendigkeit als solcher nach Darstellung drängt. Nun ist es das Besondere des menschlichen Spieles, daß das Spiel auch die Vernunft, diese eigenste Auszeichnung des Menschen, sich Zwecke setzen und sie bewußt anstreben zu können, in sich einzubeziehen und die Auszeichnung der zwecksetzenden Vernunft zu überspielen vermag. Das nämlich ist die Menschlichkeit des menschlichen Spiels, daß es in dem Bewegungsspiel sich seine Spielbewegungen sozusagen selbst diszipliniert und ordert, als ob da Zwecke wären, z.B. wenn ein Kind zählt, wie oft der Ball auf den Boden schlagen kann, bevor er ihm entgleitet.
Hans-Georg Gadamer (1900-2002)
Was sich hier in Form des zweckfreien Tuns selber Regeln setzt, das ist Vernunft. Das Kind ist unglücklich, wenn der Ball schon beim zehnten Male wegrutscht, und stolz wie ein König, wenn es dreißigmal geht. Diese zweckfreie Vernünftigkeit im menschlichen Spielen bedeutet einen Zug im Phänomen, der uns weiterhelfen wird. Es zeigt sich nämlich hier, insbesondere am Phänomen der Wiederholung als solcher, daß Identität, Selbigkeit gemeint ist. Das Ziel, auf das es hier herauskommt, ist zwar ein zweckloses Verhalten, aber dieses Verhalten ist als solches selber gemeint. Es ist das, was das Spiel meint. Mit Anstrengung und Ehrgeiz und ernstester Hingabe wird in dieser Weise etwas gemeint. Dies ist ein erster Schritt auf dem Weg zur menschlichen Kommunikation; wenn hier etwas dargestellt wird – und sei es nur die Spielbewegung selber -, so gilt auch für den Zuschauer, daß er es «meint» – so wie ich mir selbst im Spielen wie ein Zuschauer gegenübertrete. Es ist die Funktion der Spieldarstellung, daß nicht irgend etwas Beliebiges, sondern die so und so bestimmte Spielbewegung am Ende steht. Spiel ist also letzten Endes Selbstdarstellung der Spielbewegung.
Ich darf sofort hinzufügen: Solche Bestimmung der Spielbewegung bedeutet zugleich, daß Spielen immer Mitspielen verlangt. Selbst der Zuschauer, der etwa einem Kind zuschaut, das da mit dem Ball hin und her spielt, kann gar nicht anders. Wenn er wirklich »mitgeht«, ist das nichts anderes als die participatio, die innere Teilnahme an dieser sich wiederholenden Bewegung. Bei höheren Formen des Spieles wird das oft sehr anschaulich: Man braucht sich nur einmal, im Fernsehen z.B., das Publikum bei einem Tennisturnier anzusehen! Es ist eine reine Halsverrenkung. Keiner kann es unterlassen, mitzuspielen. – Es scheint mir also ein weiteres wichtiges Moment, daß Spiel auch in dem Sinne ein kommunikatives Tun ist, daß es nicht eigentlich den Abstand kennt zwischen dem, der da spielt, und dem, der sich dem Spiel gegenübersieht. Der Zuschauer ist offenkundig mehr als nur ein bloßer Beobachter, der sieht, was vor sich geht, sondern ist als einer, der am Spiel «teilnimmt», ein Teil von ihm. Natürlich sind wir bei solchen einfachen Spielformen noch nicht bei dem Spiel der Kunst. Aber ich hoffe gezeigt zu haben, daß das kaum noch ein Schritt ist, was da vom kultischen Tanz zu der als Darstellung gemeinten Begehung des Kultes führt. Und daß es kaum ein Schritt ist, der von da zu der Freisetzung der Darstellung führt, etwa zum Theater, das aus diesem Kultzusammenhang als seine Darstellung herauswuchs. Oder zur bildenden Kunst, deren Schmuck- und Ausdrucksfunktion im Ganzen eines religiösen Lebenszusammenhanges erwächst. Das geht ineinander über. Aber daß es ineinander übergeht, bestätigt ein Gemeinsames in dem, was wir als Spiel erörterten, nämlich daß da etwas als etwas gemeint ist, auch wenn es nichts Begriffliches, Sinnvolles, Zweckhaftes ist, sondern etwa die reine selbstgesetzte Bewegungsvorschrift. Das scheint mir für die heutige Diskussion der modernen Kunst außerordentlich bedeutsam.Aus Hans-Georg Gadamer, Die Aktualität des Schönen, Reclam Verlag 1977








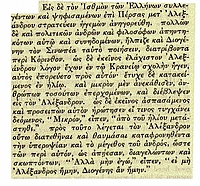














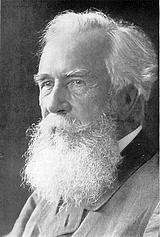




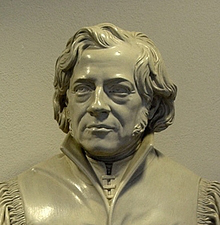






















leave a comment