Das Zitat der Woche
.
Vom Christsein in problematischer Welt
Emerich Coreth
.
Von größter Bedeutung ist, daß die Christen in unserer Zeit ihre Sendung und Verantwortung gegenüber den brennenden Problemen der heutigen Welt erkennen und in Angriff nehmen. Auf die Probleme des materiellen Fortschritts in der technisch-industrialisierten Welt, auf den erschreckenden Sinnverlust in dieser modernen Gesellschaft wurde schon hingewiesen, und darauf, daß der christliche Glaube hier gültige Antwort zu geben hat.
Aber es geht nicht nur um transzendente Sinngebung, sondern auch um die weltimmanenten Probleme selbst, das ungeheuere soziale Problem der heutigen Menschheit, das Gefälle zwischen arm und reich, die grauenhafte Not und das Elend, in dem Hunderte Millionen von Menschen in unterentwickelten Ländern leben – und täglich an Hunger sterben – gegenüber dem Wohlstand der Industrienationen. Die Kirche hat sich aus dem Geist Christi auf die Seite der Armen, der Unterdrückten, der Benachteiligten zu stellen, und sie tut es in zunehmendem Maße. Sicher hat das Evangelium nicht für alle konkreten sozialen und wirtschaftlichen Fragen fertige Patentlösungen anzubieten. Wohl aber kann ein Christentum, das die Botschaft Jesu ernst nimmt, nicht nur ewiges Heil schenken, sondern auch – in einer heillosen Welt – irdisches Heil zu vermitteln helfen: aus dem Geist christlicher Liebe, durch den Einsatz für Friede und Gerechtigkeit, das Sein-für-andere, wie es Christus gelebt und gelehrt hat.
Zwar ist es nicht richtig, das Christsein auf die horizontale Ebene zu reduzieren und darüber die vertikale Dimension zu vergessen oder zu verschweigen, aber ebenso unrichtig und einseitig wäre es, Christsein nur in der vertikalen ohne die horizontale Dimension verwirklichen zu wollen. Beides gehört zusammen: Liebe zu Gott und zu den Menschen, Religion und Einsatz für den Mitmenschen. Christliche Liebe ist aber mehr als bloße »Mitmenschlichkeit«, weil sie im Glauben an Gott gründet, den Gott aller Menschen, der das Heil aller will und in seiner Liebe alle umfängt. Nur aus Gott, der uns – uns alle – zuvor geliebt hat, kann echte, selbstlos dienende und helfende Liebe zu den Menschen Mut und Kraft, Geduld und Zuversicht schöpfen.
Solche Überlegungen zur Weltsendung des christlichen Glaubens in unserer Zeit gehören mit hinein in mein Verständnis des Christseins. Diese Aspekte und Dimensionen der christlichen Botschaft sind die Entfaltung des einen Notwendigen, die folgerichtige Ausstrahlung und Auswirkung des einzig Zentralen. So bleibt schließlich meine Antwort auf die Frage, warum ich Christ bin, auf die Mitte bezogen, aus der das Ganze lebt. Die Antwort heißt ganz einfach: weil ich glaube.Aus Emerich Coreth, Christsein aus Herkunft und Berufung, in: W.Jens (Hrsg.), Warum ich Christ bin, Kindler Verlag 1979
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Der Glaube des Westens
Theodor Haecker
.
Erst als die jungen Völker Europas, mitbringend nur ihr reiches Blut, ihre ungebändigte edle geistgerichtete Kraft und Leidenschaft, aber auserlesen, das Wertvollste zu empfangen, was die Welt hatte, auf ihren säftestrotzenden Stamm das köstliche Reis übernatürlichen Lebens gepfropft erhalten hatten, entstand auch eine Natur und natürliches Leben umfassende Literatur; indes auch sie war katholisch, niemals die unsichtbare Welt verleugnend, sie immer durchscheinen lassend. Die lateinisch sprechende und schreibende Kirche hat die Nationen Europas deren eigene Sprachen sprechen und schreiben gelehrt. Und damit war der Sinn Europas gegeben und enthüllt. Europa ist das Kind des Einen Glaubens und als dieses Kind der einzige Erbe des griechischen und römischen Geistes, der westlichen Kunst mit der Prävalenz der Leichtheit und Lichtheit strenger Form vor aller Schwere und Nacht chaotischen Inhalts; der westlichen Philosophie mit der Herrschaft des lebendigen Logos über Trieb und Drang und Leidenschaft; der westlichen Wissenschaft mit der Idee des Gesetzes und der Regel und der «Humanität». Das ist der «Westen» und das der Sinn des Westens und seiner Literatur, auch wenn diese nicht direkt davon, sondern sachlich von anderen Dingen spricht, was sie muß und soll: Im Gehorsam des Einen Glaubens, welcher das erste ist, an das Heil, das von den Juden kam, die Erben zu sein der Griechen, der Dämonie wie der Heiterkeit ihrer Kunst, der Exaktheit ihrer Wissenschaft, der Erhabenheit ihrer Metaphysik und ihrer großen Idee, der Humanität – Erben, nicht Sklaven, legitime Erben in aller Unmittelbarkeit ihres eigenen Lebens mit allen Rechten ihrer eigenen unvergleichlichen Natur, in der Freiheit und Gebundenheit ihrer eigenen mitgegebenen an die Nationen einzeln verteilten Gaben.
Dieses, aber zuerst den Glauben haben, das ist der geistige Sinn der europäischen Völker, das, und das allein, ist ihre verborgene Einheit, von diesem Sinne leben sie mitten in Schuld und Blut und Sünden, verlieren sie ihn ganz, sterben sie, wenn auch schreiend und schreibend. Es haben Zeiten gemeint und diese Tage meinen es noch, daß das antike Erbe: Philosophie, Kunst und Wissenschaft, wie nur der Westen sie hat, und Humanität, wie nur der Westen als Idee sie kennt, bewahrt und realisiert werden könne auch trotz oder gar wegen der Emanzipation von dem Einen Glauben. Ein gewaltiger Irrtum! Ohne den christlichen Glauben ist Europa nur ein Sandkorn im Wirbelwind der Meinungen, Ideen und Religionen, es wird morgen auf den Knien liegen vor den Russen, übermorgen vor den Japanern, in drei Tagen vor den Chinesen, in vieren vor den Indern, am letzten aber ganz gewiß die Beute der Neger sein; es wird morgen das Matriarchat haben und übermorgen die Pornokratie; seine Literatur wird nur mehr kennen und sagen die untergeistigen Dinge, nämlich die gnostischen, die unterseelischen, nämlich die psychoanalytischen, die unterleiblichen, nämlich eben diese in Unzucht und Perversion.
Aus Theodor Haecker, Der Sinn des Abendlandes (Tag- und Nachtbücher) 1939-45
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Vom Glauben und vom Wissen
Christian Nürnberger
.
Wir stehen, was die letzten Fragen betrifft, wieder da, wo wir vor 250 Jahren aufgebrochen sind, um diese Fragen durch das Unternehmen Wissenschaft einer endgültigen Klärung zuzuführen. Dieses Unternehmen entdeckt heute seine Unzuständigkeit für eine solche Klärung. Die Unzuständigkeit resultiert aus der mittlerweile erfolgten Selbstbeschränkung bei der Wahrheitssuche. Die Wissenschaft verlangt aus guten Gründen, bevor sie etwas als wissenschaftlich bewiesenes Faktum anerkennt, dass dieses Faktum jederzeit an jedem Ort der Welt unter Befolgung der angegebenen Methode reproduzierbar nachgewiesen werden kann. Dadurch entzieht sie aber weite Teile der Wirklichkeit dem wissenschaftlichen Zugriff, denn jeder weiß aus seinem eigenen Leben, dass vieles, meist sogar das Wesentliche, aus einmaligen, unwiederholbaren, für andere kaum kontrollierbaren Ereignissen besteht.
Das, was uns in unserem Innersten existenziell betrifft – Liebe, Leid, Hass, Freundschaft, Vertrauen, Freude, Trauer, Glück, Freiheit, Religion – also das eigentlich Interessante in unserem Leben, ist dieser Art von rigider Wissenschaft prinzipiell unzugänglich. Daher kann sie auch keine negative oder positive oder sonst wie geartete Aussage über diesen Teil der Realität machen und rück-überweist uns zu Philosophie, Theologie und Ethik. Insofern liegt in der Selbstbeschränkung heutiger Wissenschaft die stärkste Kritik am Bultmannschen Theologie-Ansatz. Das allzu dogmatische Anlegen wissenschaftlicher Kriterien an den Glauben könnte eine voreilige Unterwerfung gewesen sein.
Weil die ganze Wirklichkeit größer ist als jener Teilbereich, der wissenschaftlichen Methoden zugänglich ist, steht die Tür zu Religion und Glaube wieder offen. An Wunder glauben zu sollen, wird uns dennoch weiterhin als Zumutung erscheinen, aber die Frage, was Menschen intellektuell zugemutet werden kann, spielt keine besonders große Rolle, wenn es um Gott und die Wahrheit geht, denn das menschliche Fassungsvermögen ist immer zu klein für Gott, und darum sind wir damit sowieso und immerzu überfordert.
Selbst wenn es Gott nicht geben sollte, scheitern wir an den letzten Fragen, denn der Urknall trägt dazu gar nichts bei. Was war vorher? Was hat ihn bewirkt? Eben darauf haben wir keine Antwort. Wer aber daraus folgert, gerade deshalb müsse man annehmen, ein Schöpfergott stecke hinter dem Urknall, denn von nichts kommt nichts, verkennt, dass die letzte Frage damit nur um ein weiteres, allerletztes Glied nach hinten verschoben wird, denn woher kommt Gott? Wie ist er entstanden? Die Antwort, er sei nicht entstanden, sondern seit ewiger Zeit immer schon dagewesen, überfordert uns vielleicht noch mehr als die Vorstellung, der Kosmos sei aus dem Nichts entstanden. So oder so stoßen wir an eine Erkenntnisgrenze, die, wenn überhaupt, nur durch religiöse Offenbarung oder durch Glauben zu überwinden ist.
Daher gilt auch in der Wissensgesellschaft weiter die alte Volksweisheit, wonach es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gebe, als sich unsere Schulweisheit träumen lässt. Uns wird also, wo es um letzte Wahrheiten geht, sowieso mehr zugemutet, als wir fassen können. Daher wäre eine Theologie, die den Glauben so lange zurechtvernünftelt, bis er endlich vom begrenzten menschlichen Verstand erfasst und vom letzten Allerwelts-Atheisten akzeptiert werden kann, wertlos und überflüssig. Und eine Theologie, welche die gesamte Bibel einfach nur deshalb »erledigte«, weil sie angeblich inkompatibel zum aufgeklärten Bewusstsein sei, überschritte ihre Grenzen.
Glaube und Wissen werden wir daher nie zur Deckungsgleichheit bringen können, sollten es auch gar nicht versuchen, denn es sind zwei verschiedene Kategorien, die auseinanderzuhalten sind. Ginge Glaube in Wissen auf, wäre er kein Glaube mehr. Verzichteten wir aber darauf, Glaubensinhalte mit dem Wissen zu konfrontieren und zu prüfen, handelte es sich nicht mehr um echten Glauben, sondern um unsicheres Wissen, Noch-nicht-Wissen, Unwissen, Vermutung oder schlicht um zum Glauben erhobene Ignoranz, welche oft auch noch frech das grundgesetzlich verbriefte Recht der Religionsfreiheit für sich reklamiert, um unter diesem Schutz allerhand Teufeleien auszuhecken.
Die Tür zum Glauben ist offen, auch in der Wissens- und Hightech-Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Aber wer den Weg zu dieser Tür weisen, gar deren Schwelle überschreiten will und verlangt, ihm auf diesem Weg zu folgen, muss sich kritisch fragen lassen, warum er glaubt, dass es die richtige Tür ist. Echter Glaube, der auch heute noch ernst genommen und respektiert werden will, muss allen seit der Aufklärung vorgebrachten religionskritischen Einwänden standhalten. Das aber gelingt nur, wenn sich der Glaubende bemüht, das Niveau der Aufklärung zu erklimmen und Anschluss zu halten an den jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Diskussion.Aus: Christian Nürnberger, Glaube und Wissen, in: Jesus für Zweifler, Gütersloher Verlagshaus 2007
.
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Vom «vernünftigen» Glauben
Hans Küng
.
Auch Sie – ich muß hier klar reden – stehen damit vor einer Alternative: Entweder – Sie sterben ins Nichts hinein: Ist das Ihre Einstellung, will ich ihr den Respekt nicht versagen. Diese Auffassung kann kaum widerlegt werden. Freilich hat sie auch noch niemand positiv bewiesen. Nie hat es jemanden gegeben, der bewiesen hätte, daß wir ins Nichts hineinsterben und all unser Leben, Wirken, Lieben, Leiden im Nichts endet, letztlich für nichts war. Und vernünftig, nein, vernünftig erscheint mir diese Möglichkeit auf keinen Fall. Oder – Sie sterben in jene allerletzte Wirklichkeit hinein, die dann auch die allererste, die unfaßbar-umfassende wirklichste Wirklichkeit ist, die wir Gott nennen: Diese Möglichkeit kann ebenfalls nicht rational bewiesen werden, kann freilich auch nicht widerlegt werden. Doch können Sie sich in einem, wie ich meine, durchaus vernünftigen, aufgeklärten Vertrauen darauf einlassen: nicht um sich auf ein Jenseits zu vertrösten, sondern um sich im Diesseits entschiedener einzusetzen.
Daß Sie nicht ins Nichts, sondern in Gott hineinsterben: vernünftiger, ja vernünftig erscheint mir dies allemal. Denn: wenn Gott wirklich existiert und wenn dieser existierende Gott wirklich Gott ist, dann kann er nicht nur der Gott des Anfangs, dann muß er auch der Gott des Endes sein. Dann ist er wie unser Schöpfer so auch unser Vollender. Auch dies also ist Sache eines vernünftigen Vertrauens: Glaubend traue ich diesem Gott alles, auch das Letzte, auch die Überwindung des Todes zu. Dem Schöpfer und Erhalter des Kosmos und des Menschen, und nur ihm, ist zuzutrauen, daß er auch bei Sterben und Tod über die Grenzen alles bislang Erfahrenen hinaus noch ein Wort mehr zu sagen hat: daß ihm wie das erste so auch das letzte Wort gehört. Wenn ich ernsthaft an den ewigen, lebendigen Gott glaube, glaube ich auch an Gottes ewiges Leben, an mein ewiges Leben. Wenn ich somit mein Credo mit dem Glauben an »Gott, den allmächtigen Schöpfer« anfange, so darf ich es – so meine ich – auch ruhig mit dem Glauben an »das ewige Leben« beenden.
Aus Hans Küng, Das sogenannte und das wahrhaft Christliche; in: W. Jens (Hrsg.), Warum ich Christ bin, Kindler Verlag 1979
.
.
.
Themenverwandte Links
8. Weltethos-Rede – Hans Küng hat keine Umarmung verdient? – Hans Küng erhält Abraham-Geiger-Preis – Die Papst-Kritiker-Industrie – Wegweiser ohne Würde
Berg-Gedichte (3)
Und es geschah am dritten Tag,
als es Morgen wurde, da brachen
Donner und Blitze los, und eine schwere Wolke
lagerte auf dem Berg, und ein starker
Hörnerschall ertönte, so daß das ganze Volk,
das im Lager war, erbebte.
Mose aber führte das Volk aus dem
Lager hinaus, Gott entgegen,
und sie stellten sich
am Fuß des Berges auf.
Und der ganze Berg Sinai rauchte,
weil Jahwe im Feuer auf ihn herabkam.
Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch
eines Schmelzofens, und der ganze Berg
bebte heftig.
Und der Hörnerschall wurde immer stärker.
Mose redete, und Gott antwortete ihm
mit lauter Stimme.
Und Jahwe stieg auf den Berg Sinai herab,
auf den Gipfel des Berges, und Jahwe rief Mose
auf den Gipfel des Berges,
und Mose stieg hinauf.
Das Zitat der Woche
.
«Die Bibel? Ein echter Reißer!»
Umberto Eco
.
Ich muss sagen, als ich den Anfang dieses Manuskripts und die ersten hundert Seiten las (Eco erstellt hier einen Lektorenbericht über die Bibel…/Anm. der Red.), war ich begeistert. Alles Action, prallvoll mit allem, was die Leser heute von einem richtigen Schmöker erwarten: Sex (jede Menge), Ehebrüche, Sodomie, Mord und Totschlag, Inzest, Kriege, Massaker usw. Die Episode in Sodom und Comorra mit den Schwulen, die die zwei Engel vernaschen wollen, könnte von Rabelais sein; die Geschichte von Noah sind reinster Karl May, die Flucht nach Ägypten schreit geradezu nach Verfilmung… Kurz, ein echter Reißer, gut konstruiert, mit effektsicheren Theatercoups, voller Fantasy, dazu genau die richtige Prise Messianismus, ohne die Sache ins Tragische kippen zu lassen.
Beim Weiterlesen habe ich dann gemerkt, dass es sich um eine Anthologie diverser Autoren handelt, eine Zusammenstellung sehr heterogener Texte mit vielen, zu vielen poetischen Stellen, von denen manche auch ganz schön fade und larmoyant sind, echte Jeremiaden ohne Sinn und Verstand.
Was dabei herauskommt, ist ein monströses Sammelsurium, ein Buch, das alle bedienen will und daher am Ende keinem gefällt.
Außerdem wäre es eine Heidenarbeit, die Rechte von all den Autoren einzuholen, es sei denn, der Herausgeber stünde dafür gerade. Aber dieser Herausgeber wird leider nirgends genannt, nicht mal im Register, als ob es irgendwie Hemmungen gäbe, seinen Namen zu nennen.
Ich würde vorschlagen zu verhandeln, um zu sehen, ob man nicht die ersten fünf Bücher allein herausbringen kann. Das wäre ein sicherer Erfolg. Mit einem Titel wie Die verlorene Schar vom Roten Meer oder so.Aus Umberto Eco, Platon im Striptease-Lokal, Parodien und Travestien, darin: <…müssen wir mit Bedauern ablehnen (Lektoratsgutachten)>, Hanser Verlag 1990
Das Zitat der Woche
.
Vom Recht auf Leben
John Leslie Mackie
Von einem Recht auf Leben können wir sinnvollerweise nur als einem Anspruchsrecht reden, das der Pflicht entspricht, nicht zu töten und nichts zu unternehmen, was voraussichtlich zum Tod eines Menschen führt. Obwohl ein solches Recht fundamental ist, kann es doch nicht absolut sein. So wie die Welt nun einmal ist, lassen sich Kriege und Revolutionen nicht ausnahmslos als moralisch verwerflich ausschließen. Für die Todesstrafe ist dies meines Erachtens möglich. Die vorsätzliche Tötung eines Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt stellt eine solche Herausforderung dar für jedes humane Empfinden, das für die Moral unabdingbar ist, daß sie sich durch keine zusätzlich abschreckende Wirkung aufwiegen läßt; tatsächlich ist die Vollstreckung der Todesstrafe sogar eher dazu angetan, die Kriminalität noch zu erhöhen. Doch zeitlich sehr lang bemessene Gefängnisstrafen sind vielleicht wenigstens genauso inhuman.
Es gibt viele Aktivitäten, die bekanntermaßen Lebensrisiken in sich bergen – Bergbau, Brückenbau, Kricket oder Autofahrt. Zweifellos sollten wir Vorkehrungen treffen, um dieses Risiko zu senken; doch nehmen wir um anderer Vorteile willen ein gewisses Risiko in Kauf. Ganz gewiß fielen weit weniger Menschen dem Verkehr zum Opfer, wenn für alle Fahrzeuge mit Ausnahme von Noteinsätzen eine Geschwindigkeitsbegrenzung etwa von 30 km/h eingeführt würde. Da wir keinesfalls die aktive Tötung einer vergleichbaren Zahl von Menschen in Kauf nähmen, um gleichgültig welche Vorteile auch immer aus einer höheren Verkehrsgeschwindigkeit zu ziehen, scheint es paradox, daß wir die statistische Gewißheit einer gleich hohen Zahl von Verkehrstoten hinnehmen, solange es sich für jeden (bis er tatsächlich zu Tode kommt) nur um ein Lebensrisiko handelt. Dies erscheint jedoch weniger paradox, wenn wir uns klarmachen, daß es hier nicht einfach um das Resultat – so viele Tote – geht, sondern um ein gedeihliches Leben bestimmter Art, das von entsprechenden Dispositionen getragen wird. Aus diesem Blickwinkel sind Lebensrisiken durchaus in Kauf zu nehmen, hingegen aktive Tötungshandlungen nicht – jedenfalls so lange, wie diejenigen, die die bekannten Risiken um irgendwelcher Vorteile willen in Kauf nehmen, sie für ihr eigenes Leben in Kauf nehmen. Unfair ist es, obwohl es häufiger vorkommt, daß man um eigener Vorteile willen Risiken für das Leben anderer in Kauf nimmt, die selbst eine solche Wahl nicht treffen und auch niemals treffen würden. Wenn sich jedoch die verschiedenen Parteien nicht voneinander isolieren lassen, so scheint eine moralisch annehmbare Lösung in irgendeinem Kompromiß zwischen denjenigen, die bereit sind, bestimmte Risiken in Kauf zu nehmen, und denjenigen, die dazu nicht bereit sind. zu bestehen.
Aus dem Recht auf Leben folgt ein Recht auf Beendigung des eigenen Lebens, obwohl auch dieses Recht nicht ausnahmslos gilt: Auf Seiten anderer können Ansprüche bestehen, die gegen eine Selbsttötung sprechen, die aus der Sicht allein des Handelnden als vorzugswürdig erscheint. Dennoch wäre es nicht schwierig, Umstände zu beschreiben, unter denen eine Selbsttötung erlaubt wäre. Auch kann es nicht moralisch falsch sein, Beihilfe zu einer freiwilligen Selbsttötung zu leisten. Dasselbe Prinzip läßt sich auch zugunsten der Erlaubtheit der Euthanasie anführen, unter der Voraussetzung, daß der Kranke unter Angabe einsichtiger Gründe wirklich und ernsthaft seinen eigenen Tod wünscht und darum bittet. Schwieriger ist die Frage, ob es jemals richtig sein kann, aufgrund eines beim Kranken nur vermuteten Wunsches, sein Leben zu beenden, aktiv zu werden. Meines Erachtens müßten die Gründe für eine solche Vermutung sehr stark sein. Wenn jemand jedoch unter beständigem Einsatz aufwendigster Apparaturen nur gerade noch am Leben erhalten werden kann, ohne daß sein Leben für ihn offensichtlich noch lebenswert ist, ist es richtig, ihn sterben zu lassen.
Vielleicht habe ich den Eindruck erweckt, als würde ich sehr voreilig über hochkomplizierte Sachverhalte urteilen. Ich gebe zu, daß diese Fragen einer sorgfältigeren Prüfung bedürfen. Doch meine ich, daß weder die Zitierung von Schlagwörtern wie «Mord» noch die Rede von der Heiligkeit des Lebens noch auch Versuche, aufgrund einer Abwägung aller Folgen in bezug auf das allgemeine Glück zu einem Urteil zu gelangen, hier hilfreich sein können. Vielmehr sollte man sich sein Urteil stärker von den für diese Fragen relevanten Werten, Rechten und Dispositionen her bilden und diese wiederum von gewöhnlichen und weniger umstrittenen Fällen her zu verstehen suchen.
(Aus John L. Mackie: Ethik / Elemente einer praktischen Moral, Reclam Verlag 1981)
Das Zitat der Woche
Religion und Wissenschaft
Albert Einstein
.
Das Individuum fühlt die Nichtigkeit menschlicher Wünsche und Ziele und die Erhabenheit und wunderbare Ordnung, welche sich in der Natur sowie in der Welt des Gedankens offenbart. Es empfindet das individuelle Dasein als eine Art Gefängnis und will die Gesamtheit des Seienden als ein Einheitliches und Sinnvolles erleben. Ansätze zur kosmischen Religiosität finden sich bereits auf früher Entwicklungsstufe, z. B. in manchen Psalmen Davids sowie bei einigen Propheten. Viel stärker ist die Komponente kosmischer Religiosität im Buddhismus, was uns besonders Schopenhauers wunderbare Schriften gelehrt haben. — Die religiösen Genies aller Zeiten waren durch diese kosmische Religiosität ausgezeichnet, die keine Dogmen und keinen Gott kennt, der nach dem Bild des Menschen gedacht wäre. Es kann daher auch keine Kirche geben, deren hauptsächlicher Lehrinhalt sich auf die kosmische Religiosität gründet. So kommt es, daß wir gerade unter den Häretikern aller Zeiten Menschen finden, die von dieser höchsten Religiosität erfüllt waren und ihren Zeitgenossen oft als Atheisten erschienen, manchmal auch als Heilige. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, stehen Männer wie Demokrit, Franziskus von Assisi und Spinoza einander nahe.
 Wie kann kosmische Religiosität von Mensch zu Mensch mitgeteilt werden, wenn sie doch zu keinem geformten Gottesbegriff und zu keiner Theologie führen kann? Es scheint mir, daß es die wichtigste Funktion der Kunst und der Wissenschaft ist, dies Gefühl unter den Empfänglichen zu erwecken und lebendig zu erhalten.
Wie kann kosmische Religiosität von Mensch zu Mensch mitgeteilt werden, wenn sie doch zu keinem geformten Gottesbegriff und zu keiner Theologie führen kann? Es scheint mir, daß es die wichtigste Funktion der Kunst und der Wissenschaft ist, dies Gefühl unter den Empfänglichen zu erwecken und lebendig zu erhalten.
So kommen wir zu einer Auffassung von der Beziehung der Wissenschaft zur Religion, die recht verschieden ist von der üblichen. Man ist nämlich nach der historischen Betrachtung geneigt, Wissenschaft und Religion als unversöhnliche Antagonisten zu halten, und zwar aus einem leichtverständlichen Grund. Wer von der kausalen Gesetzmäßigkeit allen Geschehens durchdrungen ist, für den ist die Idee eines Wesens, welches in den Gang des Weltgeschehens eingreift, ganz unmöglich — vorausgesetzt allerdings, daß er es mit der Hypothese der Kausalität wirklich ernst nimmt. Die Furcht-Religion hat bei ihm keinen Platz, aber ebensowenig die soziale bzw. moralische Religion. Ein Gott, der belohnt und bestraft, ist für ihn schon darum undenkbar, weil der Mensch nach äußerer und innerer gesetzlicher Notwendigkeit handelt, vom Standpunkt Gottes aus also nicht verantwortlich wäre, sowenig wie ein lebloser Gegenstand für die von ihm ausgeführten Bewegungen. Man hat deshalb schon der Wissenschaft vorgeworfen, daß sie die Moral untergrabe, jedoch gewiß mit Unrecht. Das ethische Verhalten des Menschen ist wirksam auf Mitgefühl, Erziehung und soziale Bindung zu gründen und bedarf keiner religiösen Grundlage. ♦
Aus: Albert Einstein, Religion und Wissenschaft, Berliner Tagblatt 1930
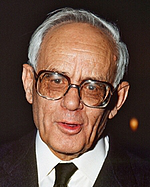

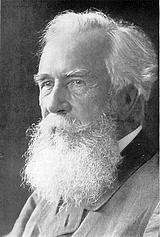

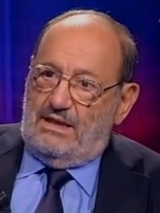
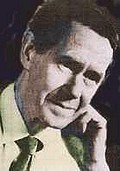





leave a comment