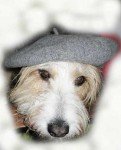Die ungewöhnlichen Gedanken des Christian Hänggi
Freitag, 30. November 2012Gastfreundschaft dem freien Geist
In Zürich belästigte vor wenigen Wochen ein gigantisches Megaposter am Bellevue den empfindsamen Passanten. Calida ließ eine Frau in Dessous posieren und betextete das Bild mit den Worten: „Mittelpunkt des Universums: Ich“! Auch wenn das nur zu gut nach Zürich passt, und wenn es Hunderten von kleinen Mittelpunkten im smartphonefixierten Vorbeihasten wohl gar nicht auffiel, kann man solche Werbebotschaften als Belästigung und usurpatorische In-Besitznahme des öffentlichen Raumes wahrnehmen. Dabei geht es doch auch anders!
Da ist beispielsweise das ebenso diskrete wie unscheinbare Traktätchen mit dem Titel „Vorträge für Besetzungen, und nicht nur…“, das mir bei einer ohnehin schon obskuren Veranstaltung wie dem Theory Tuesday im Corner College in Zürich in die Augen und in die Hände fiel. Im Vorwort macht der Autor, der sich bescheiden C. H. abkürzt, das Heftlein dem, der es aufnehmen will, zum Geschenk.
Der Autor schien aus dem Umkreis der Autonomen Schule Zürich zu stammen und schon dachte ich: „Ohje, die autonome Szene und ihre Sprache, antifaschistischer Imperativ, Basta-Bleibt-Rhetorik …“, las trotzdem rein und war überrascht: Da arbeitete einer mit der Sprache, da spann einer ungewöhnliche Gedanken, da drückte einer diese ungewöhnlichen Gedanken ungewöhnlich gut aus, sagen wir ruhig: Da zeigte sich ein Denk- und Sprachvirtuose.

Dann wollte ich es doch genauer wissen, wer hinter den Initialen C. H. steckt. Eine Internetrecherche klärt schnell: Es ist Christian Hänggi, Philosoph und „Medien-Ökologe“. Und ich stieß auf seine Dissertation „Gastfreundschaft im Zeitalter der medialen Repräsentation“, erschienen im Passagen-Verlag. Dort arbeitet er die Gedanken aus den „Vorträgen“ ausführlich aus.
Hänggi beschreibt die Informationsgesellschaft in ihrer unangenehmsten Ausprägung: der Werbung. Sie fällt uns im öffentlichen Raum an, erhebt den Anspruch, unser Blickfeld zu besetzen. Hänggi beschreibt den absurden Effekt, dass der ständig erhöhte Aufwand einer „Ökonomie des Exzesses“ die Wirksamkeit verringert, dass der abnehmenden Wirkung mit einer weiter zunehmenden Verbreitung von Werbebotschaften begegnet wird und führt die nicht weniger absurde Tatsache an, dass ad-busting juristisch als Verletzung der Eigentumsrechte gewertet wird, während die werbende Wirtschaft mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung sich in unsere Wahrnehmung, in unser Leben eindrängt.
Man muss schnell denken, denn Hänggis Sprünge von Thema zu Thema wirken manchmal willkürlich. Sie kommen wieder zusammen, warmherzig und freundlich, mit Empathie und einem mutigen Enthusiasmus. So geht er das Problem über solch scheinbar altmodische Begriffe wie die der Gabe und der Gastfreundschaft an:
„Unser Geist beherbergt viele Botschaften, doch im Zeitalter der zahllos produzierten und reproduzierten Informationen ist nicht Raum für alle da. Wie müssen diese Botschaften beschaffen sein, damit sie unser Gastrecht verdienen? Wann müssen wir es ihnen wieder entziehen?“
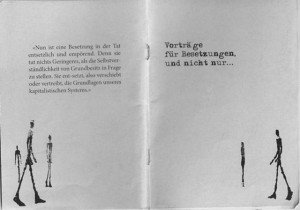 Hänggi selbst macht mit seinen Gedanken und mit seiner Broschüre klar: Die Geste ist das entscheidende! Hier drängt sich eine Wirtschaftsmacht mit Führungsanspruch auf, dort stellt ein freier Geist seine Gedanken zur freien Verfügung für frei entscheidende Geister. Und als ich nach der Lektüre der Dissertation die Broschüre noch einmal in die Hand nehme, spricht deren entschieden politischer Gestus zu mir: mit Hänggis Aufruf, gelegentlich die Gelassenheit hinter sich zu lassen, das Geformt-Werden durch einseitige Flexibilität nicht zu akzeptieren, diese Niederlage nicht hinzunehmen.
Hänggi selbst macht mit seinen Gedanken und mit seiner Broschüre klar: Die Geste ist das entscheidende! Hier drängt sich eine Wirtschaftsmacht mit Führungsanspruch auf, dort stellt ein freier Geist seine Gedanken zur freien Verfügung für frei entscheidende Geister. Und als ich nach der Lektüre der Dissertation die Broschüre noch einmal in die Hand nehme, spricht deren entschieden politischer Gestus zu mir: mit Hänggis Aufruf, gelegentlich die Gelassenheit hinter sich zu lassen, das Geformt-Werden durch einseitige Flexibilität nicht zu akzeptieren, diese Niederlage nicht hinzunehmen.
Ich setze die Broschüre wieder frei, in einem Bus der Linie 34, als Gabe für den freien Geist, der ihr Gastfreundschaft gewähren will.
Peter Metz
Links zu weiteren Texten von Christian Hänggi und zu im Artikel genannten Orten und Institutionen: