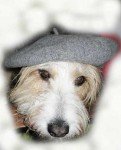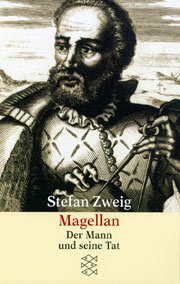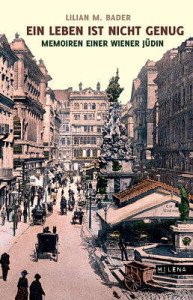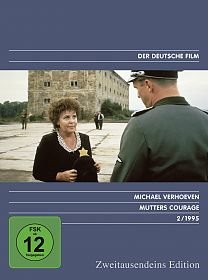Literaturquiz anlässlich 80 bzw. 75 Jahre Bücherverbrennung
Die Antworten auf das 7. literarische Rätsel des dreiundzwanzigteiligen Quizes
Diese Quizrunde war dem Gedenken an die Salzburger Bücherverbrennung von 1938 und dem dort lange Jahre lebenden Stefan Zweig gewidmet.
Neben dem Namen des Schriftstellers und dem Titel seiner Autobiographie wollten wir auch den Namen mindestens eines Autors wissen, den der Gesuchte in der Zeit der Imigration finanziell unterstützte.
Autor: Stefan Zweig (1881 – 1942)
Titel: Die Welt von Gestern
Zweig unterstützte beispielsweise: Joseph Roth (1894 – 1939), Ernst Weiss (1882 – 1940)
Erinnerung:
Wenn Sie an die jeweils aktuelle Quizrunde erinnert werden möchten, senden Sie bitte einfach ein leeres Mail mit dem Betreff „Literaturquiz Erinnerung“ an das Literaturblog Duftender Doppelpunkt.
Falls die Informationen, die wir für Sie über Stefan Zweig im „Duftenden Doppelpunkt“ zusammengetragen haben, nicht ausreichen, sind Sie eingeladen, in folgenden Sites zu blättern:
Casa Stefan Zweig (Deutsch, Português, English, Français)
Kommentierte Linksammlung der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin
Alle bisherigen Fragen, Antworten und die das Quiz begleitenden Beiträge finden Sie auf der Seite „Literaturquiz zur Bücherverbrennung 1933″.
Die nächsten Quizfragen stellen wir am Mittwoch, dem 08. Mai 2013. Zu deren Beantwortung haben Sie bis Dienstag, dem 21. Mai 2013 um 12:00 Uhr Zeit.
Die Preise und ihre GewinnerInnen
Stefan Zweig: Schachnovelle aus dem Fischer Taschenbuch Verlag und Königs Erläuterungen: Textanalyse und Interpretation zu Stefan Zweig Schachnovelle aus dem Bange Verlag geht an Herrn Joachim K.
 „Das Unwahrscheinliche hatte sich ereignet, der Weltmeister, der Champion zahlloser Turniere hatte die Fahne gestrichen vor einem Unbekannten, einem Manne, der zwanzig oder fünfundzwanzig Jahre kein Schachbrett angerührt. Unser Freund, der Anonymus, der Ignotus, hatte den stärksten Schachspieler der Erde in offenem Kampfe besiegt!“
„Das Unwahrscheinliche hatte sich ereignet, der Weltmeister, der Champion zahlloser Turniere hatte die Fahne gestrichen vor einem Unbekannten, einem Manne, der zwanzig oder fünfundzwanzig Jahre kein Schachbrett angerührt. Unser Freund, der Anonymus, der Ignotus, hatte den stärksten Schachspieler der Erde in offenem Kampfe besiegt!“
Das Erstaunen ist groß, als der unscheinbare Dr. B., österreichischer Emigrant auf einem Passagierdampfer von New York nach Buenos Aires, eher zufällig gegen den amtierenden Schachweltmeister Mirko Czentovic antritt und seinen mechanisch routinierten Gegner mit verspielter Leichtigkeit besiegt. Doch das Schachspiel fördert Erinnerungen an den Terror seiner Inhaftierung im Nationalsozialismus zutage und reißt eine seelische Wunde wieder auf, die erneut Dr. B.s geistige Gesundheit bedroht.
Via Fischer Tachenbuch Verlag
 159 Bände umfasst die Reihe Königs Erläuterungen und Materialien, von antiken über klassische bis hin zu zeitgenössischen modernen Werken, allesamt wichtige Schullektüren und Schlüsselwerke. Königs Erläuterungen bieten Band für Band verlässliche Lernhilfen für Schüler und weiterführende Informationsquellen für Lehrer und andere Interessierte, sie sind verständlich und prägnant geschrieben (…) Schematische Darstellungen, Hinweise in Textkästchen am Rand der Erläuterungen und in Kopf- und Fussleisten ermöglichen eine schnelle Orientierung.
159 Bände umfasst die Reihe Königs Erläuterungen und Materialien, von antiken über klassische bis hin zu zeitgenössischen modernen Werken, allesamt wichtige Schullektüren und Schlüsselwerke. Königs Erläuterungen bieten Band für Band verlässliche Lernhilfen für Schüler und weiterführende Informationsquellen für Lehrer und andere Interessierte, sie sind verständlich und prägnant geschrieben (…) Schematische Darstellungen, Hinweise in Textkästchen am Rand der Erläuterungen und in Kopf- und Fussleisten ermöglichen eine schnelle Orientierung.
Via Bange Verlag
Stefan Zweig: Magellan aus dem Fischer Taschenbuch Verlag geht an Frau Alexandra E.
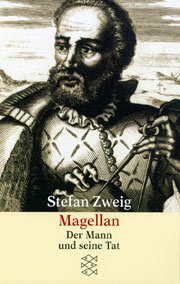 „Es ist ein Buch für Männer, es ist ein Werk für junge Menschen… Es gibt Mut“, urteilte Ernst Weiß 1938. Die Begeisterung, die Stefan Zweig für den größten Entdecker an der Schwelle der Neuzeit empfand, den Portugiesen Fernao de Magelhaes, „Magellan, wie die Geschichte ihn nennt“, wirkt unverändert fort. Magellans Mut, gegen die scheinbar unverrückbare Grundüberzeugung seiner Zeit, gegen das Dogma des ptolemäischen Weltbildes aufzustehen und es durch die wagemutige Tat, die erste Weltumsegelung der Geschichte, zu widerlegen, forderte Stefan Zweig wiederum zu einer biographie romancée heraus: es ging ihm auch hier darum, die Tat dieses außerordentlich kühnen Menschen aus seiner Persönlichkeit und seinem Charakter heraus zu verstehen und verständlich zu machen. Er selbst war überrascht, wie sehr in diesem Leben Traum und Wirklichkeit verschwistert waren, „denn ich hatte ununterbrochen das merkwürdige Gefühl, etwas Erfundenes zu erzählen, einen der großen Wunschträume, eines der heiligen Märchen der Menschheit“.
„Es ist ein Buch für Männer, es ist ein Werk für junge Menschen… Es gibt Mut“, urteilte Ernst Weiß 1938. Die Begeisterung, die Stefan Zweig für den größten Entdecker an der Schwelle der Neuzeit empfand, den Portugiesen Fernao de Magelhaes, „Magellan, wie die Geschichte ihn nennt“, wirkt unverändert fort. Magellans Mut, gegen die scheinbar unverrückbare Grundüberzeugung seiner Zeit, gegen das Dogma des ptolemäischen Weltbildes aufzustehen und es durch die wagemutige Tat, die erste Weltumsegelung der Geschichte, zu widerlegen, forderte Stefan Zweig wiederum zu einer biographie romancée heraus: es ging ihm auch hier darum, die Tat dieses außerordentlich kühnen Menschen aus seiner Persönlichkeit und seinem Charakter heraus zu verstehen und verständlich zu machen. Er selbst war überrascht, wie sehr in diesem Leben Traum und Wirklichkeit verschwistert waren, „denn ich hatte ununterbrochen das merkwürdige Gefühl, etwas Erfundenes zu erzählen, einen der großen Wunschträume, eines der heiligen Märchen der Menschheit“.
Via Fischer Tachenbuch Verlag
Lilian M. Bader: Ein Leben ist nicht genug. Memoiren einer Wiener Jüdin aus dem Milena Verlag geht an Frau Gudrun F.
Autobiografische Erinnerungen an eine verlorene Welt zwischen dem Alsergrund in Wien und New York. Ein historisch hochinteressanter Fund aus dem Archiv des New Yorker Leo-Baeck-Instituts.
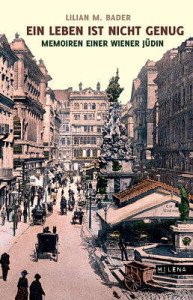 Ein Leben zwischen Anpassung und Selbstbestimmung, zwischen Assimilation und Flucht. Die Memoiren zeichnen sich durch viele köstliche Anekdoten und den scharfen Blick Baders aus, der in vielen Details erkennen lässt, dass für sie das Private nie von der aktuellen Politik zu trennen war.
Ein Leben zwischen Anpassung und Selbstbestimmung, zwischen Assimilation und Flucht. Die Memoiren zeichnen sich durch viele köstliche Anekdoten und den scharfen Blick Baders aus, der in vielen Details erkennen lässt, dass für sie das Private nie von der aktuellen Politik zu trennen war.
Wien im Fin de siècle. Lilian Bader, geborene Stern, wächst in behütet bürgerlichen Verhältnissen auf, wenngleich das nach außen aufrechterhaltene Bild nicht der familiären Realität entspricht. Es sind die letzten Jahre der Donaumonarchie, die Bader, neben der ständigen Abwesenheit des Vaters, prägen: das bunte Treiben in der kaiserlichen Residenzstadt, der Tod der Kaiserin; das künstlerische Wien, das nicht zuletzt aufgrund der Arbeit ihrer Mutter als Klavierlehrerin und des musikalischen Talents ihrer Schwester an Bedeutung gewinnt.
Lilian Bader, die mit ihrer Familie 1938 zur Emigration gezwungen wird, erzählt auf beeindruckend analytische Weise von ihren Studienjahren als eine der ersten Chemiestudentinnen in Wien, dem zunehmenden Antisemitismus, der jungen 1. Republik, dem Dollfuß-Attentat, den Jahren des Austrofaschismus und der familieneigenen „Stern’schen Schule“, einer bekannten Mädchenschule, die von Bader nach dem Tod der Mutter geleitet wurde und die nach der erfolgten Arisierung in der Nazizeit, als Exempel für die Restituierungspolitik in der 2. Republik, verstanden werden kann.
Via Milena Verlag
Der Himmel ist blau. Kann sein. Frauen im Widerstand. Österreich 1938 – 1945 aus dem Promedia Verlag geht an Frau Dagmar W.
 „Oft dokumentiert, in Zeitschriftenserien gefeiert wird der Widerstand der großbürgerlichen und adeligen Generäle gegen das Nazi – Regime. Doch in diesem menschen- wie frauenverachtenden System , das die Frauen auf das Gebären von Kanonenfutter und liebevolle Krankenschwesterndienste an den im Feld stehenden Männern, später auch auf die Produktion von Kriegsmaterial, festgelegt hat, entstand ein machtvolles Potential von Freiheitskämpferinnen, im Dienste nicht nur der Zerschlagung des Naziterrors, sondern auch ihrer eigenen politischen wie menschlichen Emanzipation.
„Oft dokumentiert, in Zeitschriftenserien gefeiert wird der Widerstand der großbürgerlichen und adeligen Generäle gegen das Nazi – Regime. Doch in diesem menschen- wie frauenverachtenden System , das die Frauen auf das Gebären von Kanonenfutter und liebevolle Krankenschwesterndienste an den im Feld stehenden Männern, später auch auf die Produktion von Kriegsmaterial, festgelegt hat, entstand ein machtvolles Potential von Freiheitskämpferinnen, im Dienste nicht nur der Zerschlagung des Naziterrors, sondern auch ihrer eigenen politischen wie menschlichen Emanzipation.
Ein ungemein wichtiges, längst schon überfälliges Buch über weibliche Menschen, die unseren ganzen nationalen und patriotischen Stolz ausmachen müssen“ Elfriede Jelinek
Via Promedia Verlag
Der Film Mutters Courage von Michael Verhoeven aus der Zweitausendeins Edition geht an Liselotte J.
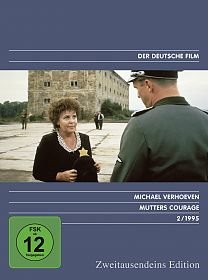 Die besetzte Stadt Budapest im Jahre 1944. George Taboris Mutter Elsa wird auf der Straße verhaftet und zum Westbahnhof gebracht, wo etwa viertausend Juden zur Deportation zusammengetrieben werden. Man transportiert sie zunächst in einen kleinen Ort an der Grenze, wo sie in einem Lagerhaus auf ihre Weiterfahrt in ein Vernichtungslager warten. Elsa Tabori fasst sich ein Herz und spricht den verantwortlichen SS-Offizier an. Kriegsfilm mit George Tabori, Pauline Collins, Ulrich Tukur, Natalie Morse u.a. Regie: Michael Verhoeven. Extras: Interviews mit Michael Verhoeven und George Tabori, Making of, Geschnittene Szenen, Filmdokumentation „Tabori – Theater ist Leben“, Kurzfilm „Frau Goldmann und der liebe Herrgott“, Biografie Michael Verhoeven, Fotogalerie, Trailer.
Die besetzte Stadt Budapest im Jahre 1944. George Taboris Mutter Elsa wird auf der Straße verhaftet und zum Westbahnhof gebracht, wo etwa viertausend Juden zur Deportation zusammengetrieben werden. Man transportiert sie zunächst in einen kleinen Ort an der Grenze, wo sie in einem Lagerhaus auf ihre Weiterfahrt in ein Vernichtungslager warten. Elsa Tabori fasst sich ein Herz und spricht den verantwortlichen SS-Offizier an. Kriegsfilm mit George Tabori, Pauline Collins, Ulrich Tukur, Natalie Morse u.a. Regie: Michael Verhoeven. Extras: Interviews mit Michael Verhoeven und George Tabori, Making of, Geschnittene Szenen, Filmdokumentation „Tabori – Theater ist Leben“, Kurzfilm „Frau Goldmann und der liebe Herrgott“, Biografie Michael Verhoeven, Fotogalerie, Trailer.
Via Zweitausendeins