Winterspaß in Slapsefjell
Donnerstag, 29. September 2016Wimmelnde SchifahrerInnen
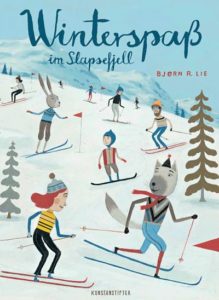
Jetzt schon vom Winter erzählen? Warum auch nicht? Der Winter kommt so oder so.
Weshalb sich nicht frühzeitig darauf einstimmen? Zum Beispiel mit Bjørn R. Lies hinreißend illustriertem, großformatigen „Winterspaß“. Der norwegische Illustrator und Künstler, dessen Arbeiten sich unter anderem in der New York Times, auf Pölstern oder Flaschenetiketten finden, lässt ebendiesen in dem fiktiven norwegischen Bergdorf Slapsefjell bei exakt minus vier Grad beginnen. Bunte Häuser im Schnee, aus deren Schornsteinen der Rauch schnurrgerade aufsteigt – die minus vier Grad werden bereits beim Anschauen des ersten Bildes spürbar. Gerade die richtige Temperatur für die EinwohnerInnen von Slapsefjell, die sich frühmorgens zahlreich auf den Loipen tummeln. Auf den folgenden Seiten wird man ZeugIn, wie „hartgesottene Skikanonen“ und „übermütige Winterakrobaten“ den Hang hinunter schießen oder mit „halsbrecherischen Sprüngen“ das Schicksal herausfordern. Oder man beobachtet Robert Raubart dabei, wie er aus einem ins Eis gebohrten Loch Fische angelt. Einer der Höhepunkte ist die Slapsefjell-Rallye, die „pferdestarken Motoren dröhnen“, deren Kadunk Kadunk, Vroom Vroom und Brrrrrr das Buch erzittern lassen. Derweil draußen Resi Rosenkohl auf dem Snublekollen-Sprunghügel einen Rekord aufstellt, sitzt eine Seite weiter geblättert drinnen die Klasse 8A und lässt den Wettlauf zum Südpol über sich ergehen, was zumindest einem Schüler, nämlich Sönke Bergmann einige Bilder später, sehr zupasskommt …
Im letzten Drittel des Buches senkt sich die Abenddämmerung über Slapsefjell, und dann geht’s richtig los: Unter anderem geben sich dort ein Quetschkommodenspieler und ein dreiköpfiger Vogel die Ehre.
Richtig los geht’s auch, wenn man Bjørn R. Lies witzige, skurrile, detailreiche, bunte Illustrationen genau anschaut – und ja, es werden Erinnerungen an Ali Mitgutschs Wimmelbilder lebendig. Der Farbton ist auf die jeweilige Szene bzw. die Tageszeit „zugeschnitten“. Besonders eindrucksvoll ist die Abenddämmerung, wo das Dorf in einen Rosa-Blau-Ton getaucht wird, wie es ihn nur im Winter gibt.
Die BewohnerInnen von Slapsfjell sind einmalig und vielfältig, und das nicht nur hinsichtlich ihrer Aktivitäten in klirrender Kälte. Menschen wie Hasen, Elefanten, Hunde, Bären, Biber, Eichhönrchen, alle wieseln sie gemeinsam mit der größten Selbstverständlichkeit auf Loipen, in Schihütten oder vor Lasse’s (sic) Grillbar herum. Ein besonderer Charme wohnt jener Szene inne, in der drei Damen (Häsin, Katze, Frau) ihren Kindern dabei zusehen, wie diese einen Schneehasen bauen.
Alle tragen Winterkleidung, die in einem krassen Widerspruch zu Hightech Outdoor-Ausstattung steht: Faltenröcke, Kniebundhosen, Wollpullover. Der oben erwähnte Roland Raubart, seines Zeichens übrigens eine Art Riesenschnauzer, trägt unter dem Pullover mit Norwegermuster! Hemd und Krawatte. Und allseits beliebt: die Sturmhaube. Sieht zwar nicht cool aus, wärmt jedoch ungemein. Genauso wie Slapsefjell und seine liebenswerten EinwohnerInnen Herz und Seele der BetrachterInnen wärmen.
Klingt alles nach Lobeshymne? Warum auch nicht. Der Winter kommt so oder so. Weshalb sich nicht darauf einstimmen?
Petra Öllinger
PS: Für alle, die ihn vielleicht vermisst haben: den Blick auf das Vor- und Nachsatzpapier. Ich habe nicht darauf vergessen, wollte die Anmerkung dazu aber zur Abwechslung als PS verfassen. Auf dem Vor- und Nachsatzpapier findet sich (fast) alles auf blauem Untergrund mit weißem Stift gezeichnet, was für den Wintersport benötigt wird. Schneeschuhe, Schiwachs, Schokolade, Fäustlinge Radio, Wollknäuel …
PPS: Nein, es gibt keine Altersempfehlung. Geeignet ist „Winterspaß in Slapsefjell“ für Groß und Klein, für Jung und Alt, für Menschen und Bären, für Schifahrer und Waldarbeiterinnen und so weiter.
Bjørn R. Lie: Winterspaß in Slapsefjell.
Aus dem Norwegischen von Maike Dörries.
Buchgestaltung von Eleonor Sommer.
Kunstanst!fter Verlag, Mannheim, 2016
Hardcover, 52 Seiten, € 19,60 (Ö)
Über Bjørn R. Lie
© Cover: Kunstanst!fter Verlag / Autor und Illustrator



 Im Oktober 2015 wird der Wiener Theaterintendant Valentin Karl tot, an einem Waggon des Riesenrades hängend, aufgefunden. Für Chefinspektorin Vera Rosen und den ihr aus München dienstzugeteilten Kommissar Moritz Ritter beginnt eine delikate Spurensuche durch Theaterwerkstätten, Kaffeehäuser und vornehme Villen im Pratercottage.
Im Oktober 2015 wird der Wiener Theaterintendant Valentin Karl tot, an einem Waggon des Riesenrades hängend, aufgefunden. Für Chefinspektorin Vera Rosen und den ihr aus München dienstzugeteilten Kommissar Moritz Ritter beginnt eine delikate Spurensuche durch Theaterwerkstätten, Kaffeehäuser und vornehme Villen im Pratercottage. 1. März 1939: „Ich musste zum rumänischen Wehrdienst in Elisabethstadt einrücken.“
1. März 1939: „Ich musste zum rumänischen Wehrdienst in Elisabethstadt einrücken.“ 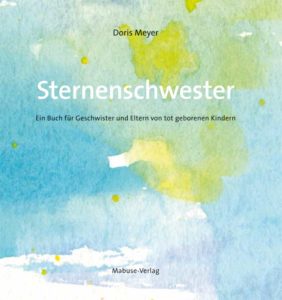 Es gibt sie noch, die letzten Tabus in unserer Gesellschaft, zum Beispiel jenes von tot geborenen oder früh verstorbenen Babys. „Hunderte Fotos von lebenden Kindern machen die Runde, stolze Eltern posten Familienfotos auf Facebook, Familie und FreundInnen gratulieren, bringen kleine Geschenke. Tot geborene oder sehr früh verstorbene Babys hingegen werden meist nicht als Teil einer Familie wahrgenommen.“ 1 Und doch sind sie es. Umso mehr, wenn nach dem Tod eines Kindes dessen Geschwister zur Welt kommen. Wie lebt es sich als ein solches Geschwisterkind in dem Wissen, dass vor einer/einem bereits jemand da war und nun nicht mehr ist? Darf man überhaupt über die tote Schwester, den toten Bruder sprechen? Wie gelingt es als Mutter/Vater, eine Verbindung zwischen dem verstorbenen und dem lebenden Kind aufzubauen? Wäre ein Schweigen über einen „solchen Vorfall“ nicht einfacher, heilsamer? Möglich. Wahrscheinlicher ist: „Totschweigen ist wie noch einmal sterben“, wie Gabi Horak-Böck in ihrem Artikel „Sternenkinder“ schreibt.
Es gibt sie noch, die letzten Tabus in unserer Gesellschaft, zum Beispiel jenes von tot geborenen oder früh verstorbenen Babys. „Hunderte Fotos von lebenden Kindern machen die Runde, stolze Eltern posten Familienfotos auf Facebook, Familie und FreundInnen gratulieren, bringen kleine Geschenke. Tot geborene oder sehr früh verstorbene Babys hingegen werden meist nicht als Teil einer Familie wahrgenommen.“ 1 Und doch sind sie es. Umso mehr, wenn nach dem Tod eines Kindes dessen Geschwister zur Welt kommen. Wie lebt es sich als ein solches Geschwisterkind in dem Wissen, dass vor einer/einem bereits jemand da war und nun nicht mehr ist? Darf man überhaupt über die tote Schwester, den toten Bruder sprechen? Wie gelingt es als Mutter/Vater, eine Verbindung zwischen dem verstorbenen und dem lebenden Kind aufzubauen? Wäre ein Schweigen über einen „solchen Vorfall“ nicht einfacher, heilsamer? Möglich. Wahrscheinlicher ist: „Totschweigen ist wie noch einmal sterben“, wie Gabi Horak-Böck in ihrem Artikel „Sternenkinder“ schreibt.