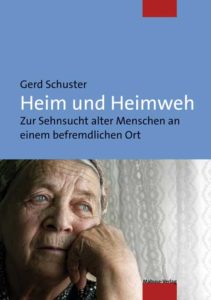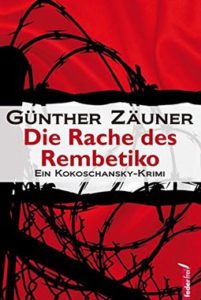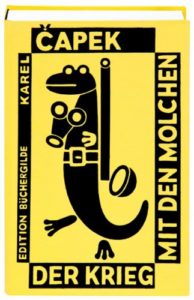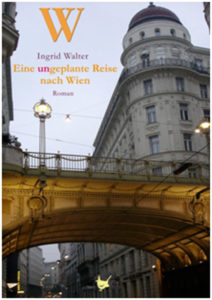Schweizer Krankheit – eine Annäherung
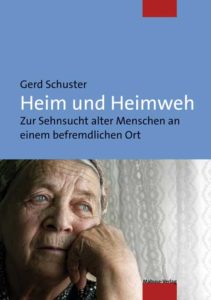 „Keinen dieser Menschen mit ihren großen Geschichten zwischen Heimat und Heimweh werde ich vergessen. Sie alle sind Teil meiner eigenen Geschichte geworden, die sich in einem eigentümlich gemeinsamen Muster fortspinnt, welches mir größer und klarer zu werden scheint.“
„Keinen dieser Menschen mit ihren großen Geschichten zwischen Heimat und Heimweh werde ich vergessen. Sie alle sind Teil meiner eigenen Geschichte geworden, die sich in einem eigentümlich gemeinsamen Muster fortspinnt, welches mir größer und klarer zu werden scheint.“
Der diese Zeilen formuliert, nimmt sich eines Themas an, das speziell in der Psychologie stiefmütterlich behandelt wird. Er widmet sich einer Gruppe von Menschen, die in Diskussionen, Medienberichten etc. viel zu oft auf lästige KostenverursacherInnen reduziert werden: Gerd Schuster, Diplom-Psychologe und Theologe, 15 Jahre in Leitungspositionen der Altenhilfe tätig und nun Mitarbeiter am FIBAD (Forschungsinstitut für Bildung, Altern und Demografie) in Bamberg.
Die Grundlage des vorliegendes Bandes „Heim und Heimweh“ bildet Schusters Dissertation mit dem Titel „Heimweh im Pflegeheim – eine qualitativ-heuristische Annäherung“, die er 2013 an der Tiroler Landesuniversität in Hall/Tirol vorlegte. Forschungs“gegenstand“ ist die emotionale Befindlichkeit von alten Menschen in Pflegeheimen.
Heimweh – eine Herausforderung
Gerd Schuster zeigt mit seiner Untersuchung u.a. die begriffliche Komplexität, die dem (scheinbar) einfachen Begriff Heimweh innewohnt. Heimweh, Nostalgie, Sehnsucht – umgangssprachlich in einen Topf geworfen – werden genau analysiert. Was auf den ersten Blick nach Kleinlichkeit aussehen mag, zeigt die Notwendigkeit, mit wissenschaftlich sauber ausdifferenzierten Begriffen zu arbeiten. Gerd Schuster tut dies auf sehr anschauliche und auch für Laien nachvollziehbare Weise und man erfährt, dass Heimwehforschung bereits im 17. Jahrhundert stattgefunden hat. So beschrieb der Schweizer Arzt Johannes Hofer 1688 in seiner Doktorarbeit „Dissertatio medica De Nostalgia, Oder Heimwehe“ die mit Heimweh einhergehenden Symptome.
Und was ist Alter überhaupt? Jedenfalls keine banale Frage, die mit banalen Erklärungen zu beantworten ist, wie Schuster anhand der unterschiedlichen Altersmodelle und historischen Exkurse zum Begriff Alter zeigt.
Aufschlussreich ist die Methodenvielfalt, mit der die Untersuchung durchgeführt wurde: Tiefeninteriews, Problemzentrierte Interviews, Fotostudie, Dokumentenanalyse. Erhoben wurden die Daten in Pflegeheimen in Bayern, befragt wurden dere MitarbeiterInnen, BewohnerInnen sowie deren Angehörige.
Gerd Schuster gibt Einblick in die Qualitätskriterien einer qualitativen Forschung. Er lädt die LeserInnen ein zu einem kleinen Exkurs in die Heuristik als Entdeckungsverfahren und verweist auf die vier Grundregeln des deutschen Soziologen und Begründer der qualitativ-heuristischen Sozialforschung Gerhard Kleining: wissenschaftliches Arbeiten verstanden als Prozess, der u.a. auch in den Forschenden Änderungen hervorrufen kann und sie somit ein bisschen von ihrem vermeintlich unantastbaren und streng objektiven Thron schubst.
Keine einfachen Schlussfolgerungen
Dieser komplexe Studienaufbau erlaubt folglich keine einfachen „wenn-dann-Ergebnisse“. Exemplarisch sei hier erwähnt, dass bei vielen befragten BewohnerInnen das Gefühl, nicht aktiv in die Entscheidung zum Umzug ins Pflegeheim miteinbezogen gewesen zu sein, die Eingewöhnung in das neue Umfeld emotional erschwert. Sympathisch – auch wenn dieser Begriff in einer wissenschafltichen Arbeit streng genommen gar nichts verloren hat – ist die offene, kritische Sichtweise des Autors auf die eigene Arbeit sowohl in Bezug auf das Untersuchungsdesign als auch auf die Ergebenisse, die nur einen „skizzenhaften Überblick quasi in einer Momentaufnahme wiederzugeben vermögen“. Trotz dieser Limitationen finden sich wichtige Hinweise zur Implikation der Resultate in die Praxis, auch wenn diese, wie Schuster festhält, nicht völlig neu sind bzw. nicht explitzit aus den vorliegenden Daten abgeleitet werden können. Dazu zählen u.a. das Miteinbeziehen der alten Menschen in die Entscheidungsprozesse beim Umzug, Abschiedsrituale beim Wegziehen von Zuhause uvm.
Weitere Studien? Hoffentlich
„Heim und Heimweh“ ist ein brillantes Beispiel dafür, wissenschaftlich und gleichzeitig mit hoher Sprachästhetik zu formulieren. Wenn Gerd Schuster schreibt, dass nach Sichtung relevanten Forschungsmaterials klar wird, „dass eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Heimweh alter Menschen in Pflegeheimen weitestgehend noch nicht stattgefunden hat“, legt er mit „Heim und Heimweh“ ausgezeichnetes Material für weitere Untersuchungen vor. Die sind auch dringend notwendig, um das Bild der alten, lästigen KostenverursacherInnen revidieren zu helfen.
Petra Öllinger
Gerd Schuster: Heim und Heimweh. Zur Sehnsucht alter Menschen an einem befremdlichen Ort
Mabuse Verlag, Frankfurt/Main 2016
313 Seiten, € 44,20 (Ö)
© Cover: Mabuse Verlag