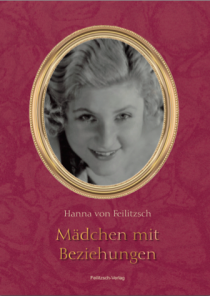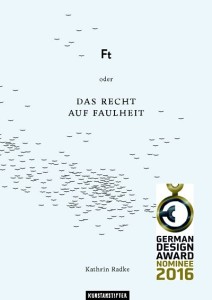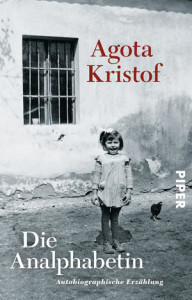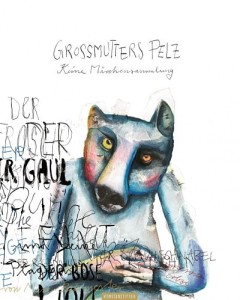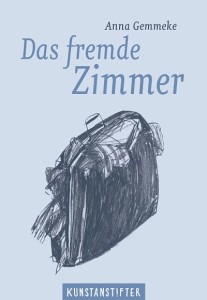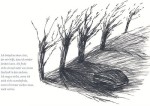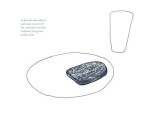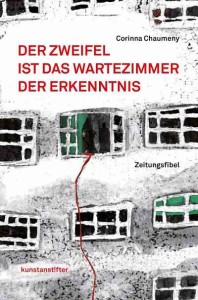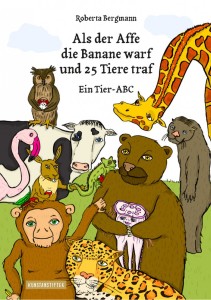Kompletter Neubeginn mit leerem Herzen
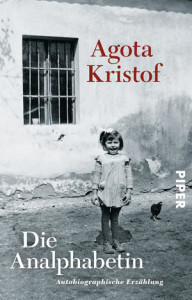 Was geht in Flüchtlingen vor, die gerade ganz neu in ein völlig fremdes Land eingereist sind, sich und ihren Kinder meist nur das blanke Leben gerettet haben? Aktueller und bewegender denn je liest sich dieser schmale autobiografische Erzählband der 2011 verstorbenen Ungarin Ágota Kristóf. Und es beschämt zugleich.
Was geht in Flüchtlingen vor, die gerade ganz neu in ein völlig fremdes Land eingereist sind, sich und ihren Kinder meist nur das blanke Leben gerettet haben? Aktueller und bewegender denn je liest sich dieser schmale autobiografische Erzählband der 2011 verstorbenen Ungarin Ágota Kristóf. Und es beschämt zugleich.
Ein Leben, das sich über weite Strecken wie ein Mahnmal der Geschichte liest. 1935 geboren, wächst Kristóf in Ungarn noch behütet auf. Der schmale Erzählband schildert in kurzen, fast ruppigen Sätzen und Absätzen Kristófs frühe Kindheit, ihre „Lesekrankheit“, ihre Gier alles zu lesen, was ihr in die Finger kam, die Querelen mit ihrem jüngeren Bruder und das Leben auf dem Land. Der Buchumschlag zeigt ein rund vierjähriges fröhlich lachendes Kind mit weißem Schleifchen im Haar vor einer heruntergekommenen Mauer stehend. Glückliche Tage, die schnell ein Ende finden sollen.
Der Schrecken beginnt für Kristóf, als der Vater, ein Lehrer, vom kommunistischen Regime verhaftet wird und sie unter Zwang wie viele Kinder und Jugendliche der damaligen Zeit in ein Internat eingeliefert wird. Nicht genug, die Muttersprache Ungarisch ist plötzlich zutiefst verpönt. Die ersten zwei Entwurzelungen sind vollbracht, die nachhaltig in Kristófs Seele zu brennen scheinen. Zutiefst anrührend lesen sich die Kapitel, in denen sie über das Schreiben spricht, das sie schon sehr bald für sich entdeckt hat. Im Internat wird ihr Tagebuch ein Überlebensmittel.
An einem bitterkalten Novemberabend flieht die einundzwanzigjährige Kristóf zusammen mit ihrer kleinen wenige Monate alten Tochter und ihrem Mann über die Grenze nach Österreich, weg vom Regime, das noch Jahrzehnte nach Stalins Tod Terror verbreiten wird.
Das neue Land ist alles und nichts von dem, was Kristóf sich wohl vorgestellt haben muss. Auch wenn die Familie gleich von Soldaten am Grenzzaun empfangen wird, begrüßen sie keine Aggressionen, keine bittere Armut. Straßenlaternen bleiben ihr im Gedächtnis, so etwas hatte sie noch nie zuvor gesehen. Als „displaced persons“ bekommen die Geflohenen gute Verpflegung und alle Hilfe, die nötig ist.
„Er [Anm.: ein Busschaffner] sagt, daß ich keine Angst mehr haben soll, daß ich jetzt in Sicherheit bin. Ich lächle, ich kann ihm nicht sagen, daß ich keine Angst vor den Russen habe, und wenn ich traurig bin, dann eher wegen der zu großen Sicherheit und weil ich nichts anderes tun und denken kann als Arbeit, Fabrik, Einkaufen, Waschen, Kochen und auf nichts anderes warten kann als auf die Sonntage, um ein bißchen länger zu schlafen und von meinem Land zu träumen.“
Kristóf bekommt ein Visum und reist weiter in die französischsprachige Schweiz, wo der gebildeten Frau trotz sofortigem Sprachunterricht nicht viel mehr bleibt als zunächst in einer Fabrik zu arbeiten. Diese Zeit war für Kristóf eine bittere, voll Einsamkeit und Frustration, und doch – sie hat auch eine große Kraft freigesetzt.
Kristófs Stil ist weder mitleiderregend, gefühlsheischend oder gar anbiedernd, doch zerreißt einem ihre Schilderung der zwei Taschen, die sie mitnimmt aus der Heimat, fast das Herz: eine Tasche für Kleidung, eine Tasche für Wörterbücher.
Wörterbücher werden auch im weiteren Leben der Autorin eine wichtige Rolle spielen. Sie zwingt sich selbst dazu, auf Französisch zu schreiben, verfasst kürzere Theaterstücke und einen Roman – zu ihren wichtigsten Werken zählen „Das große Heft“, „Der Beweis“ und „Die dritte Lüge“ – und findet darin eine neue Heimat.
Natascha Miljković
Ágota Kristóf: Die Analphabetin. Autobiographische Erzählung
Ammann Verlag, Zürich 2005.
Im Juli 2007 neu erschienen im Piper Verlag München (Print).
80 Seiten. €9,50 (Ö)
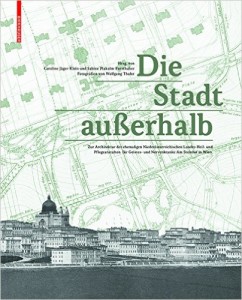 Das Buch ist ein Ergebnis der Aufarbeitung von vor einigen Jahren entdeckten Plänen, Fotografien und sonstigen Dokumenten aus der Entstehungszeit der Anlage, die an Instituten der TU-Wien unter Mitwirkung von Studierenden im Rahmen ihrer Ausbildung aufgearbeitet wurden. Es biete auf 379 Seiten eine Fülle von Informationen für ArchitektInnen ebenso wie für HistorikerInnen oder MedizinerInnen oder einfach für LiebhaberInnen dieses wunderbaren Ortes. Das Buch zeigt wie bis in kleinste Details die Bauten, die Anlagen, die Geräte entwickelt und individuell an den Ort und den Bedarf angepasst und trotzdem einheitlich gestaltet wurden. Es zeigt, dass vielfach völlig neue Wege gegangen wurden und die konstruktiven Lösungen zu den ersten ihrer Art gehören. Z. B. ist die Eisenbetondecke der Wäscherei mit ihren Oberlichten die erste ihrer Art mit einer so großen Spannweite (sie ist durch den geplanten Umbau zu Wohnungen in ihrem Bestand gefährdet).
Das Buch ist ein Ergebnis der Aufarbeitung von vor einigen Jahren entdeckten Plänen, Fotografien und sonstigen Dokumenten aus der Entstehungszeit der Anlage, die an Instituten der TU-Wien unter Mitwirkung von Studierenden im Rahmen ihrer Ausbildung aufgearbeitet wurden. Es biete auf 379 Seiten eine Fülle von Informationen für ArchitektInnen ebenso wie für HistorikerInnen oder MedizinerInnen oder einfach für LiebhaberInnen dieses wunderbaren Ortes. Das Buch zeigt wie bis in kleinste Details die Bauten, die Anlagen, die Geräte entwickelt und individuell an den Ort und den Bedarf angepasst und trotzdem einheitlich gestaltet wurden. Es zeigt, dass vielfach völlig neue Wege gegangen wurden und die konstruktiven Lösungen zu den ersten ihrer Art gehören. Z. B. ist die Eisenbetondecke der Wäscherei mit ihren Oberlichten die erste ihrer Art mit einer so großen Spannweite (sie ist durch den geplanten Umbau zu Wohnungen in ihrem Bestand gefährdet).