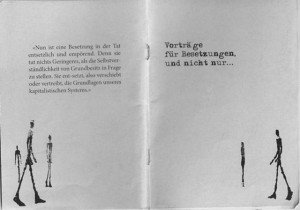Armin Baumgartner – Die Wucht des Banalen
Freitag, 8. Februar 2013Stamperl, Kredenz; und Karel Gott hängt neben Jesus
Gleich vorweg: Mit Wucht „kommen“ Armin Baumgartners Texte nicht „daher“; vielmehr schleichen sie sich auf leisen Sohlen heran. Und dann machen die Texte Halt in – vermeintlich – Banalem.
Armin Baumgartner ist ein genauer Beobachter von Begebenheiten; hält den Blick auf kleine Szenen, die sich sonst allzu oft dem Alltagsblick entziehen. Ein Schamotteziegel, aus dem „entsetzte Augen“ schauen und der an den Kohlenhändler erinnert, dessen Sohn sich erhängt hat; ein Ziegel, der an all die „versäumten Momente“ erinnert („Das Gesicht im Schamotteziegel“). Eine Bank am Wienerberg, eine Smart Export und Rudolf; ein Gespräch zwischen zwei Männern – nichts Spektakuläres, schon gar nichts Wuchtiges – und doch entsteht eine lebendige Szene, die lange im Gedächtnis haften bleiben wird („Dienstag“).
Einer der berührendsten Texte ist „Rattenfänger“. Armin Baumgarter, der als Techniker bei Film und Fernsehen war, breitet darin die Hintergrundarbeit für eine Tierdokumentation aus. „Es musste eine Entscheidung getroffen werden: Die Mutter wurde herausgenommen, mit einem leisen Knacks wurde ihr kurzerhand das Genick gebrochen, danach wurde der Kadaver wieder zu den Kleinen ins Nest gelegt.“
Der Tod hat oft einen leisen Auftritt. Ein Vogel fliegt gegen die Balkontüre („Der kleine Tod des Vogels“) . Eine alte Frau – in ihrer Wohnküche hängen an der Wand Karel Gott und Jesus – hinterlässt ein Rezept für Nusskipferl („Die langen grauen Haare“). Eine Katze verwest im Sarkophag mitten im Zimmer von O. W. Fischer. „Das Vergehen war zum ästhetischen Ereignis geworden, verstörend zwar, doch auch verzaubernd.“ („Fischer Katze“)
„Die Wucht des Banalen“ bietet auch Skurriles. Zum Beispiel eine erbensgroße Erhebung mitten auf der Stirn des Ich-Erzählers in „Die Talgdrüse“. Das erbsengroße Gewächs gedeiht zu einem veritablen Horn und wird von seinem Träger als Sonnenuhr eingesetzt. Die unangenehmen Folgen der Wucherung lassen jedoch nicht lange auf sich warten …
Einigen wenigen Texten hätte ein letzter sprachlicher und inhaltlicher Schliff gutgetan. Zum Beispiel steht die Mozartstatue in Wien nicht im Volksgarten.
Und es stellt sich die Frage: Warum gibt es kein Inhaltsverzeichnis im Buch?
Sehr erfreulich hingegen ist, dass wunderbare, altmodische Wörter in den Textminiaturen erhalten geblieben sind: Trottoir, Kaffeehäferl, Fleischhacker, Stamperl, Kredenz.
Petra Öllinger
Armin Baumgartner – Die Wucht des Banalen. kitab Verlag, Klagenfurt 2012.
126 Seiten. € 16,00 (A).