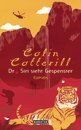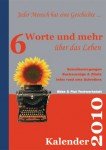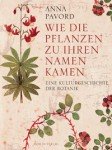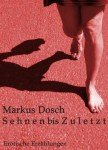Irene Ferchl (Hgin.): Auf einem Badesteg. Schriftstellerinnen am See
Samstag, 12. September 2009Mit Lesebändchen ans Gewässer
„Baden, Schwimmen, Spazieren oder Eislaufen und natürlich faul auf einem Badesteg liegen, was sonst kann man an einem See unternehmen?“
Diese Frage stellt Irene Ferchl in ihrem Vorwort von „Auf einem Badesteg. Schriftstellerinnen am See“. Man kann noch viel mehr an einem See unternehmen. Zum Beispiel in diesem Buch über Teiche, Seen, Flüsse, Meere lesen. Und über Menschen, deren Geschichten im Zusammenspiel mit dem Element Wasser handeln.
Die Kulturjournalistin und Herausgeberin von literaturblatt Irene Ferchl, selbst am Bodensee geboren, hat Prosa und Lyrik unterschiedlichster Autorinnen in acht nach Schwerpunkten geordneten Abschnitten versammelt. Zitate aus den jeweiligen Texten, und nicht „nüchterne“ Überschriften, übertiteln diese Abschnitte – ein poetischer Freiraum für die eigenen Gedanken. Ein kurzes Luftholen und dann ein Wieder-Eintauchen beispielsweise in Fanny Lewalds „Eine Winternacht am See“, Elisabeth Borchers „Später Nachmittag“, Virginia Woolfs „Die Faszination des Teichs“, Katharina Hagenas „Schwimmen ist Fliegen für Feiglinge“ oder in drei Gedichte von Elisabeth, Kaiserin von Österreich. Schwarz-Weiß-Fotos von Gewässern „aller Art“ vervollständigen das Bild eines wieder mit Hingabe gestalteten Buches – sowohl den Inhalt als auch die optische Aufbereitung betreffend.
Überhaupt die Buchgestaltung: An dieser Stelle muß auch einmal auf die Praktikabiliät der Aviva-Bücher hingewiesen werden. Da ist erstens das Lesebändchen! Alle jene, die ihrer als Lesezeichen verwendete Postkarten, Kassenzettel oder Kuverts schon mal in Uferböschungen, zwischen Badesteg-Planken oder durch „leichte“ Meeresbrisen verlustig geworden sind, werden dieses „Utensil“ schätzen. Da ist zweitens der Buchdeckel. Er hält Wasserspritzern und Sonnenölattacken stand und läuft nicht Gefahr, Eselsohren aufzustellen. Und jene, die sich nicht an und auf und in Gewässern tummeln können, sei versichert: Das Buch ersetzt auch einen Aufenthalt am See.
Petra Öllinger
Irene Ferchl (Hgin.) – Auf einem Badesteg. Schriftstellerinnen am See.
Aviva Verlag, Berlin, 2009. 192 Seiten, € 17,80 (D).
Bereich: Frauen – Literatur