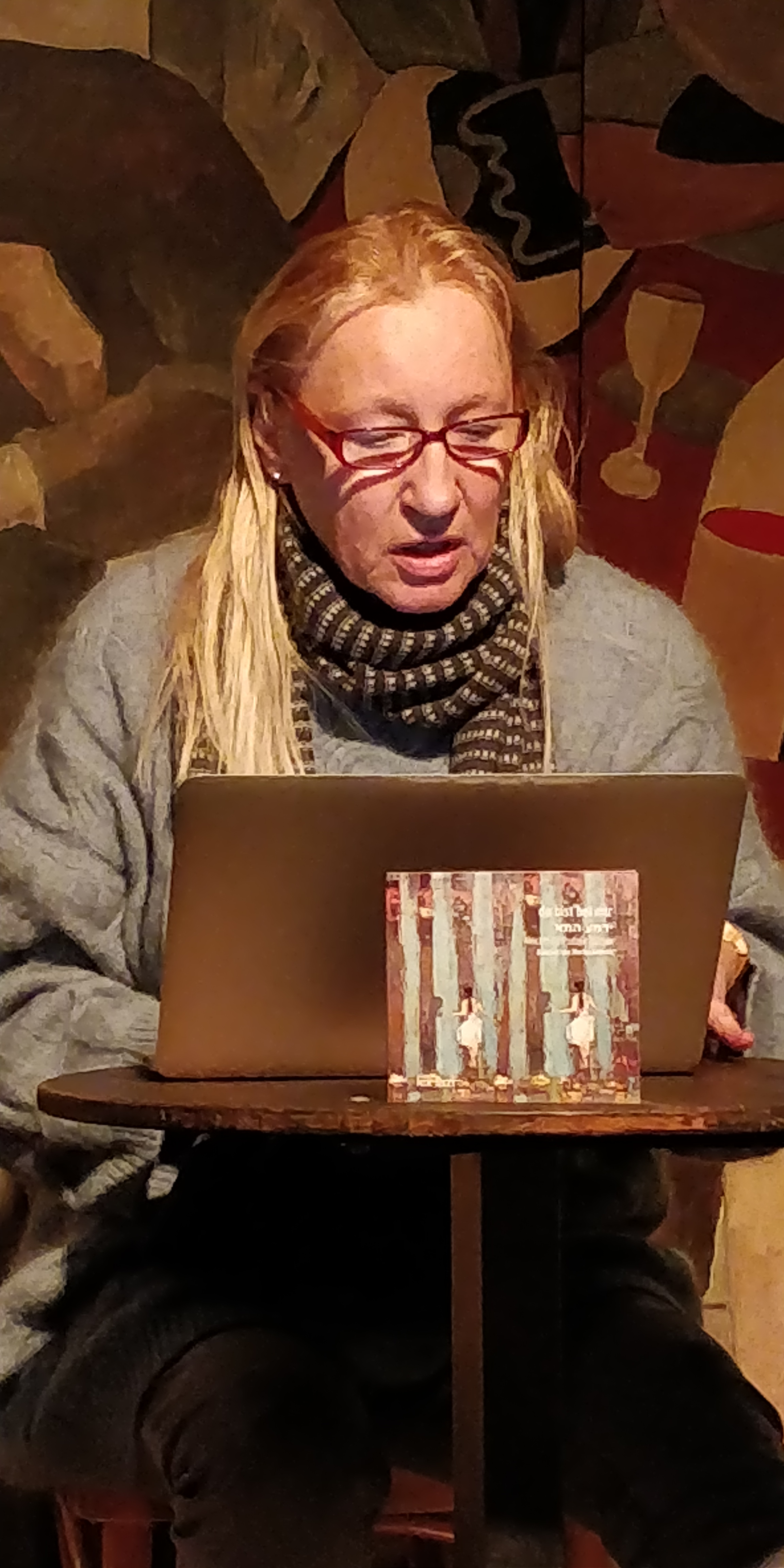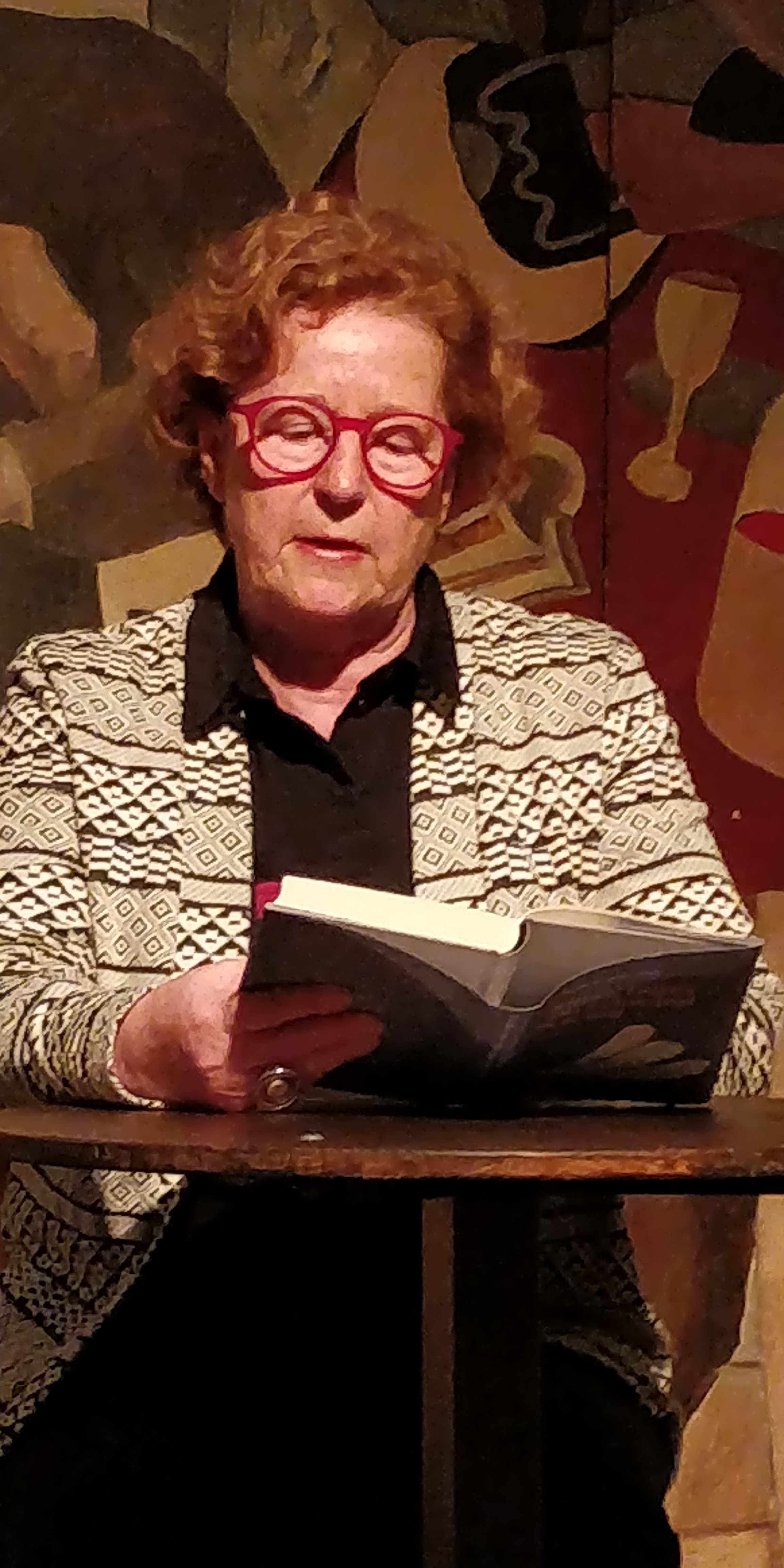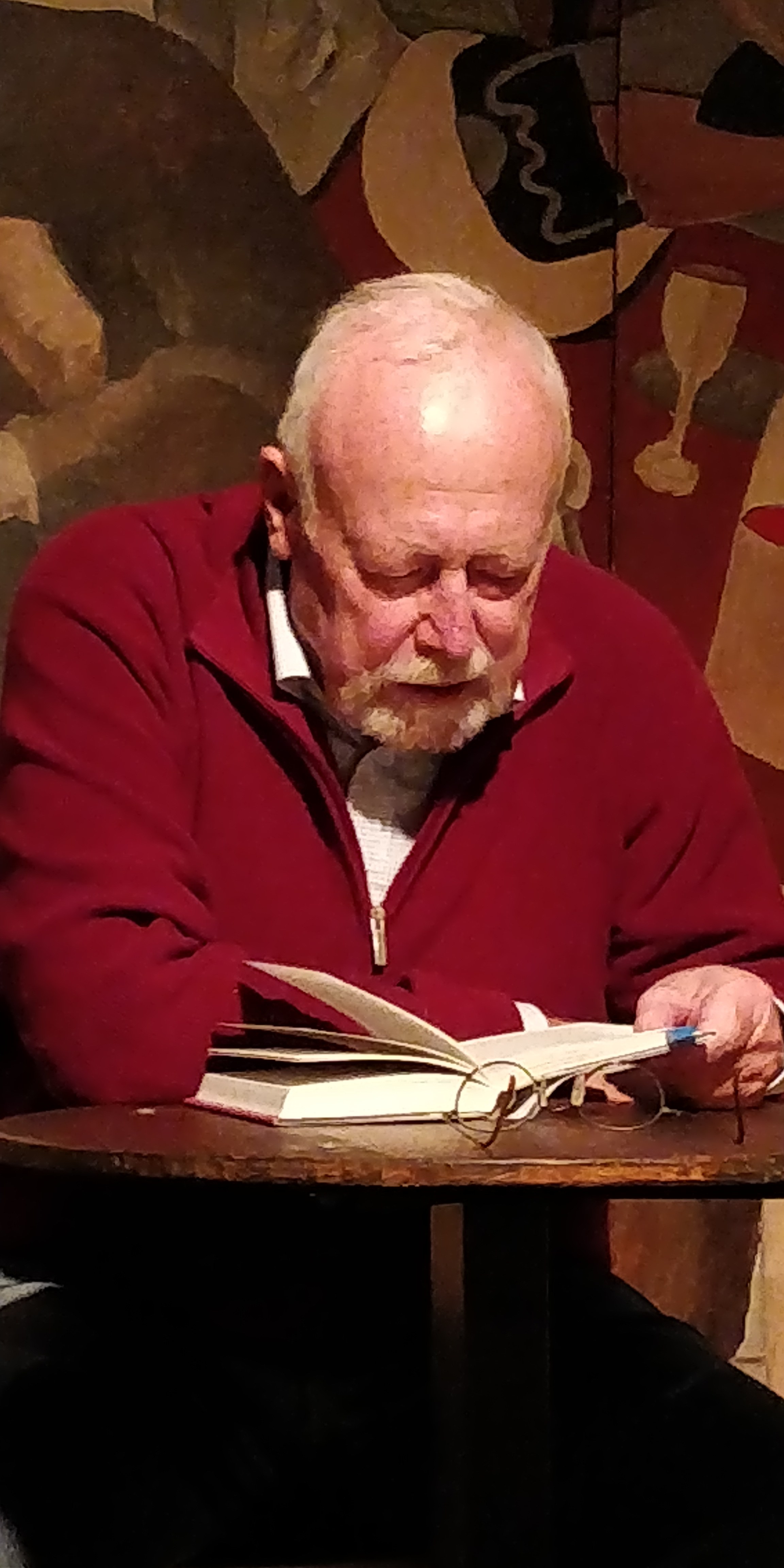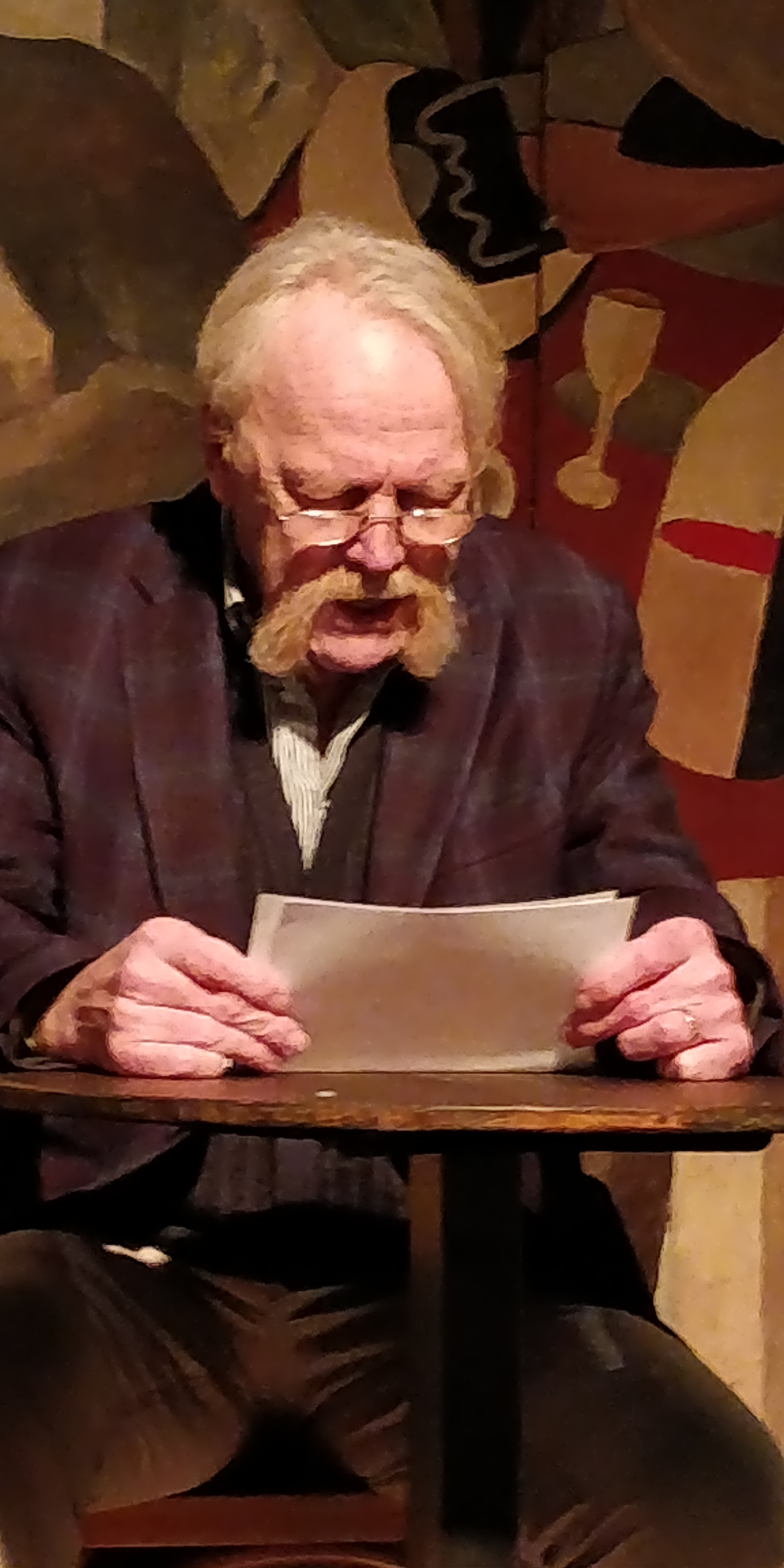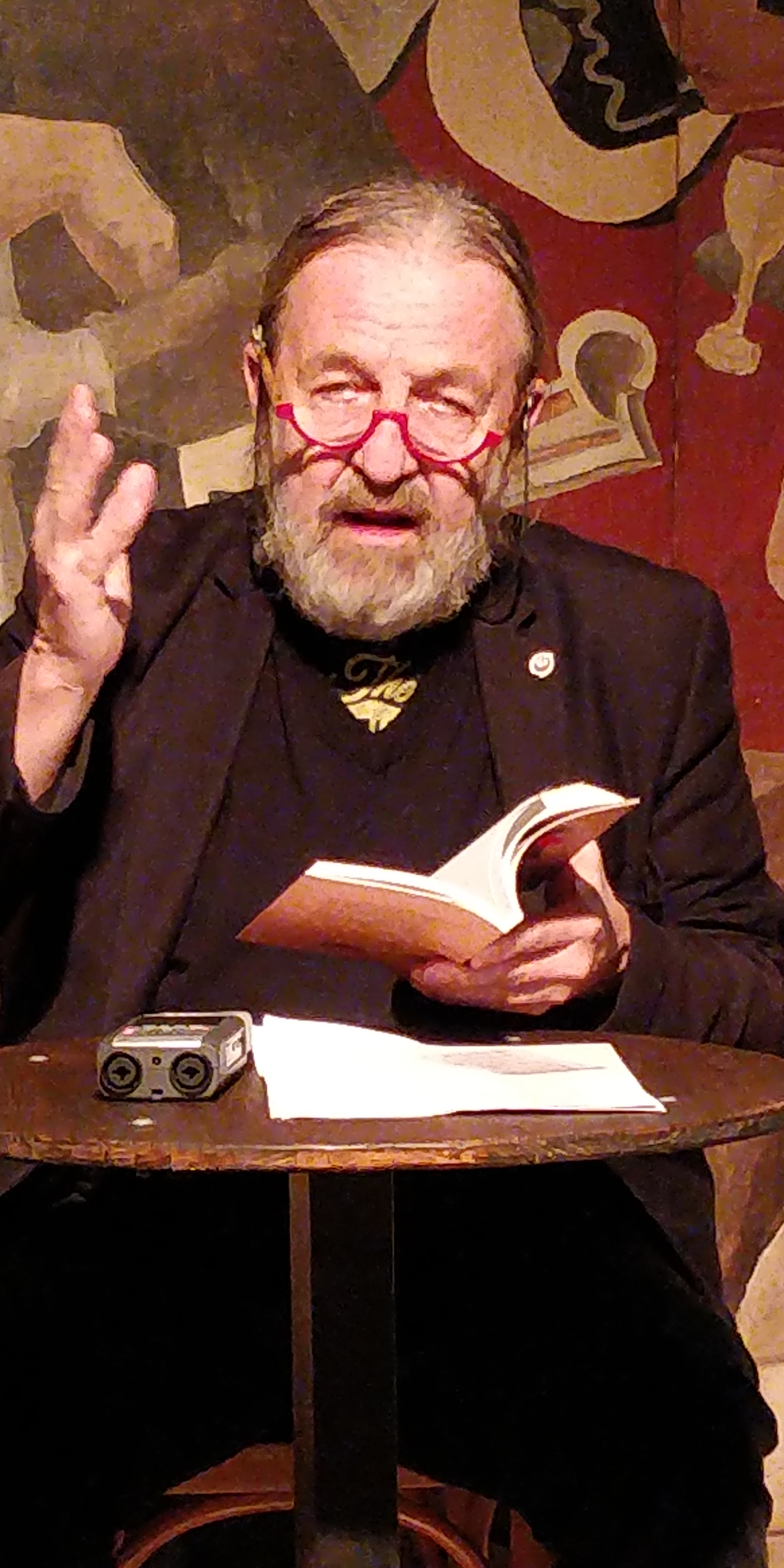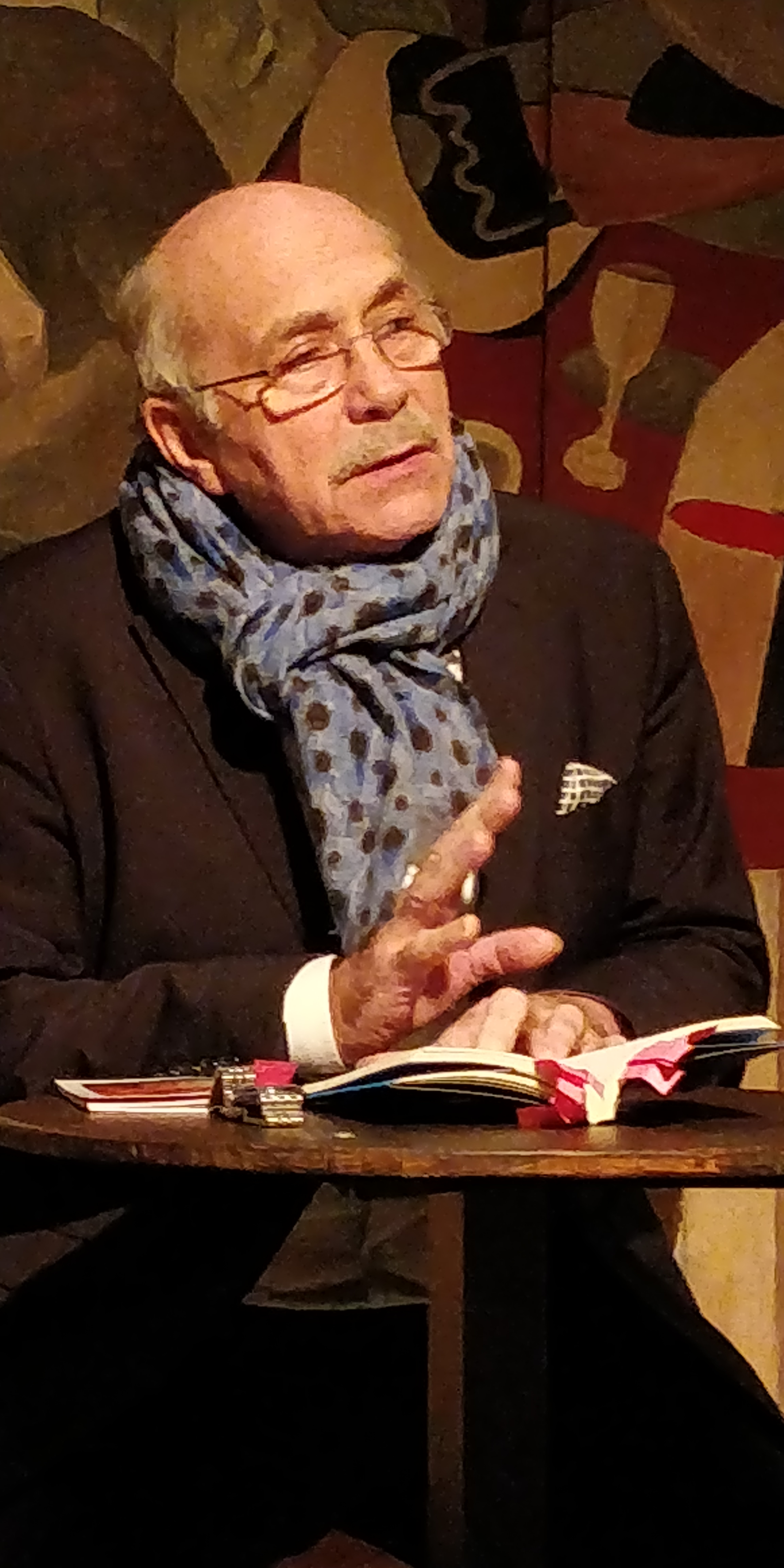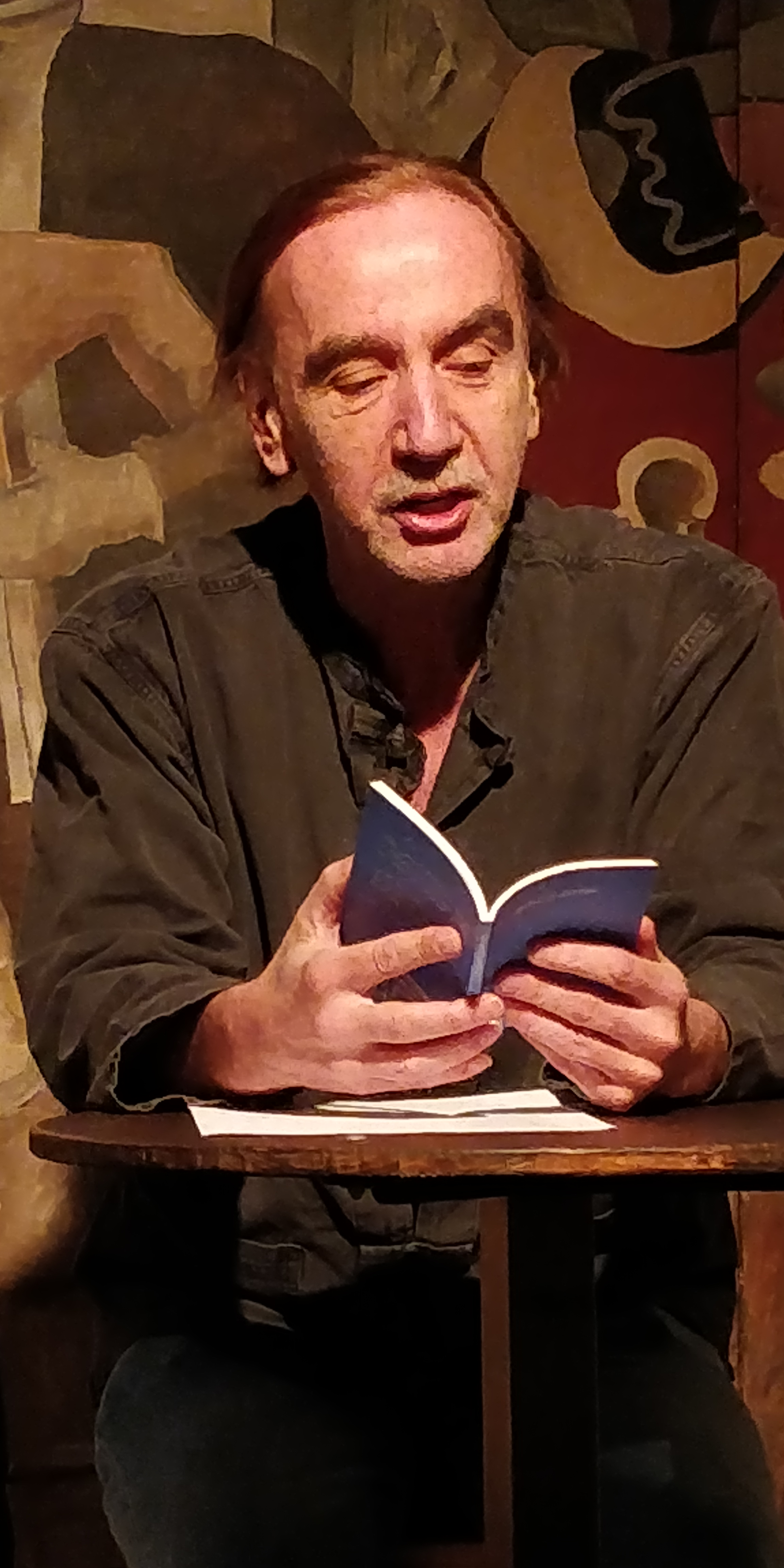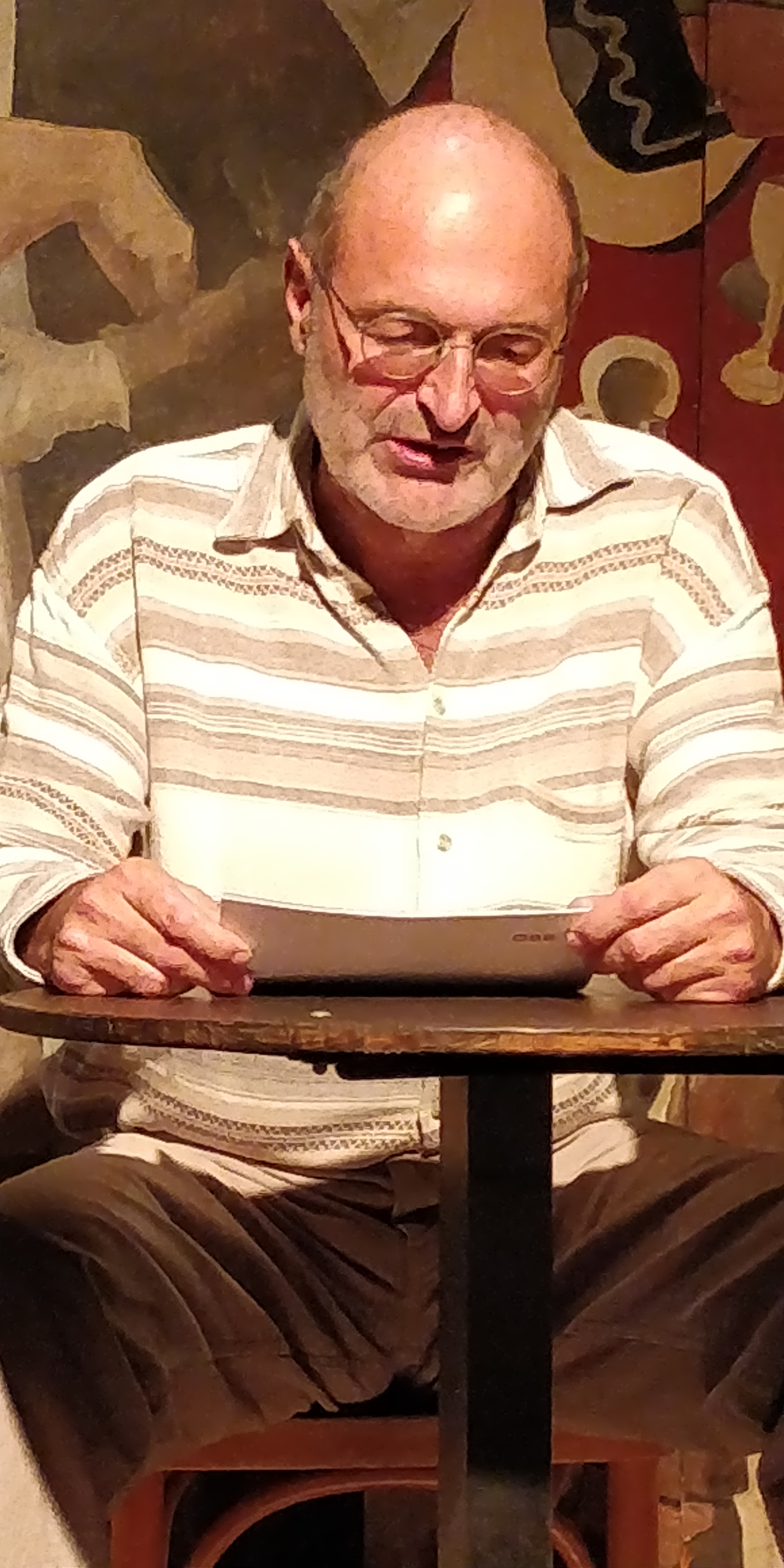Tag zweiundzwanzig des „Nanowrimos“ und ich erhalte ziemlich regelmäßig Aufmunterungsmail und solche doch etwas Geld zu spenden, damit das Ganze ein Erfolg wird und es gibt auch Autoren, die Videos dazu drehen, wie beispielsweise Julia K. Stein, dabei habe ich meinen „Nano“ oder das Projekt, das ich im August begonnen habe, schon am ersten November mit 49.238 Worten abgeschlossen und bschlossen den Rest des Monats und auch noch später das Ganze zu korrigieren.
Das heißt, weil bald darauf die „Buch-Wien“ gebann und ich dann auch noch innerhalb von drei Tagen drei Lesungen hatte, meinen Geburtstag feierte und außerdem mit einer nicht kleiner werdenden Monsterleseliste dastehem bin ich bis jetzt gerade einmal dazu gekommenm das Ganze durchzukorrigieren.
Damit bin ich am Sonntag in Harland fertiggeworden. Dann habe ich das Manuskript nach den Protagonisten, beziehungsweise Handlungssträngen sortiert, also einen Stoß mit den Magdalena Kirchberg Szenen, einen für die Magda, den Momo, die Nastasja Stancik, die Maria Mallatschuk und die Ulla hat, glaube ich, auch noch einen und gehe jetzt das Ganze stapelweise durch, um die einzelnen Geschichten vielleicht noch auszuweiten, stimmiger zu machen, Fehler zu korrigieren, etcetera.
Das heißt, im Nachhinein ausweiten bin ich nie sehr gut und bin das auch jetzt nicht, habe den Magdalena Kirchberg-Strang jetzt durchgesehen und halte derzeit bei 48 078 Worten.
Richtig, es war diesmal kein „Nano“, denn Erstens schon im August angegangen, Zweitens schon am ersten Tag mit cirka tausend Worten weniger mit dem Rohkonzept fertig und zum täglichen Korrigieren komme ich derzeit auch nicht. Dazu habe ich meistens zu viele Stunden, obwohl ich mich ja im Sommer, bevor ich mit dem Rohtext angefangen habe, mich mit dem Zeitmanagement beschäftigt habe, denn da hat Jurenka Jurk, eine deutsche Schreibtrainerin, die ich im Vorjahr kennengelernt habe, weil sie auch ausgerechnet im November eine Online Messe für Autoren abgehalten hat, ein solches Seminar angeboten und das mit ein paar kostenlosen Webinaren untermauert.
Sie ist da sehr gründlich und ich habe eigentlich auch ein gutes Zeitmanagement, nur das mit dem regelmäßigen Schreiben klappt bei mir nicht, denn die täglichen fünfzig Worte, die ich natürlich hinausquetschen könnte, würde ich dann am nächsten Tag wahrscheinlich wegwerfen müßen.
Also habe ich meinen heurigen „Nanowrimo“, der keiner war, ohne Hilfe von Seminaren geschrieben. Im Vorjahr habe ich mir ja von Annika Bühnemann, die jetzt ziemlich von der Szene verschwunden ist, Schreibimpulse schicken lassen und bin mit dem Resultat, wie schon beschrieben, so na na zufrieden.
Das heißt eigentlich schon, aber andererseits wird es höchstwahrscheinlich wieder niemand hintern Ofen hervorlocken, ist wieder eine Geschichte von einer depressiven Frau und den Roman hat Magdalena Kirchberg eigentlich nicht geschrieben und auch nicht wirklich einen Blog übers Schreiben. Dagegen rankt sich das Ganze um drei andere Geschichten, die der Nastasja, die eine ziemlich eigene ist, während der Momo und die Maria Mattatschek, die plötzlich, als sie schon dement ist, mit ihren Traummotizen Erfolg hat, obwohl sie das eigentlich nicht will.
Die Maria ist das Alter Ego der Magdalena könnnte man so sagen oder auch ihr Gegenspieler, der Antagonist, um im Schreibjargon zu verharren. Dagegen ist die Ausgangsszene, die drei Personen in dem weißen Auto aber, die ich ja in der Schreibgruppe dreimal geschrieben habe, ziemlich flach geblieben.
Gut, da waren der Oberarzut und die Hebamme, die Magdalena während ihrer Geburt vor fünfundreißig Jahren betreuten. Dann gab es noch einen Psychiater, der zwar schon gestorben ist, die Maria aber immer noch besucht und Spannungen Magdalenas mit ihrer Tochter, die schließlich Mutter wird, gibt es auch.
Da sind einige schon bekannte Motive enthalten, die Pensionsschockdepression in die Magdalena plötzlich fällt, als keine klienten mehr zu ihr kommen, die vaterlose Tochter und die Nachbarn mit denen sie sich befreundet. Einer meiner Meinung nach recht origineller Scghluß, der dasGanze abrundet, während der Roman eigentlich nicht geschrieben wird und die drei im Auto am Schluß aus der Tochter der Hebamme, ihrem linken Freund und dem FPÖ-Politiker bei dem sie arbeitet, bestehen.
So weit, so gut, das Ganze jetzt vielleicht ein halbes Jahr korrigieren, dann eine Vorschau in den Blog stellen, eine Leserunde und ein Gewinnspiel ausrufen zu dem sich niemand meldet und das war es dann und ran an das nächste Projekt, obwohl ich derzeit gar nicht sicher bin, ob ich noch eines finde.
Dann kam aber vorige Woche wieder Jurenka <jJurk ins Spiel und bot ein tolles Seminar zur „Heldenreise“ an, das wie sie euphorisch meinte, allen angehenden Autoren helfen kann, mehr Spannung in ihre Projekte oder sie überhaupt zu ende zu bringen.
Die „Heldenreise“, ach ja, ein paar Schreibratgeber habe ich ja auch gelesen und beschäftige mich im Netz auch intensiv mit solchen Seiten, gehe zu den Schnuppertagen des „Writerstudios“, die „Heldenreise“ ist ein Schema, das der Mythenforscher Joseph Campell im vorigen Jahrhundert entdeckt hat und das sich, um es vereinfacht auszudrücken, Hollywood unter den Nagel gerissen hat, um seine Filme spannend zu gestalten.
Campell hat, glaube ich, die Mythen untersucht und herausgefunden, daß sie alle nach einem Schema funktionieren, die er in vierzehn Punkte einteilte.
„Der Held erhält einen Ruf oder Auftrag, sein Leben ändert sich, er macht sich auf auf die Reise, bekommt einen Mentor und einen Widersacher, muß Prüfungen bestehen. Es kommt zur Katastrophe, er muß sich bewähren und am Schluß kommt er geläutert und mit dem Schatz nach Haus“.
Die Schreibratggeber raten einen, sich an das Schema, das auch bei den Dramen, die ja in Akte eingeteilt sind, funktioniert, zu halten. Ich hatte immer meine Schwierigkeiten damit und bin mit den etwas altmodischen Punkten, wie beispielsweise „Der Ruf des Abenteuers“, „Die endgültige Segnung“, „Verweigerund und Rückkehr,“ beispielsweise auch nicht weitergekommen. Denn, wie wende ich das bei der Magdalena oder bei meinen anderen Heldinnen an?
Die Magdalena geht in Pension und beschließt, um aus ihrer Depression herauszukommen, einen Roman zu schreiben. So weit, so gut, aber wer ist der Gegenspieler? Was ist die“ Versöhnung mit dem Vater?“ Sie hat gar keinen mehr, denn der ist schon lang gestorben, hat ihr aber mit achtzehn davon abgeraten einen Roman zu schreiben. Jetzt tut sie es trotzdem, das ist der „Ruf“, aber was ist die „Katastrophe?“.
Die Antogonistin ist mir eingefallen, könnte die Maria Mattaschek sein. „Läuterung“ gibt es auch und am Ende geht sie vomLiteraturhaus nach Haus, sieht wieder den BMW, in dem jetzt die Ulla mit ihren zwei Gegenspielern sitzt und weiß nicht, ob sie weiterschreiben oder ihr künftiges Enkelkind betreuen soll?
Das ist, habe ich schon geschrieben, wie ich fürchte, nicht so besonders spannend. Aber ich schreibe auch psychologisch realistisch und keine Fantasy, wo die Ritter mit Drachen kämpfen und am Schluß, die Prinzessin nach Hause bringen.
So habe ich die Heldenreise immer mehr oder weniger liegen gelassen, mir aber jetzt, weil ich ja gerade am Korrigieren bin, mir wieder zwei Webinare der Jurenka Jurk angehört, die ein dreiwöchiges Wunderseminar anbietet, in dem sie einem die Heldenreise moderner näherbringen will.
Das werde ich wieder nicht machen, habe mir aber die Campell-Punkte und vor allem den Spannungsbogen ausgedruckt und im gestrigen Seminar gab es auch die Verbindung zur „Heldenreise“ zur Persönlichkeitsentwicklung, denn das Modell wird auchtherapeutisch angewendet.
Das erscheint mir zwar noch weniger plausibler. Aber ich habe die „Heldenreise“, ja noch nicht so ganz, als Wundermittel begriffen, sondern als den Kniff, um mehr Spannung in seineTexte zu bringen, was sicher nützlich ist. Aber da klingen bei mir auch wieder die Alarmglocken, denn wenn sich jetzt alle an das Schema halten und es Punkt für Punkt abarbeiten, werden die Sachen und das ist ja der große Vorwurf an den Schreibschulen, vermutlich wirklich gleich und meiner Meinung nach auch immer unrealistischer.
Denn als ich in der „Augustin Schreibwerkstatt“ aus meiner „Krisenwelt“ gelesen habe, habe ich das Feedback bekommen „Das interessiert mich nicht, das Alltagsleben einer Großmutter, die die Kinder ihrer Messietochter vom Kindergarten abholt und mit ihnen auf den Spielplatz geht! Ich will es spannender haben, denn vom Alltag habe ich schon genug!“ und im „Writersstudio“ hat mich auch gestört, daß dort gefordert wird, an das Schlimmste, was man erlebt hat zu denken und das aufzuschreiben.
Denn „Dann wird es gut!“ und dann haben wir die verstörenden Romane der Jungautoren a la „Axolotl Roadkill“ und dagegen wehrt sich eigentlich die Psychologin und wenn ich dann nur mehr Romane lese, wo von Mord, Totschlag, Vegrewaltigung, Mißbrauch und Dystopie, etcetera die Rede ist, bin ich weit von der Wirklichkeit entfernt und so will ich Literatur eigentlich nicht verstanden haben und ich will mich mit ihr auch nicht nur unterhalten. Ganz abgesehen, daß ich mich an Mord und Totschlag, Vergewaltigung und Mißbrauch eigentlich auch nicht unterhalten kann.
Gestern gab es noch ein Webinar von Jurenka Jurk oder eigentlich, die Wiederholung eines Videos, das es bei ihr im Vorjahr bei der Autorenmesse gab, nämlich ein Gespräch mit Ulrike Dietmann, die die Heldenreise sehr persönlich fasste und meinte, daß es der Autor ist, der in seinen Projekten auf eine solche zu gehen hat. Er muß sich verwandeln und wachsen und alles, was er hat, nämlich wörtlich, hundert Prozent geben, gibt er nur 99, 9, dann ist es zu wenig und das erscheint mir eigentlich sehr gefährtlich, denn dann blutet sich der Autpor aus. Der leser ist vielleicht trotzdem nicht zufrieden und bricht das Buch ab, weil immern noch zu wenig Spannung und wir sind in irgenwelchen Galaxien und weit weg, vom Leben, wie ich die Literatur eigentlich schon verstehe.
So weit so gut und trotzdem sehr interessant, denn ich habe mir ja schon vorgenommen, vielleicht beim nächsten „Namowrimo“ wirklich mehr auf die „Heldenreise“ zu achten.
Mir eine Person und ein Thema zu nehmen und dann versuchen mich an Punkt für Punkt zu halten. Da befürchte ich zwar, daß das ganze kitschig oder zu mächenhaft phantastisch wird. Mal sehen.
Daß ich die Magdalena Kirchberg nicht umarbeiten kann, war mir von vornherein schon klar. Es vielleicht doch noch ein ganz klein wenig spannender bekommen, wenn ich die einzelnen Stränge nacheinander korrigere und mir nächste Woche noch das nächste Video, bevor Jurenka Jurks dreiwöchiges Seminar beginnt, ansehen und, daß ich mich an die Gliederungen halten sollte?
Theoretisch ja, aber die habe ich auch in der Schule erst immer im Nachhinein gemacht und eine Vorausplanerin, vielleicht a la Schneeflockenmethode, will ich eigentlich auch nicht sein. Sondern schon, wie bisher, eine Idee, eine Person nehmen und mich dann spontan weiter von Szene zu Szene, am besten immer ein paar Szenen im Voraus zu entwickeltn und da habe ich bei meinen Texten oft nicht die großen Katastrophen und auch nicht großen Gegenspieler, sondern, die kleinen Alltagskrisen und meistens geht es irgendwie auch gut aus.
Auch wenn die Veronika Sieberer im „Im Namen des Vaters“ am Ende stirbt, ihre Tochter bekommt da auch noch eine Tochter und das ist auch ein Buch, wo ich mir die „Heldenreise“ noch am ehesten vorstellen kann. Aber sehr spannend, werden meine Leser vielleicht sagen, ist das auch nicht greworden. Aber da habe ich, glaube ich, auch keine Rezension bekommen und eine Leserunde habe ich damals noch nicht anzubahnen versucht.