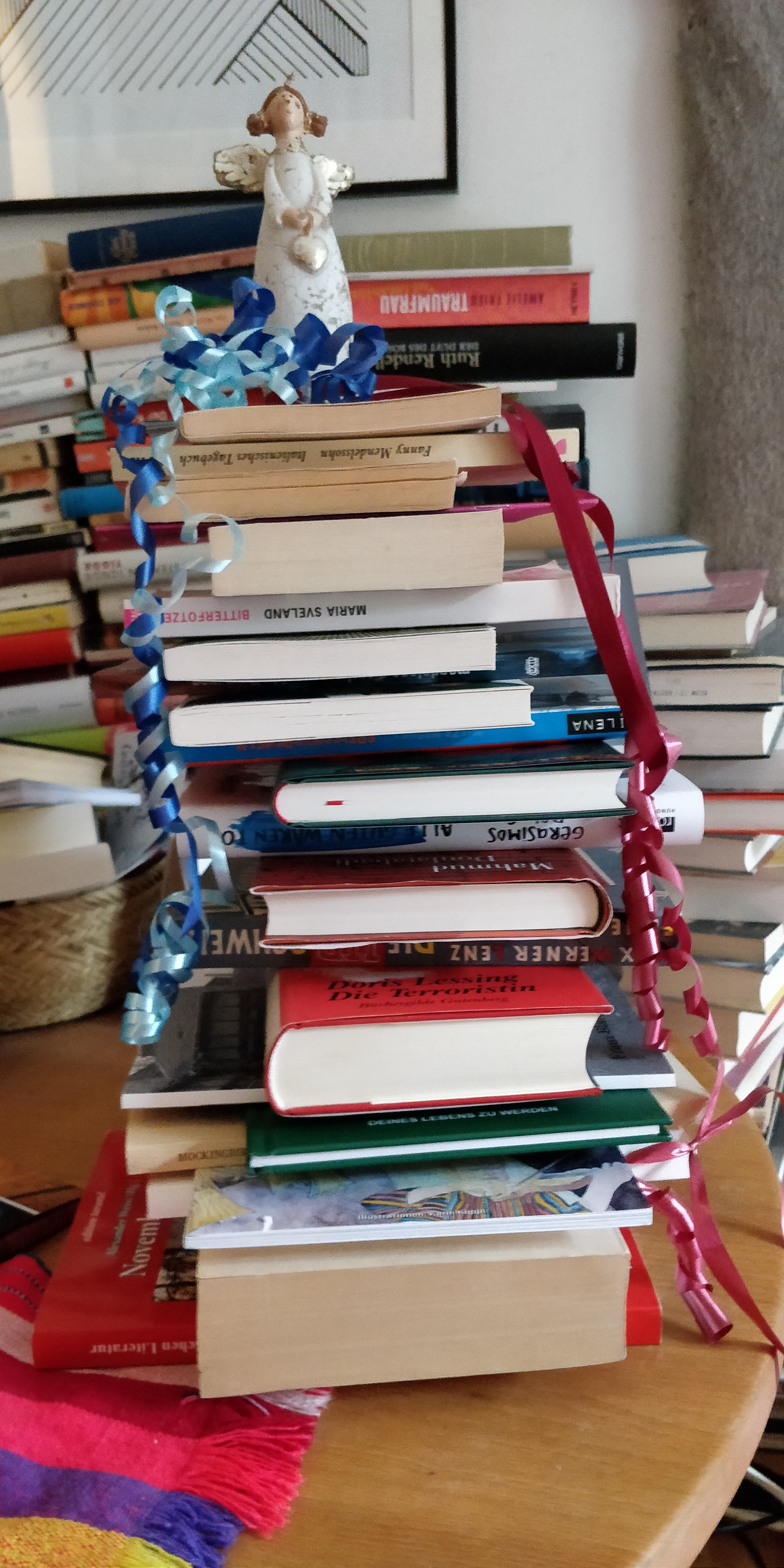Und jetzt kommt das zweite Buch von meinem Bücherchristbaum und Adventkalender, das zweite Weihnachtsbuch des Jahres, eines das nicht aus der „Wundervollen Buchhandlung“ stammt und eines das auch zwischen dem Geburtstagsfest und Weihnachten zu mir gekommen ist, nämlich Franz Blahas in ottakringischen Dialekt, wo er offenbar aufgewachen ist, zwischen 2001 und 2016 für die Weihnachtsfeier im „Häferl“, dem Treff für Haftentlassene, wo ich auch schon mal gelesen habe, geschriebe Gedichte, die er jetzt herausgegeben hat und am dem Tag im Ottakringer Bezirksmuseum vorstellte, als das letzte KAV-ÖAAG- Refelexionstreffen mit Sekt und Brötchen war, so daß ich zu der Präsentation nicht kommen konnte.
Herr Blaha, den ich schon länger von Lesungen zu denen er auch als Besucher geht und auch einige seiner Publikationen kenne, war aber so lieb, mir das „Weihnachtsbuachl“ zur „Poet-Night“ vorbeizubringen, so daß es heuer bei mir doch sehr weihnachtlich wird.
Man sieht, ich komme trotz aller „Winterfestumbauaktionen“ nicht darum herum und kann so am vierundzwanzigsten Dezember nicht nur einen Christbaum, sondern einen besinnlichen Gang durch Franz Blahas Kindheit, wie ich vermute, die sich auch zum Teil mit meiner deckt, denn ich bin ja ab 1953 in Hernals in der Wattgasse aufgewachsen und habe als Kind oft die eine Großmutter, die in Ittakring in den sogenannten Jubiläumsbauten lebte und die andere, die mit ihrer Tochter, meiner Tante Grete und ihrer Enkeltochter Susi, meiner Cousine, in einem Gemeindebau in der Hütteldorferstraße im vierzehnten Berzirk, ein Stückchen weiter unten lebte, geben.
Die Gedichte sind, wie Franz Blaha in seinem Vorwort schreibt im Ottakringer Dialekt geschrieben und wurden der besseeinem ziemlichen <hren Verständichkeit wegen, nicht in Hochdeutsch, sondern im „Normaldialekt“ übersetzt und das ist gut so, denn sie wären sonst ziemlich unverständlich, denn ich bin ja auf Wunsch meiner Mutter in Hochdeutsch aufgewachsen, damit ich es einmal besser habe im Leben, wie das damals so hieß und kann mich an dieses Ottakringisch auch nicht wirklich erinnern und glaube, daß die, in den Siebzigerjahren verstorbene Großmutter, ebenfalls Hochdeutsch, wahrscheinlich mit einem mehr oder weniger starken tschenischen Akzent, gesprochen hat.
Die Gedichte also bei der Weihnachtsfeier für Haftentlassene,Obdachlose und andere Menschen, die es wahrscheinlich nicht so gut im Leben haben und wie schon geschrieben, viel Nostalgisches und Sachen an die ich mich bei meinen Weihnachtsfesten in der Wattgasse, die ich eigentlich trotz der Kinderbücher von Friedrich Feld von Vera Ferra-Mikura, die Weihnachtsgaben der „Kinderfreunde“ für die SPÖ-Mitglieder, was mein Vater ja bekanntlich war und sehr aktiver Berzirksfunktionär mit Kanditat Nummer sechszehn für die Bezirksvorsteherliste, kein sehr angenehmes war, denn die Mutter hat, wenn sie von ihrer Arbeit als Kindergartenhelferin nach Hause gekommen ist, noch bis weit in die Nacht des Vierundzwanzigsten geputzt und gebacken und war dann am nächsten Tag, wo es den Karpfen und die Pute vorzubereiten und den Christbaum aufzuputzen galt, nicht mehr so gut aufgelegt und der Vater drohte mir, daß es keine Geschenke gäbe, wenn ich nicht hoch und heilig an das Christkind glaube, was ich so zwischen dem ersten Trotzalter und der Pubertät ernster genommen habe, als ich es wahrscheinlich sollte.
Nun gut, so waren sie wahrscheinlich die Nachkriegsweihnachten in die Wirtschaftswundergeneration. Einen Christbaum hatten wir, das habe ich schon geschrieben, Krippe ist keine darunter gestanden und so habe ich auch an den „Ochs und den Esel“ nicht so sehr geglaubt, denen Franz Blaha seine erstenGedichte widmete.
Das Cover ziert eine „Hausgrippe“ nach einem Foto von Andreas Praefcke. Vorher gibt es noch ein Gedicht, das wahrscheinlich auch aus Franz Blahas Kindheit stammt, wo sich die dreißig Schilling am Tag verdienende Mutter, die ihrem Sohm ein Buch, um diesen Betrag kaufte, darüber ärgert, daß er es, statt es schön Tag für Tag einzuteilen, um länger davon etwas zu haben, ratzeputz sofort auslas.
Ja damals hat man sich über die lesenden Kinder noch geärgert und sich gefragt, ob sie niechts besseres zu tun hätten? Heute würde man sich darüber freuen, weil sie dann bis zur Matura wüßten was „Pathos“ heißt, vielleicht mehr als fünf österreichische Autoren kennen und sie auch gelesen haben.
Die Zeiten ändern sich, heute biegen sich die Christbäume und die Geschenke darunter sind so teuer, daß die Schuldnerberatungsstellen vor Weihnachten im Radioempfehlen, daß man nicht mehr ausgeben, als man hat und an den Einkaufssamstagen möglichst keine Kreditkarte mitnehmen soll, während Franz Blahas oder eine andere Oma vor demn schönaufgeputzen Christbaum der Zweitauserjahre steht und sich daran erinnerte, daß früher, als der Bundeskanzler keinen Baum zu Weihnachten versprechen konnte, alles viel schöner und viel besser war, die Gans , die es damals nicht gab, viel besser schmeckte, die Kerzen heller strahlten, etcetera. Ja, die Erinnerung kann trüben oder man hat sie sich verklärt.
Und so erinnert sich auch Franz Blaha an die Zeiten, als er erst ins Zimmer durfte, als der Christbaum schon aufgeputzt war und die Mutter am Fenster stand und ihm verkündete, daß das Christkind gerade hinausgeflogen war, weil es ja noch so viele andere brave Kinder und Franzu Blaha hasste dann diese, bescheren mußte, bevor er sich am Christbaum erfreute, an denen die Zuckerln hingen, die er selbst mit der Mutter eingewickelt hat, „weil man dem Christkind ja helfen mußte.“
Das Christkind trifft er dann an der Straßenbahnhaltestelle, als er vom Ottafkringer Friedhof kam, wo Anmerkung, nicht nur meine Großmutter begraben liegt, sondern auch Gerald Bisinger, Gerhard Kofler, etcetera und das erkundigt sich, ob hier der J-Wagen zum Karlsplatz fährt, aber die Straßenbahnen haben jetzt andere Nummern, fahren andere Routen und das Christkind war offenbar schon lange nicht mehr da.
Auch kein Wunder, denn der Weihnachtsmann oder Santa Claus mit dem roten Mantel, der mit Renntieren im Schlitten fährt, hat es aus Amerika kommend, längst verdrängt und schmeißt jetzt seine Geschenkpackerl durch den Kamin und ein solches Gedicht, wo der heilige Klaus vorm PC sitzt und nicht gestört werden will, gibt es auch.
Dreizehn länger oder kürzere Weihnachtsgedichte in breiten Ottakringer Dialekt also, die sich in der Übersetzung, El Awadalla und ihr „morgenschtean“ wird auch noch erwähnt, gut verstehen lassen und einen wahrscheinlich in die eigene Kindheit zurückführen, auch wenn man vielleicht viel später und nicht in Hernals oder Ottakring aufgewachsen ist und die ich allen Weihnachtsnostalgikern und auch Weihnachtshassern empfehlen kann, ob sie Petra Hartlieb in ihrer wundervollen Buchhandlung so leicht besorgen kann, weiß ich nicht. Franz Blaha ist aber ein sehr eifriger Literaturvermittler, hat oder hatte jetzt auch eine Schreibwerkstatt in der Pannaschgasse und wird sicher weiterschreiben.
„Ich wünsche euch schöne Weihnacht`n mit Kekserln und Kerzerln und ein schönes neu s Jahr“, das erstere habe ich zwar schon geschrieben, wiederhole es aber gern!