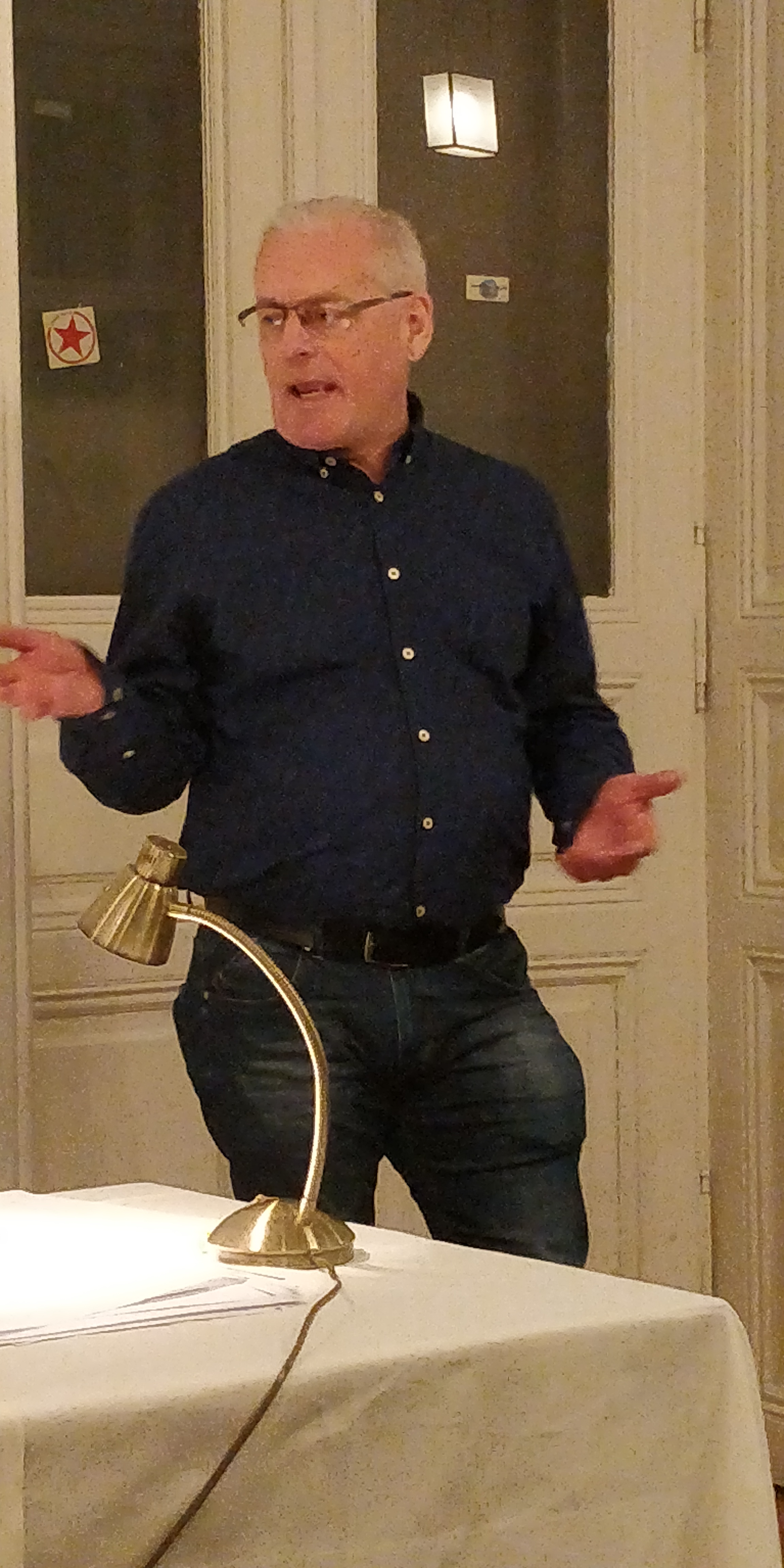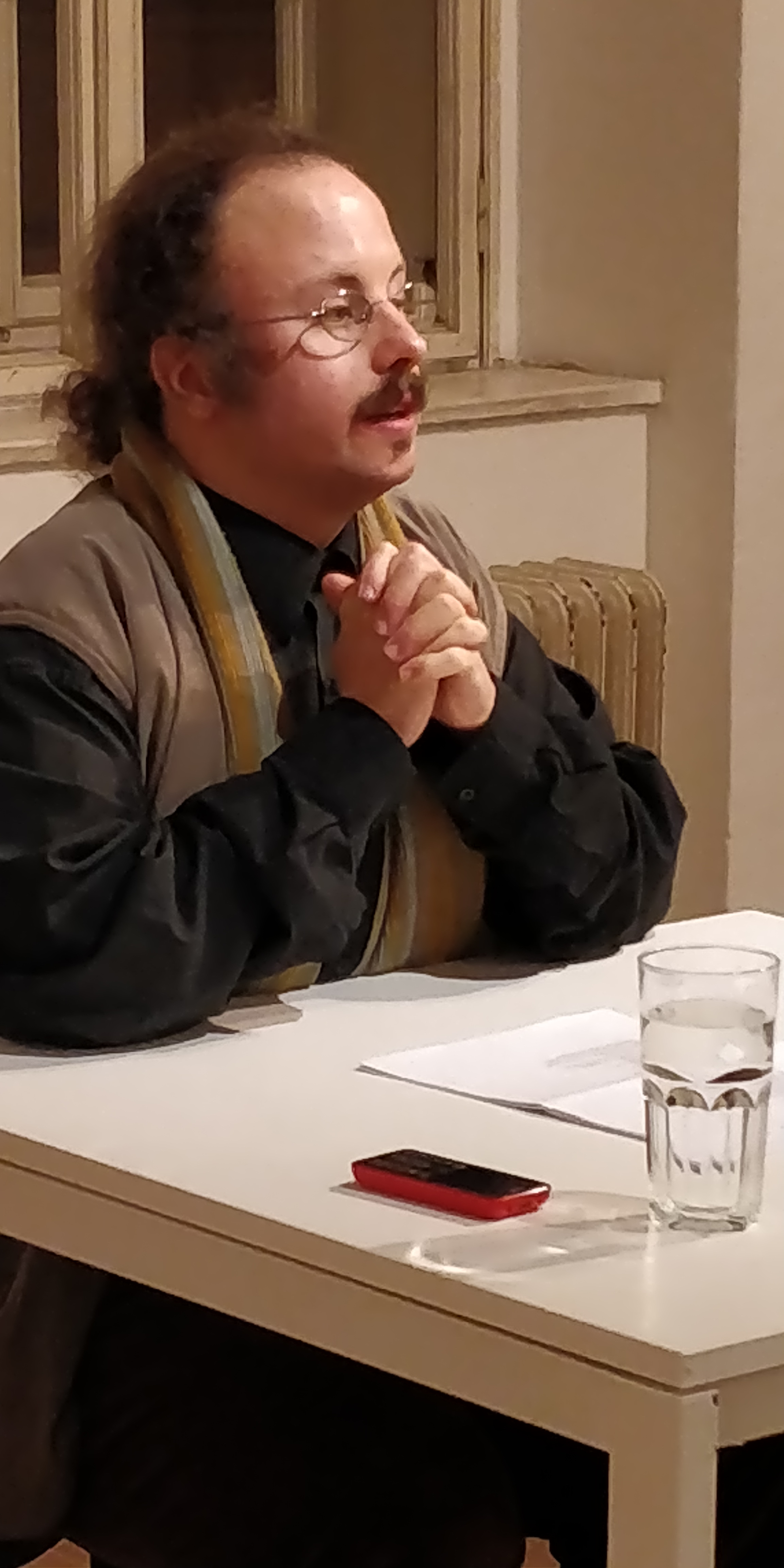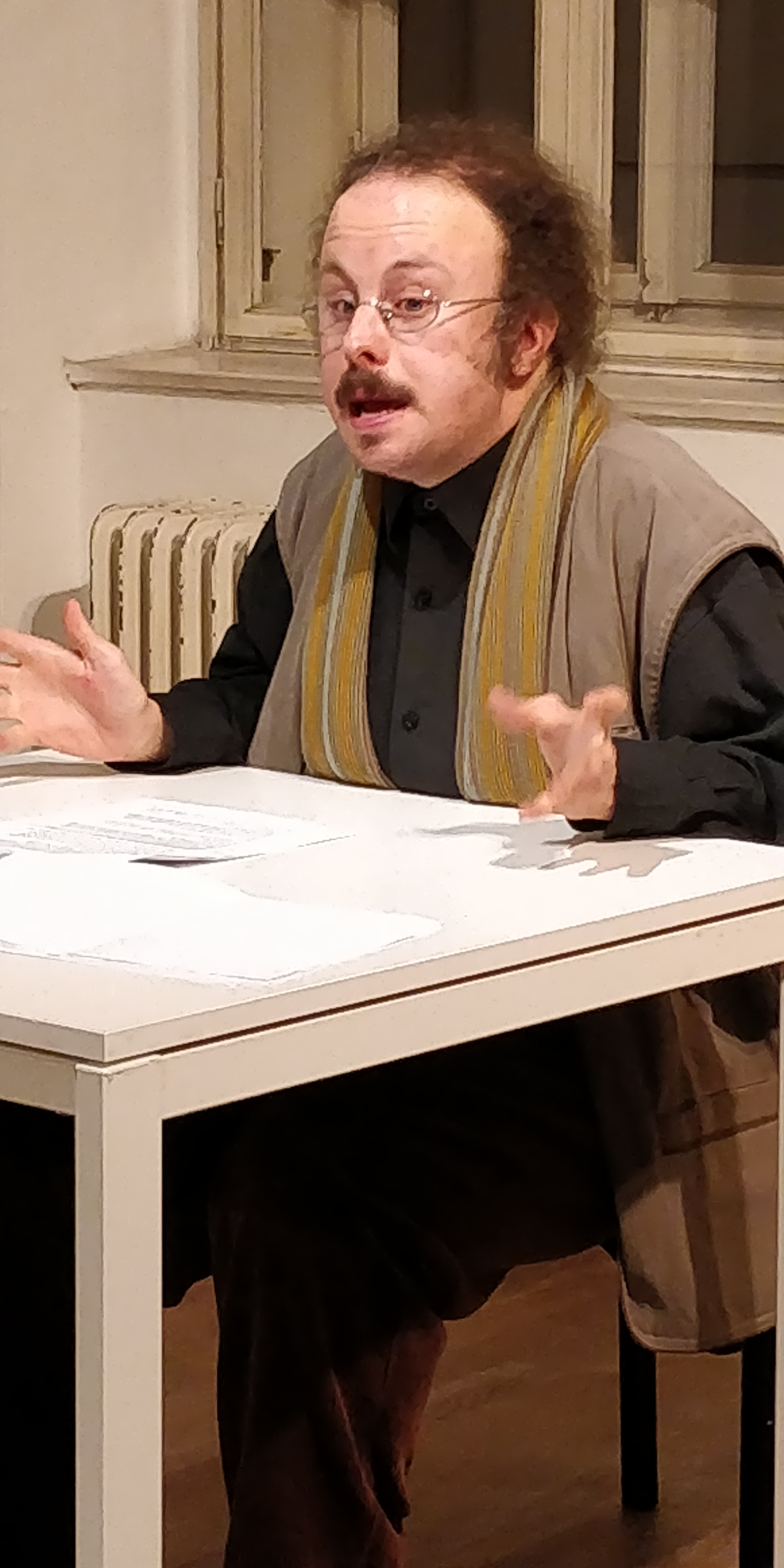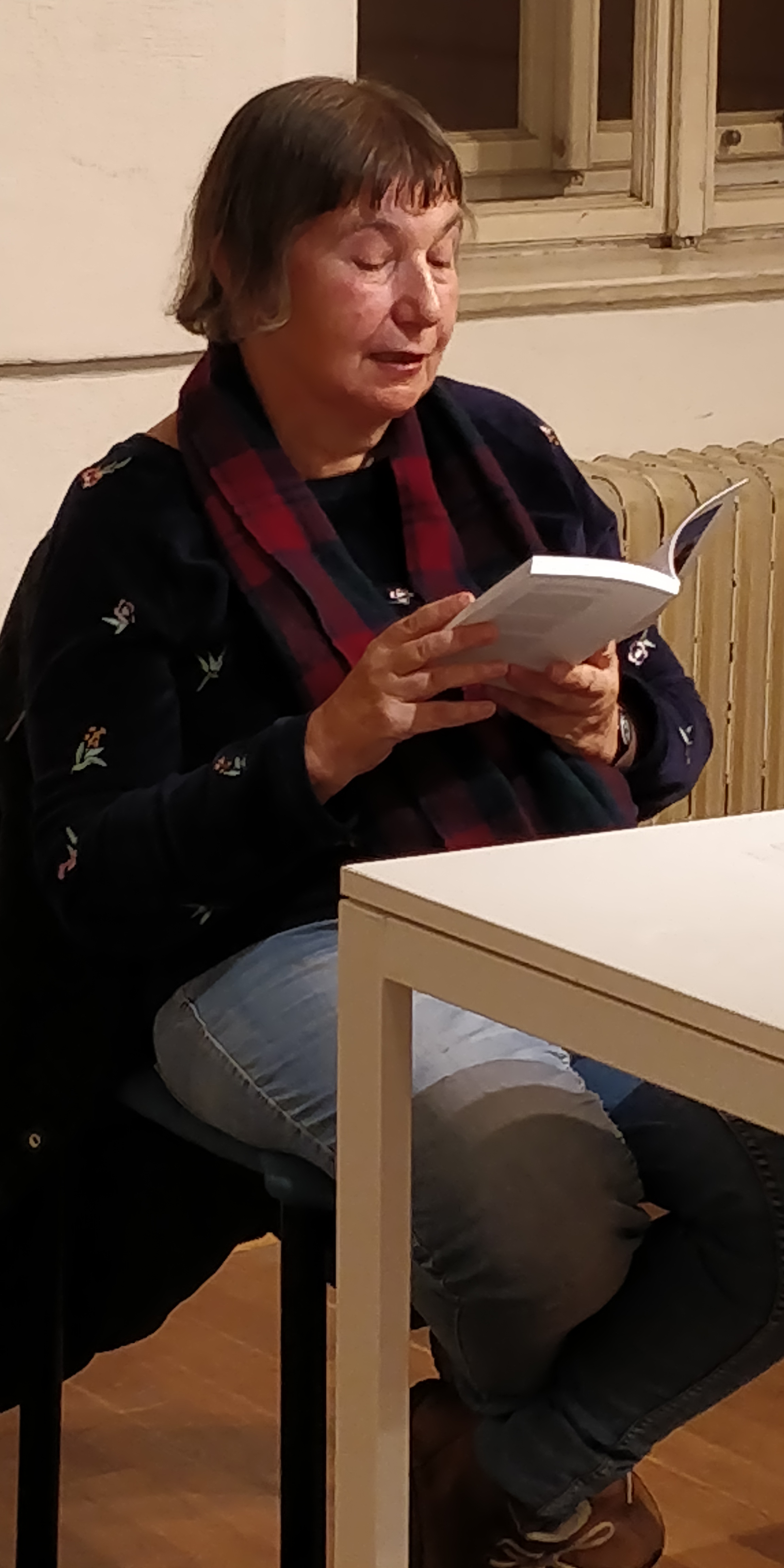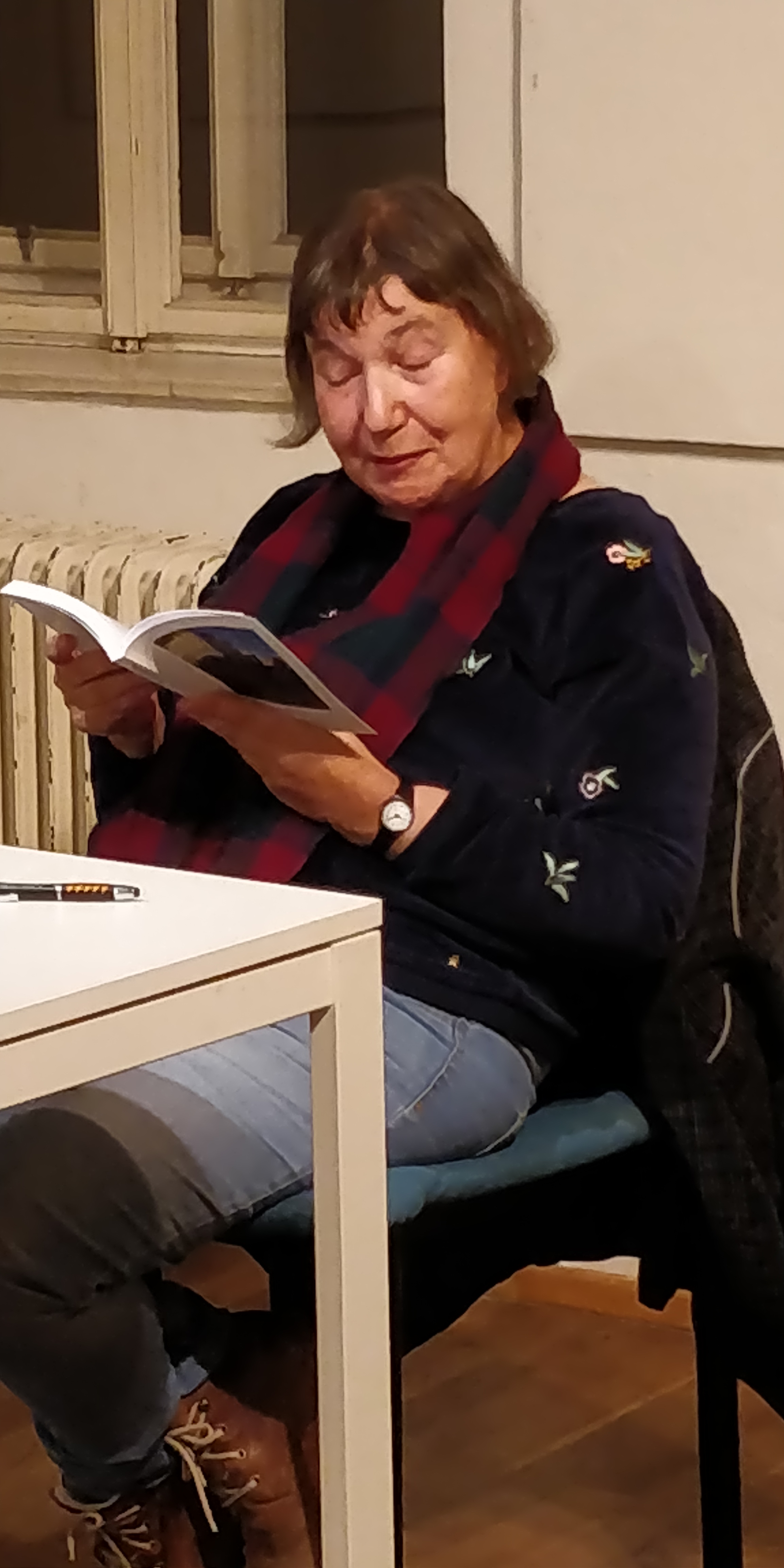Ich habe mich ja in den letzten Wochen sehr mit den Stationen des Romanschreibens beschäftigt, was, wie ich bei den entsprechenden Webinaren hören konnte, zur Folge haben kann, daß man dann beim Lesen seiner Bücher daraufschaut und den Autoren sozusagen bei ihren eigenen Romanfahrplänen auf die Schliche zu kommen scheint.
So ist es mir bei dem 1948 geborenen Nicolas Remin gegangen, der in seinem kürzlich erschienenen „Sophie Tagebuch“, glaube ich, das Ploten und Planen, sowie die spannungsbögen so perfekt ausgebaut hat, daß einiges fast übertrieben und unglaubhaft erscheint.
Es beginnt mit einem Prolog und im Jahr 1945, wo einer in den letzten Tagen des Krieges, eine Leiche in seinem Garten vergräbt und dabei am Schluß der Szene von jemanden ertappt wird.
Dann geht es los und in das Jahr 1989 hinein, nach Berlin, in den Oktober, wo im Osten der Stadt, der vierzigste Jahrestag der DDR gefeiert werden soll, dabei die Bürger schon davonrennen, beziehungsweise anfangen in Massen zu demonstrieren.
Das rührt jenseits der Mauer die fünfundvierzigjährige Französischlehrerin Erika zur Linde, die eine dicke Brille, Parkas und Wanderschuhe trägt und immer sehr streng zu ihren Schülern ist, sehr wenig. Hat sie doch andere Probleme und wird von der Sekretärin aus dem Unterricht geholt. Die Haushälterin ihres Vaters hat angerufen. Der alte Herr hat sich in seinem Arbeitszimmer erschoßen und sie soll schnell kommen.
Nein, das sagt sie ihr nicht so direkt und etwas Ähnliches, habe ich auch vor kurzem auch im „Schönen Paar“ so gelesen.
Erika eilt also zu der Villa in Lichtenberg, findet den Vater, die Haushälterin erzählt von einem Brief aus Amerika, den der Vater, ein alter Offizier aus Adelsgeschlecht, vor einiger Zeit bekommen hat und daraufhin ein paar Tage sein Bett nicht mehr verlassen hat.
Erikas Beziehung zu ihrem Vater war nicht sehr gut, hat er sie doch nach dem Tod der Mutter in den Fünfzigerjahren, als sie gerade sechzehn war, in ein Internat gegeben und jetzt besucht sie ihn nur mehr alle paar wochen zu einem Mittagessen.
Sie erbt trotzdem alles und begibt sich zuerst zum Notar, dann trifft sie seine Verlegerin, denn der Vater war Schriftsteller, hat in den Sechzigerjahren einen Kriegsroman geschrieben, sich dann aber plötzlich völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.
Die Haushälterin hat den Brief gefunden. Er stammt von einem Paul Singer und der schreibt, daß er der Neffe eines Felix Auerbachs ist, einem Juden, von dem der Vater, seiner <mutter geschrieben hat, daß er 1943 deponiert wurde.
Jetzt hat der aber eine Jüdin getroffen, die ihn noch später gesehen haben will und die Schwester hat dem Vater auch kurz vor seinem Rückzug, einen Brief geschrieben, in dem sie nach einem Mansukript des Bruders fragte. Der Neffe will deshalb nach Berlin kommen und mit dem Vater darüber zu sprechen.
Hat sich Ulrich zur Linde deshalb umgebracht?
Erika geht in die Villa, findet im versperrten Schlafzimmer ihrer Mutter ihre Tagebücher, die sie von 1939 bis 1945 geschrieben hat und beginnt darin zu lesen.
Das ist sehr spannend und man erfährt darin wahrscheinlich sehr genau, wie es sich in Berlin in dieser Zeit abgespielt haben könnte.
Die Mutter war 1939 ein neunzehnjähriges Mädchen, Tochter eines Parteimigliedes und Schwester eines SS-Mannes. Sie will nach der Matura Journalistin werden. Darf das aber nicht. Deshalb heiratet sie den Ulrich, der nichts dagegen hat, obwohl er eigentlich nicht sehr attraktiv ist und der hat einen Freund, nämlich jenen Felix Auerbach, einen Juden, der aber ein blonder blauäugiger Traummannn ist, den alle für einen Schweden halten und das ist wahrscheinlich, die Überthese Nikolas Remin, seine Figuren ja nicht klischeehaft wirken zu lassen.
Der blonde Felix entspricht dem Prototyp eines Nazis, will in den Krieg, eine Unform und das Ritterkreuz. Hält Hitlers Feldzüge eigentlich für gut, ist also sehr unsympathisch und die schöne, wahrscheinlich ebenfalls blonde Mutter ist sehr naiv und verliebt sich sofort in den schönen Jüngling. Sie sagt zwar noch sehr lange Dr. Auerbach zu ihm und geht mit ihm trotz aller Rassenverbote spazieren, ins Kino, in Luxusrestaurants und der Ehemann ist im Feld.
Er bekommt das Ritterkreuz und sagt nichts dazu. Sehr unglaubwürdig eigentlicht. Aber glaubwürdig, erscheint mir die Naivität und Unbesorgtheit der Neunzehnjährigen, die das um sie herum nicht versteht und sich eigentlich mehr Sorgen, um ihre Schönheit, als um alles andere macht.
Indessen, während sie all das liest, gehen auch in Erika Veränderungen vor. Sie legt ihre dicke Brille ab, kauft sich teure Jeans, geht zum Friseur , setzt sich Kontaktlisen ein und liest und liest, um all das, was die Mutter schreibt, zu verstehen, während sie Paul Singers Ankunft erwartet und währenddessen wird jenseits der Mauer Weltgeschichte geschrieben.
„Ich liebe euch doch alle!“, gesagt, Erich Honecker tritt zurück, Egon Krenz tritt auf und die Grenzen werden gestürmt, weil die Reisefreiheit, ob eines Versehens plötzlich für alle gilt.
Erika berührt das alles nicht sehr, ist sie doch in ihrer Phantasie vierzig Jahre früher und hat die Frage zu klären, ob der Kriegsroman nicht vielleicht von Felix Auerbach stammt, der besser schreiben konnte und der Vater ein Plagiator ist?
Sie kommt aber noch zu anderen Erkenntnissen, denn der Bechsteinflügel, der in der Villa steht, gehörte eigentlich Felix Auerbach. Gut, der hat ihn, um ihn nicht anderwertig arisieren zu lassen, beim Freund deponiert. Es gibt aber Porzellan und andere Sachen in der Villa, die der Vater Sophie schekte und die hat er vorher „günstig“ einem ausreisenden Nachbarn abgekauft.
Felix Auerbach wollte eigentlich noch 1939 mit seiner Schwester das Land verlassen, die schöne Sophie hindert ihn wohl daran. So bleibt er, kommt 1940 in eine Sammelwohnung, wo er jene Sarah Spielrein trifft, die später seinem Neffen von ihm erzählt. Er wird dann zwangsverpflichtet und muß sich später, das ist schon 1943, untertauchen. Das heißt, der arglose Ulrich besorgt ihm falsche Papiere und er zieht in die Villa, als Untermieter ein, während Ulrich an der Front ist und nur Stoffe und Kostüme schickt, die Erika später trägt, als sie zu ihren Treffen zu Paul singer geht.
Erika wurde 1944 geboren. 1943 mußten Auersbach und Sophie in den Luftschutzkeller und plötzlich redet sie ihm in ihrem Tagebuch als Felix an und Ulrich kommt jetzt aus einem Sanatorium zurück, hat sich verändert, ist vielleicht eifersüchtig, es kommt zum Streit….
Es gibt aber noch den Bruder Horst, den überzeugten SS-Mann, der nach dem Krieg verschwunden ist, aber jetzt aus dem Osten als SED-Parteimitglied wieder auftaucht.
Hat der Felix denunziiert, denn der wurde 1945 verhaftet. Kommt dann zwar nach ein paar Tagen wieder zurück, wird aber angeblich von Russen verschleppt, während Ulrich wieder angeblich, einen ihm angreifenden Russen tötet und vom Hausmeister beobachtet, im Garten vergraben hat, damit er nicht nach Sibirien muß.
Höchst kompliziert und auch höchst unglaubwürdig, mit all den Wendungen und den Spannungsbögen, von denen ich jetzt, um nicht zu sehr zu spoilern noch einiges ausgelassen habe.
Es ist aber, das will ich nicht bestreiten, sehr spannend zu lesen und scheint mir auch abgesehen von der zum Teil sehr widersprüchlichen Handlung sehr gut recherchiert und die historischen Details zu stimmen.
Jüngere Leser können sich daher vielleicht wirklich ein gutes Bild darüber machen, was in der NS-Zeit passierrt ist, obwohl mir der kriegsbesessene Dr. Auerbach, schon ein bißchen zu übertrieben scheint und da steht auch irgendwo etwas, von einem zu „plumpen Drehbuchplott“.
Mir würde er als zu überladen erscheinen und der gute Felix vielleicht zu unsymathisch. Gut das sind die Erika und die Sophie vielleicht auch. Das heißt die Naivität der neunzehnjährigen Parteimitgliedtochter, die nur ihrer Karriere wegen in die Partei eintritt und sich ansonsten ihren Spaß mit dem gutaussehenden Juden macht, ist gar nicht so unglaubhaft, warum aber Erika plötzlich kündigt, verstehe ich nicht so ganz. Oder doch, sie hat ja jetzt geerbt, muß also nicht mehr in die Schule gehen und eine Liebesgeschichte, das kann ich noch verraten, erlebt sie auch noch als Überdrüber oder weiteren Handlungspunkt.