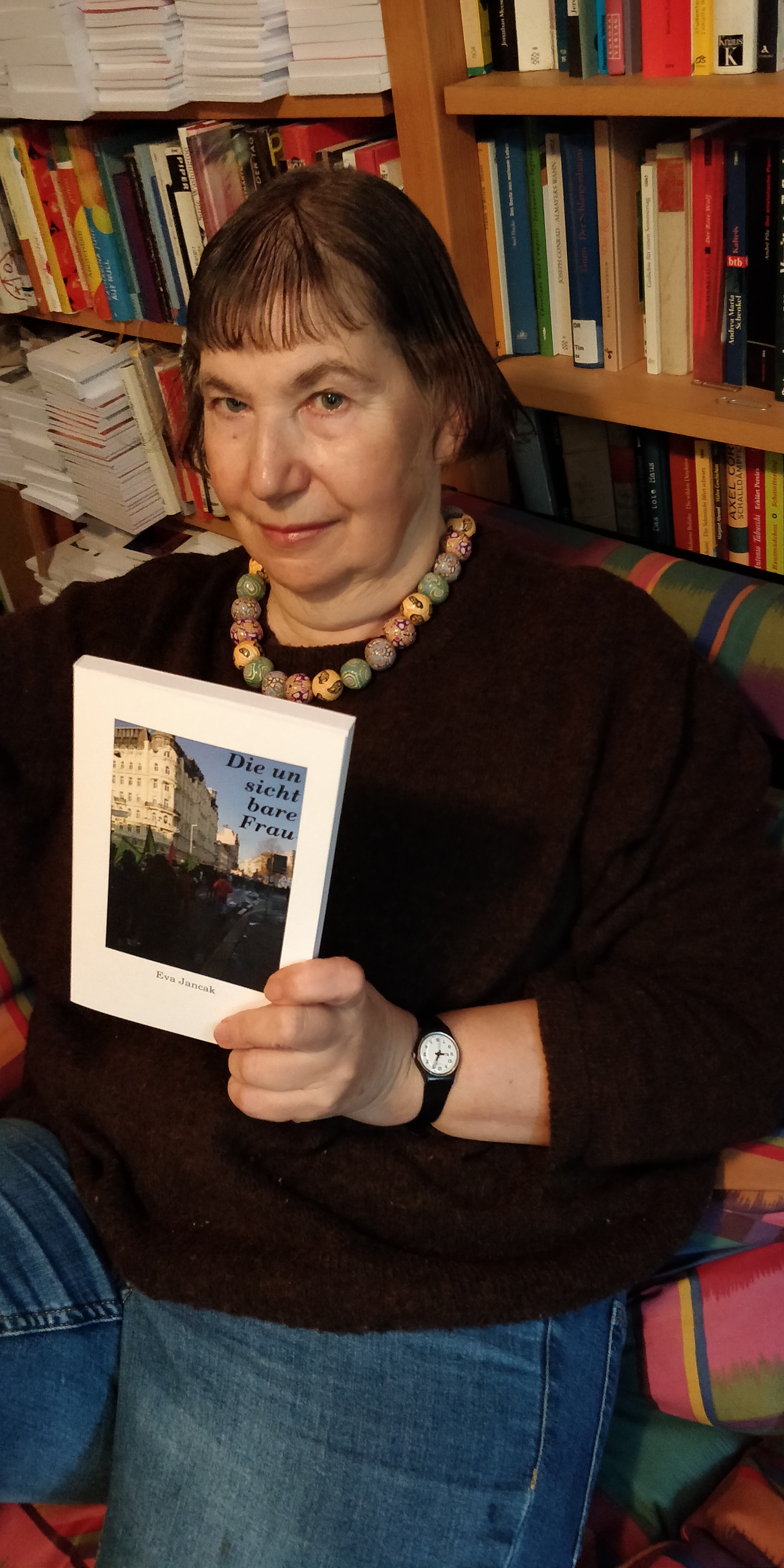Jetzt endlich, es ist schon Jänner 2019, kommt Buch achtzehn des dBp 2018 und das war es dann wahrscheinlich auch, denn Buch neunzehn und zwanzig scheinen nicht zu mir zu kommen, obwohl mir das von Christina Viragh vom Verlag versprochen wurde und ich auch eine diesbezügliche Datenschutzerklärung abgegeben habe.
Macht aber nichts, man braucht nicht alles lesen und 217 waren es auch nur achtzehn gelesene dBp- Bücher, allerdings stehen die restlichen zwei auf meiner Leseliste von 2019 und wenn ich es nicht wieder mit den Neuererscheunugen so übertreibe, hätte ich die Chance, den 2017-Jahrgang, wie den von 2015 mein erstes Buchpreisjahr, komplett zu lesen.
Und es ist ja auch nicht nur Buch achtzehn sondern auch das sechste der vorjährigen Shortlist, denn darauf ist ja die 1972 in Buenos Aires geobrene und in Berlin lebende Maria Cecilia Babetta, von der ich noch nie etwas gehört habe, gestanden und, daß das Buch zu mir gekommen ist, habe ich einer Schlamperei zu verdanken, denn „Fischer“ hat es mir nicht geschickt, dafür „Hanser“ seine zwei Bücher als E Books oder PDFs und da habe ich das der Anja Kampmann in der Mailbox, ähnlich, wie das Buch der Carmen Francesca Banciu verschlampt und habe gedacht, schaue ich da vielleicht bei „Netgalley“ nach, bevor ich nochmals anfrage.
Habe da dann gleich alle restlichen Bücher bestellt, konnte da aber nur „Nachtleuchten“ öffnen, so daß es bei zwei ungelesen bleiben wird und mit dem sechsten Shortlist Buch habe ich mir, ich schreibe es am besten gleich, nicht leicht getan und bin wieder einmal zwischen „fantastisch“ und „unverständlich“ hin und hergeschwankt und das ist es, glaube ich auch.
Da ich das Buch erst sehr spät gelesen habe, habe ich mir vorher das „Buchpreis-Video“ angeschaut und da die Autorin sagen hören, daß sie da Buenos Aires, beziehungsweise den Vorwort Ballester, in dem sie aufgewachsen und, wo auch ihr Großvater eine Autowerkstatt hatte, schildern wollte.
Das Buch spielt in den Siebzigerjahren, also vor der Militärdiktatur in der Zeit, wo Peron stirbt und seine Frau Evita, das Präsidentschaftsamt übernimmt.
„Aha!“, könnte man nun sagen und eine Vorstellung, was einen erwartet wird, haben.
Ich hatte sie und habe mich gänzlich getäuscht, denn die kleinen Leute von denen das Buch handelt, sind sehr spiritistsch angehaucht, um nicht zu sagen mythisch- phantastisch, aber der phantastische Realismus kommt ja von Lateinamerika her und wenn man da jetzt wieder „Aha!“, sagt und zu dem Friseursalon, der „Zur ewigen Schönheit“ heißt, nickt, irrt man sich wieder. Denn es gibt ein Video im Netz, wo Maria Celicilia Barbetta durch Berlin radelt und vor einem solchen Friseursalon steht, bezeihungsweise vor einem Geschäft in dem früher ein diesbezüglicher Laden war und die sehr sprachgewandte Autorin, die offensichtlich Lust an Sprachspielereien hat, zeigt auch auf ein Straßenschild auf dem „Ausfahrt freihalten“ steht und erklärt, daß sie dann immer „Freiheit aushalten“ denkt, wenn sie es sieht.
Das fünfhundert Buch ist in drei Teilen gegliedert, die je dreiunddreißig Kapitel haben und dann gibt es noch ein hundertstes, die „Vierte Dimension“ genannt.
Die kleinen Leute in dem Buch sind die Automechaniker in der Werkstatt von Teresas Großvater und die ist vielleicht das alter Ego der Autorin, jedenfalls ein zwölfjähriges Mädchen, eine Artztochter, die Mutter ist, wie offenbar auch die von Maria Cecilia Barbetta italienische Einwanderin und der Vorort in dem das Buch spielt ist auch ein Einwandererbezirk.
Theresa bekommt zu Beginn des Buches ein Geschwisterchen und besucht außerdem eine katholische Schule, in dem es lauter alte Nonnen und eine junge Sour Maria gibt, die den Schülerinnen das zweite vatikanische Konzil näherbringen will. Sie fährt mit wehenden Schleier unterm Helm auf einer Vespa zu einem Pfarrer, der sich als ihr Bruder entpuppt, vorher hätte man, da es dort auch ein kleines Mädchen gibt, auch an eine verbotene Liebesbeziehuing denken können.
Teresa bringt jedenfalls von ihrer Lehrerin angestachelt eine Plastiknonnenfigur wochenweise zu allen Familien des Ortes und so gleiten wir durch die dreimal dreiunddreißig Kapitel und kennen uns, wenn wir das Buch nicht sehr genau und am besten mehrmals lesen, höchstwahrscheinlich nicht aus.
Denn es passiert wahrlich viel in den dreimal dreiunddreißig magisch-phantastischenKapitel. Der erste Teil ist der „Bloody Mary“ und den Klosterschülerinnen gewidmet, die aus externen und internen bestehen. Die Internen sind meist die armen Mädchen, die einen Freiplatz haben, die Externen zum Beispiel, die zahlende Arzttochter Teresa. Dann gibt es aber noch eine Adriana, deren Vater Rechtsanwalt ist, in dessen Haus Teresa die Madonna zuerst hinbringt, die könnte also eigentlich auch eine Externe sein. Sie ist aber eine zahlende Internatsschülerin und darf das Kloster nicht verlassen, weil der Vater soviel arbeiten muß, die Mutter ein Hündchen namens Mimi und ständig Migräne hat und das Dienstmädchen deshalb auch ständig beschäftigt ist.
Man sieht, es ist sehr komplziert, wird aber noch komplizierter und im zweiten Teil geht es sowohl in die Autowerkstatt, zu dem Großvater und seinen Gesellen, als auch in den schon erwähnten Friseursalon, der einem Celio gehört oder eigentlich seiner Mutter. Die hat einmal von Evita eine Nähmaschine geschenkt bekommen, die sie dann in eine Trockenhaube umtauschte. Jetzt ist sie alt und verstummt, offenbar ist eine Demenz damit gemeint, so daß sie von ihrem Sohn angekleidet und geschminkt wird und dann als Püppchen in einen Sessel sitzt, wo der Sohn mit ihr redet, während er seine Kunden frisiert. Die stirbt im Laufe des Geschehens und im dritten Teil geht es, sowohl in das Intstituo Basilo, wo Celio wieder seiner Nutter begegnen will, als auch zu einer Frau und ihren Katzen.
Teresa und ihre Madonna taucht wieder auf und in dem Buch gibt es auch immer wieder experimentelle graphische Gestaltung, Buchstabenspiele, Räseln, seitenlang das selbe Wort, Fots, etcetera und Maria Cecilias Barbettas Sprache ist sowohl überbordend bis zum Kitsch und läßt dann wieder aufhorchen durch neue Phrasen und Wortwendungen, so daß es sehr schön ist, durch das Buch zu gleiten, auch wenn man nicht sehr viel versteht und ich auch denke, daß die armen Leute in den Siebzigerjahren am Vorabend der Militärdiktatur vielleicht ein wenig weniger mystischer waren.
Aber was weiß man schon genau, Lateinamerika ist bekannt für seinen phantastischen Realismus und, daß der in der Diaspora sich vielleicht besonders schön entwickeln kann, kann ich mir auch vorstellen.