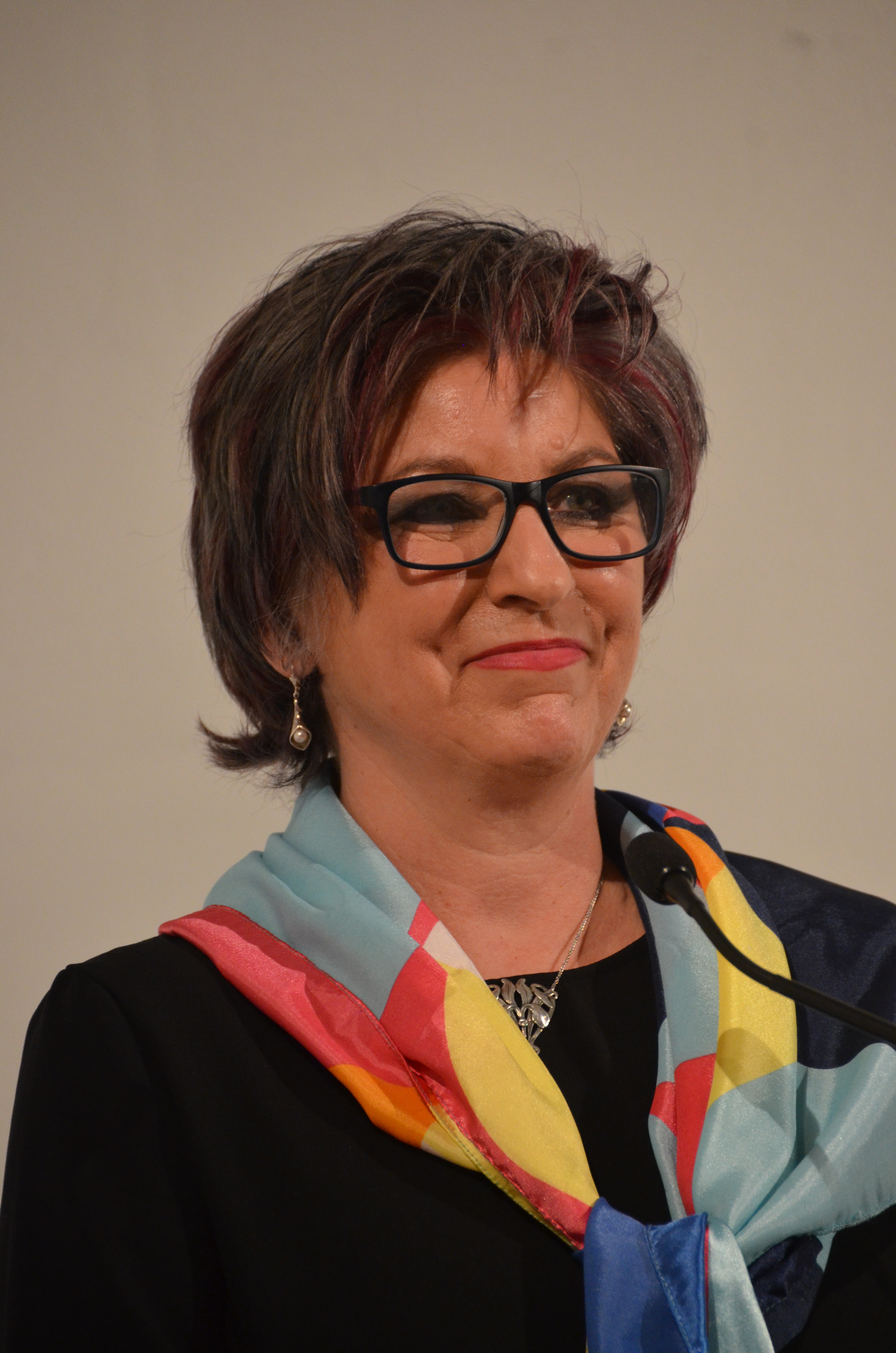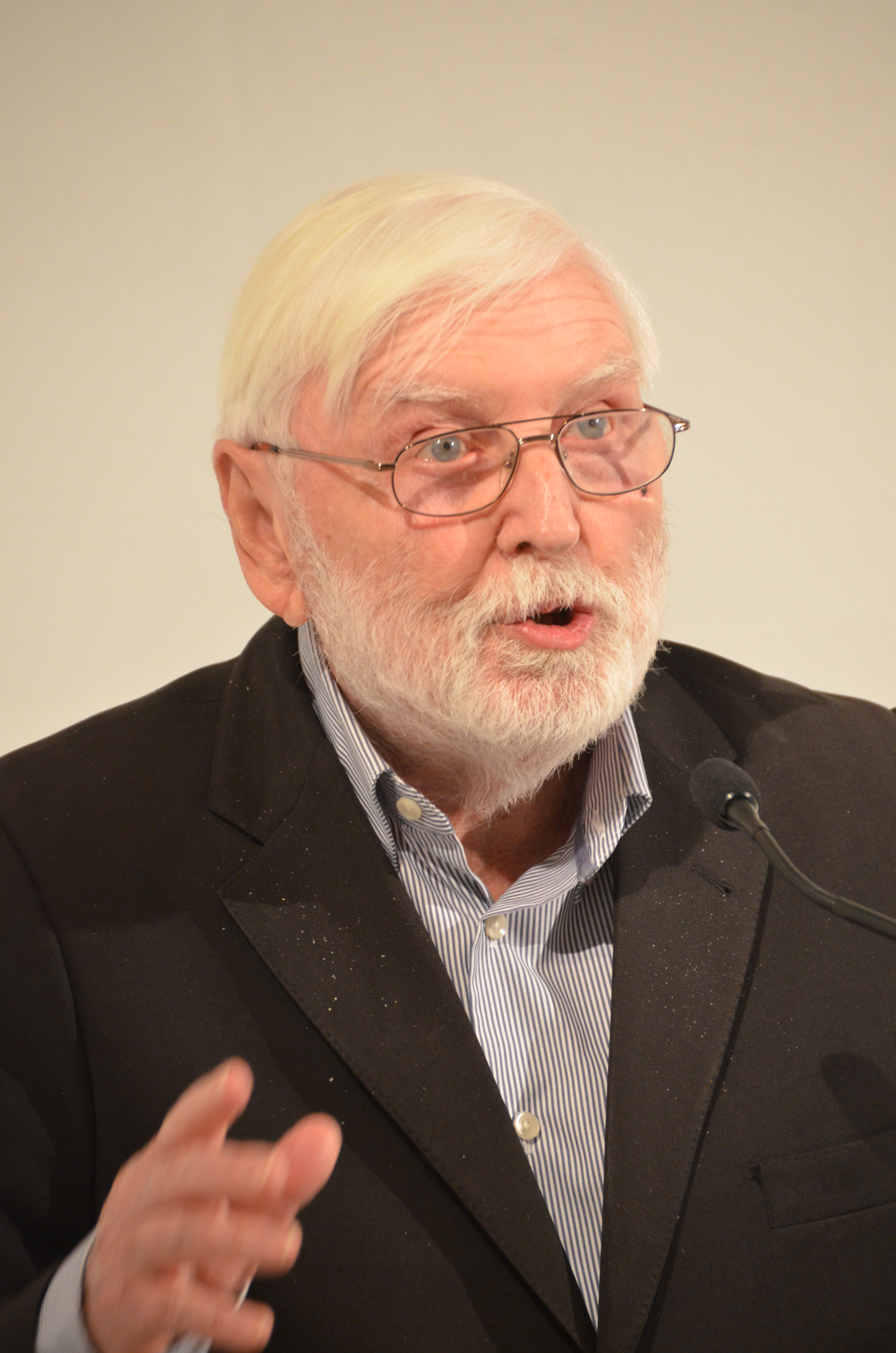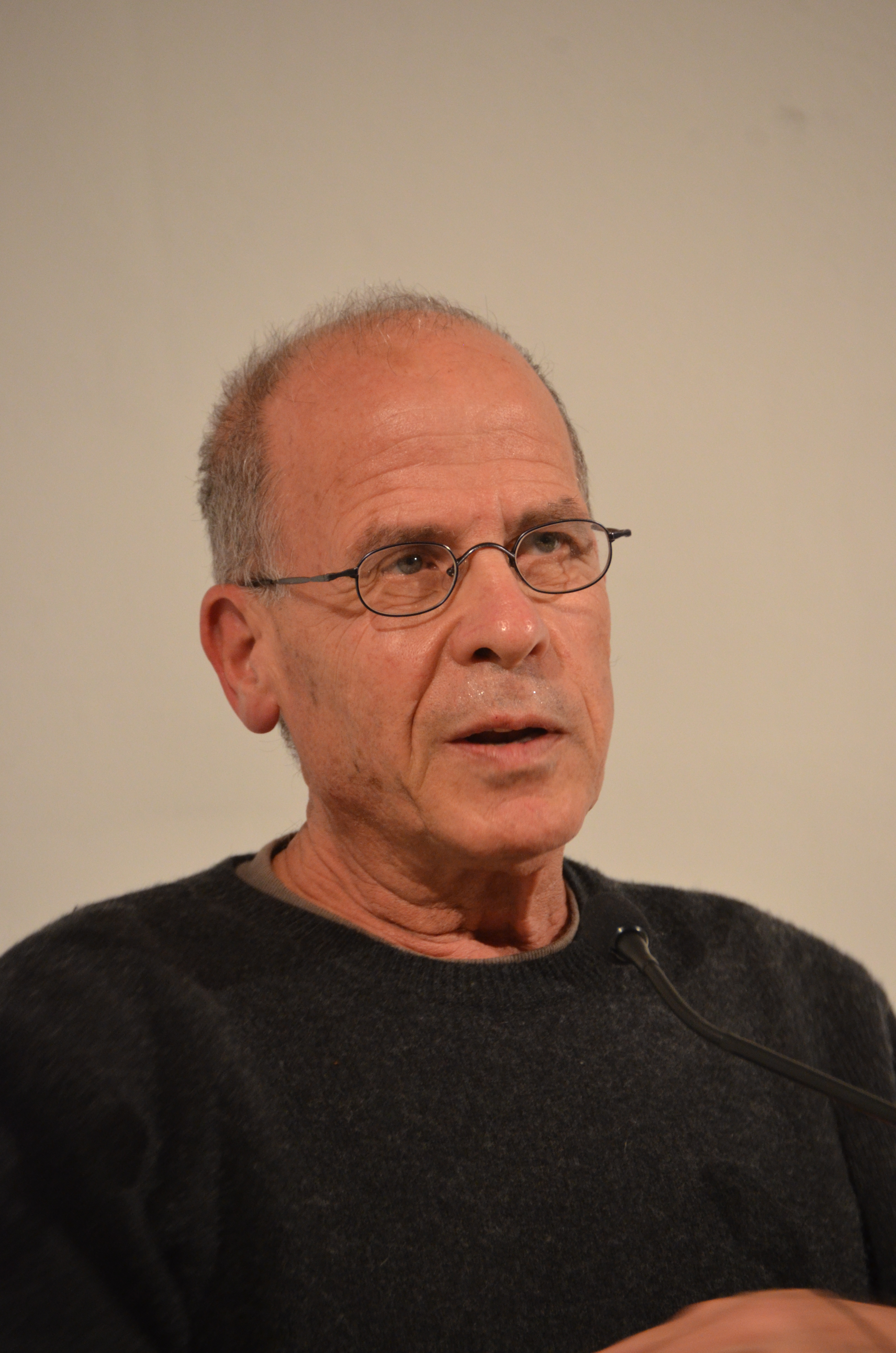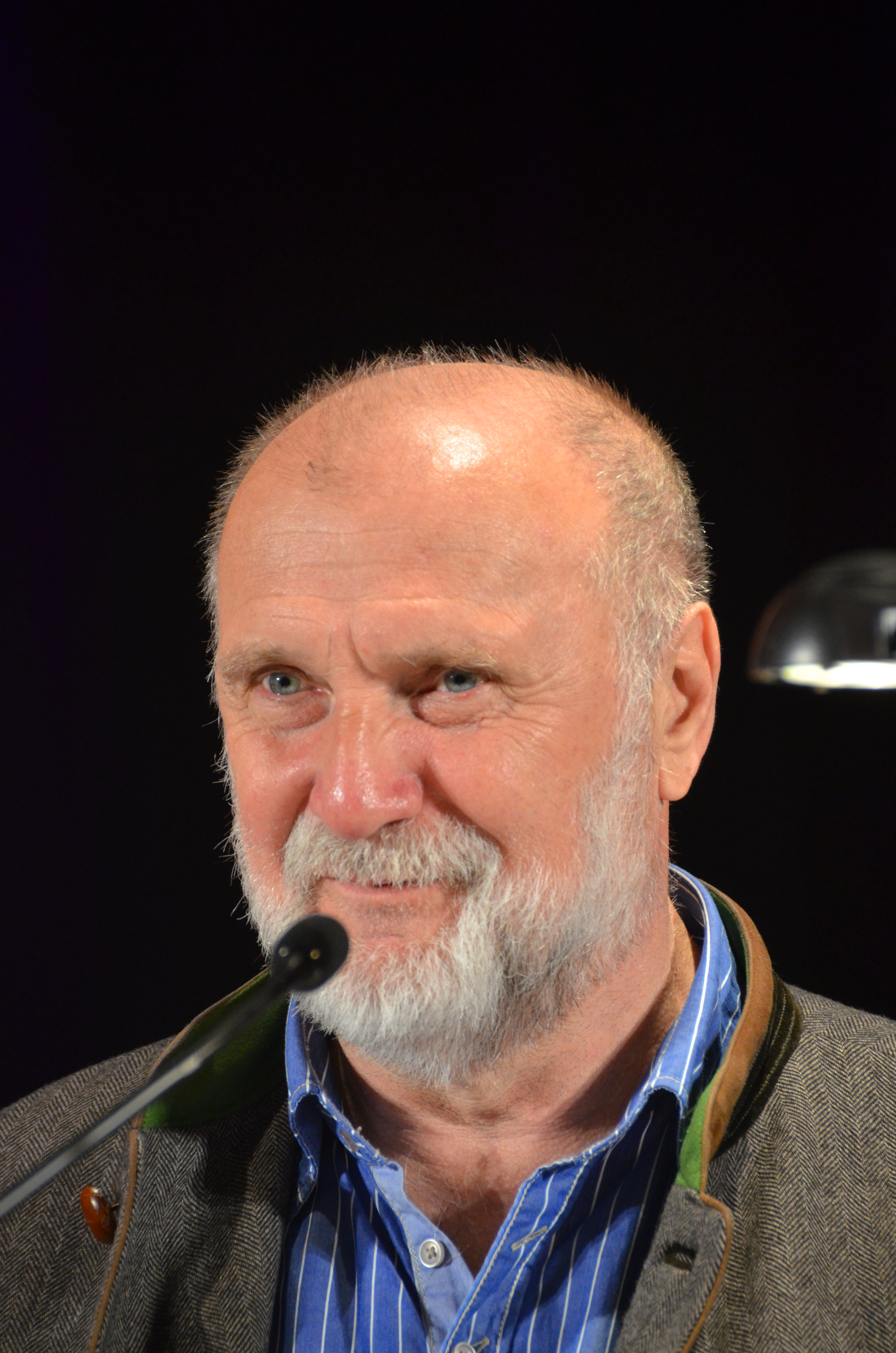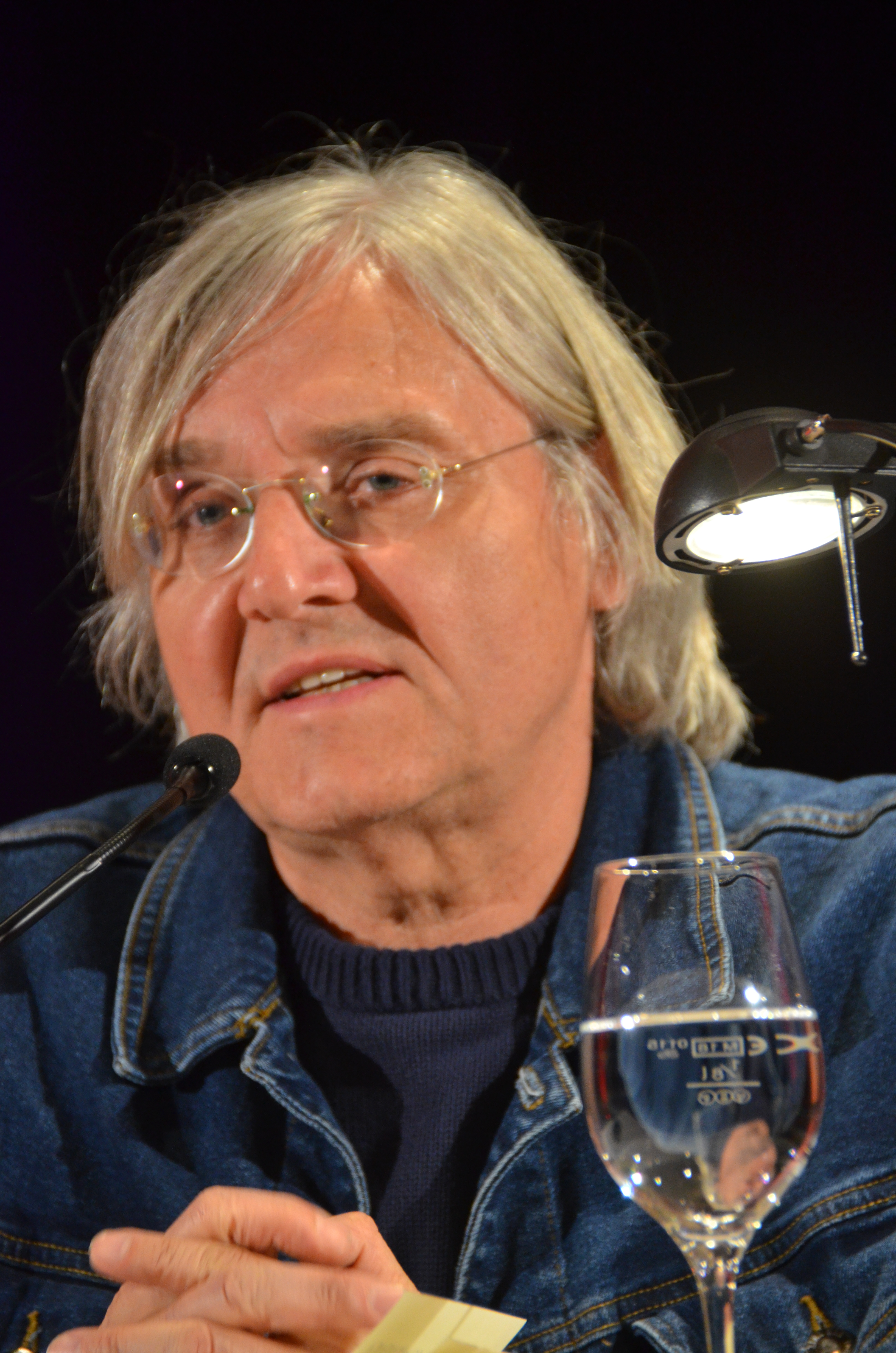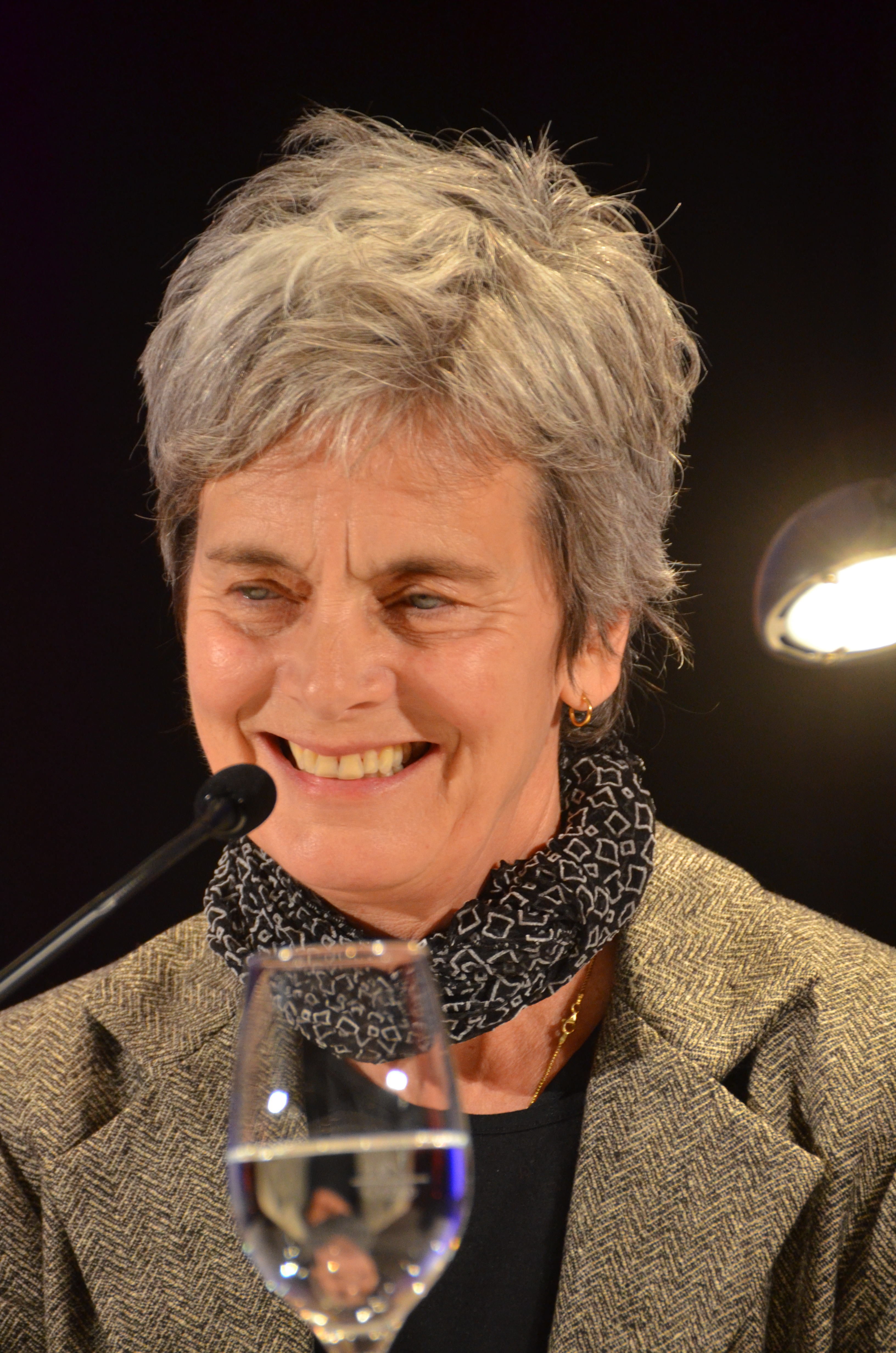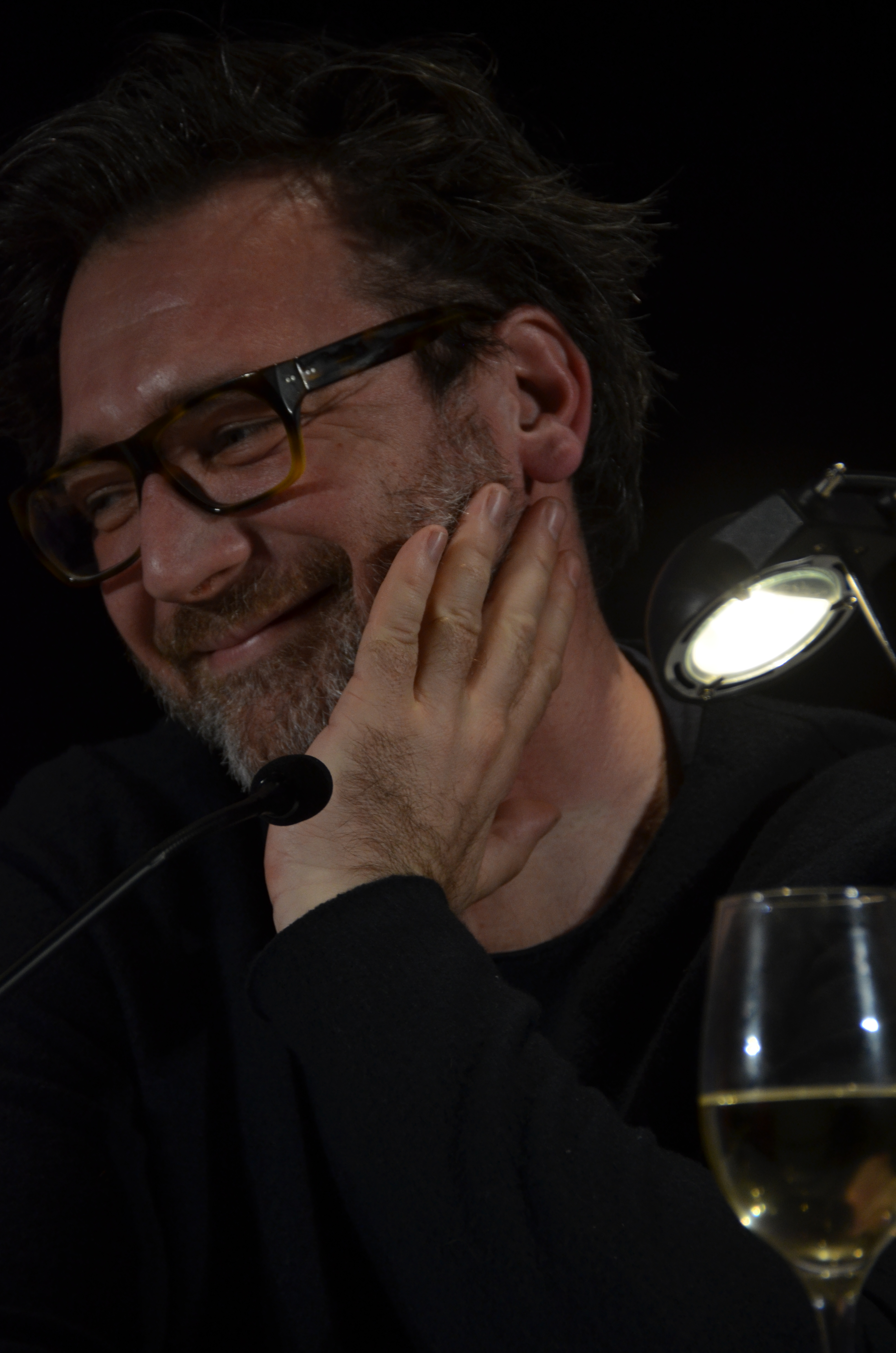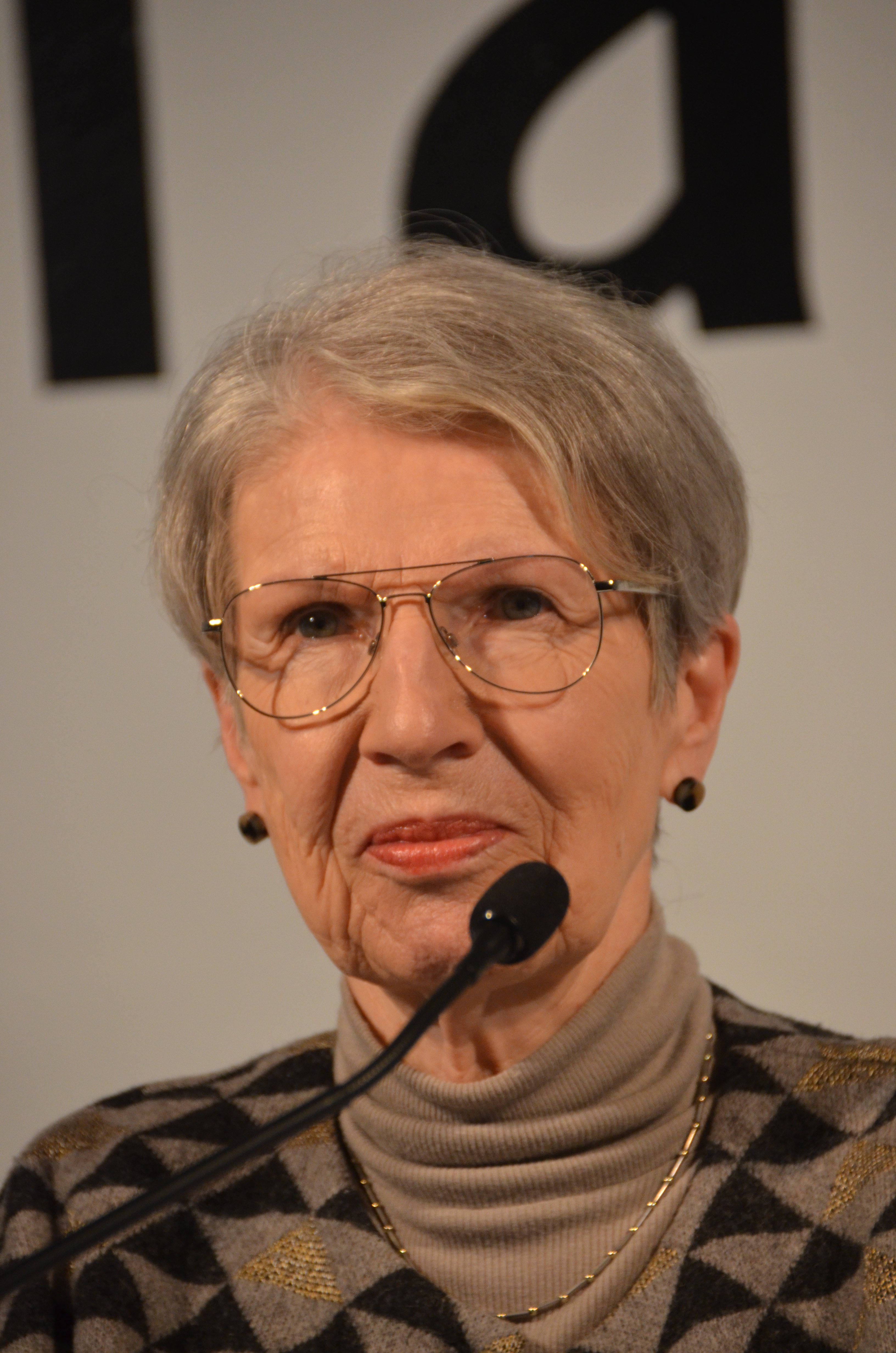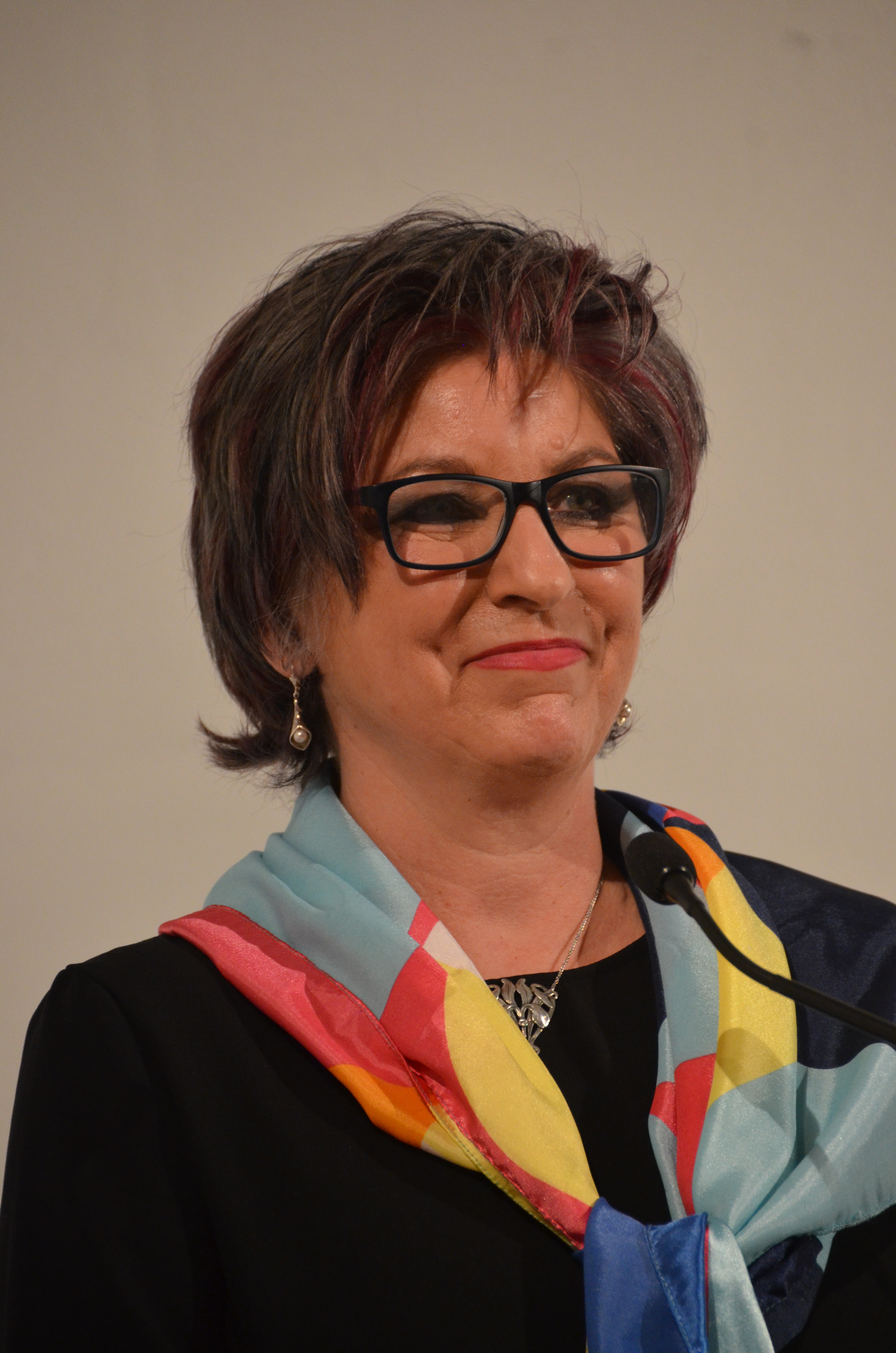
Sylvia Treudl
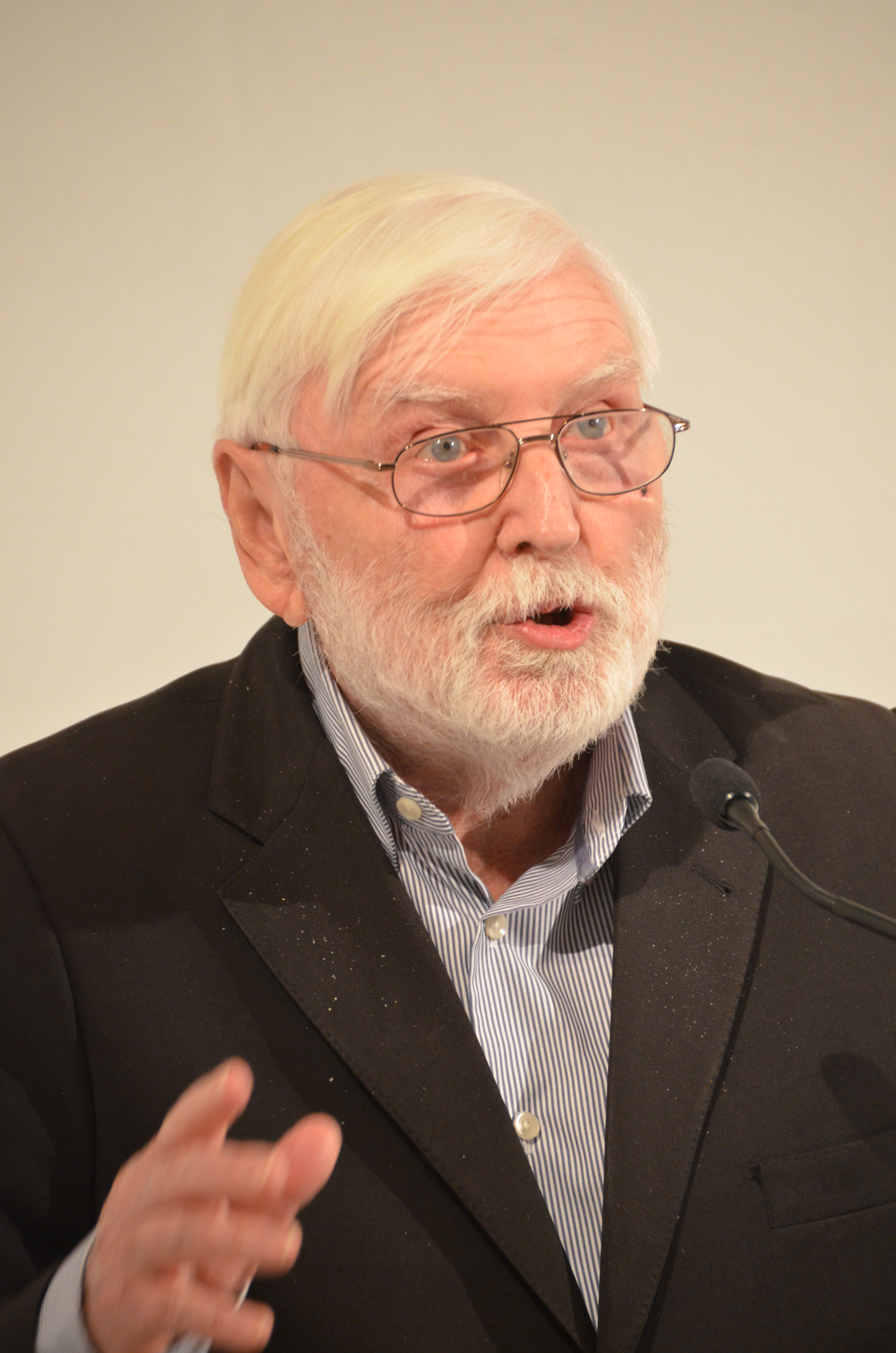
Bora Cosic
Ein vorläufiges Ende meiner Veranstaltungspause machte ich, wie angekündigt, mit dem einundzwangisten „Literatur und Wein-Festival“ in Krems und Göttweig, für das Alfred, glaube ich, jetzt schon das siebente Mal Karten kaufte und so sind wir am Donnerstag nach fünf wieder nach Krems hinausgefahren, wo das niederösterreichische Kunstmuseum das ja im vorigen Jahr noch gebaut wurde und die Zufahrt leicht behinderte, inzwischen fertig ist.
Nach vier Wochen Veranstaltungsabstinenz also wieder hinein in das Vergnügen und eine andere Veränderung gab es auch, wurde der Wein aus dem Kamptal ja diesmal direkt im Veranstaltungsraum und nicht wie früher im Foyer dargeboten und die Eröffnungsveranstaltung war, wie man vielleicht sagen kann, zwei älteren internationalen Dichtern gewidmet, von denen ich von beiden jeweils schon etwas gelesen habe.
Sylvia Treudl eröffnete wie immer und stellte Bora Cosic und Meir Shalev vor und von dem 1932 in Zagreb geborenen Bora Cosic habe ich ja während unseres Kroatienurlaubs in Montenegro seinen, wie Sylvia Treudl erwähnte Kultroman „Die Rolle meiner Familie bei der Weltrevolution“ gelesen.
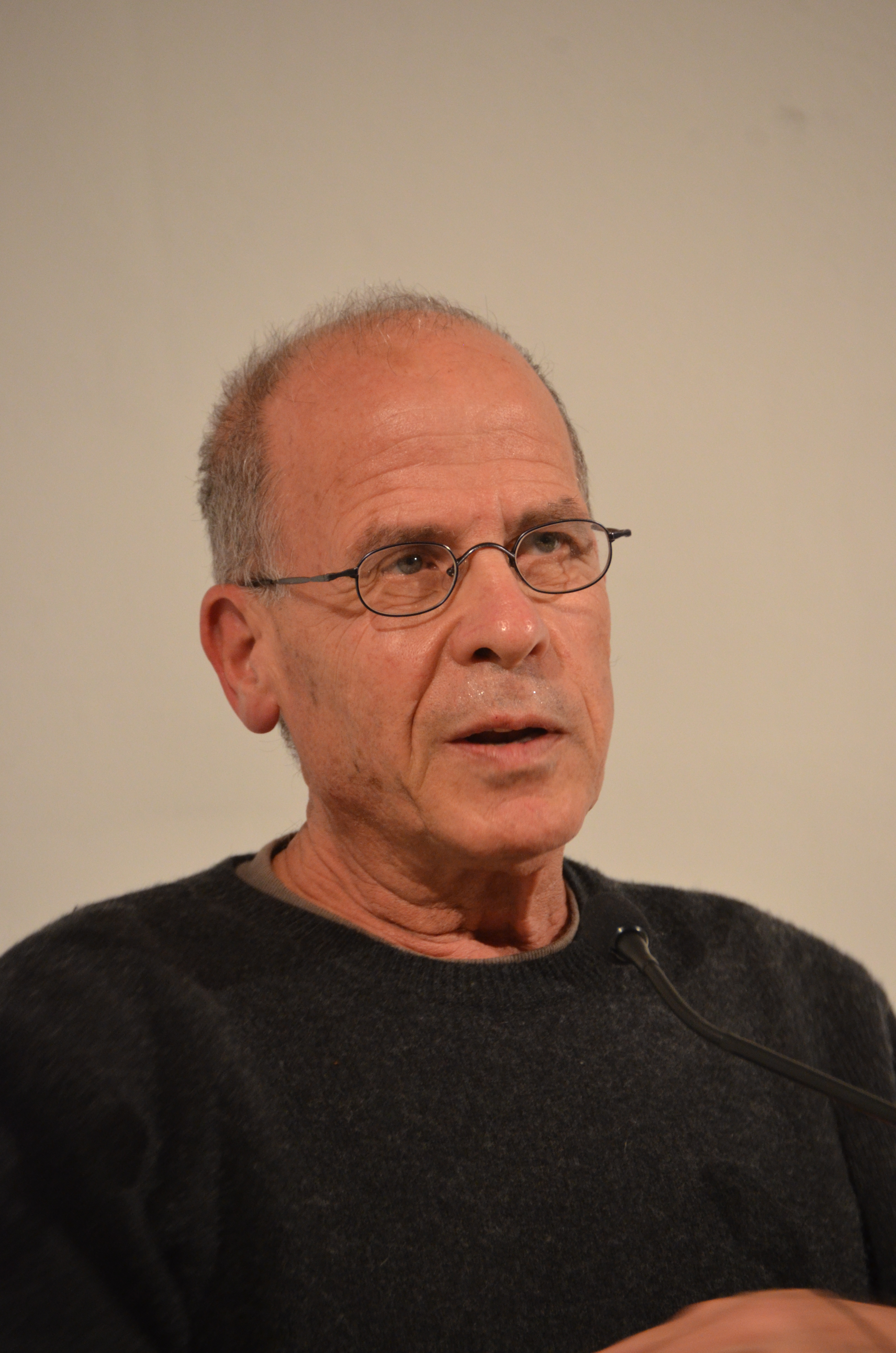
Meir Shalev
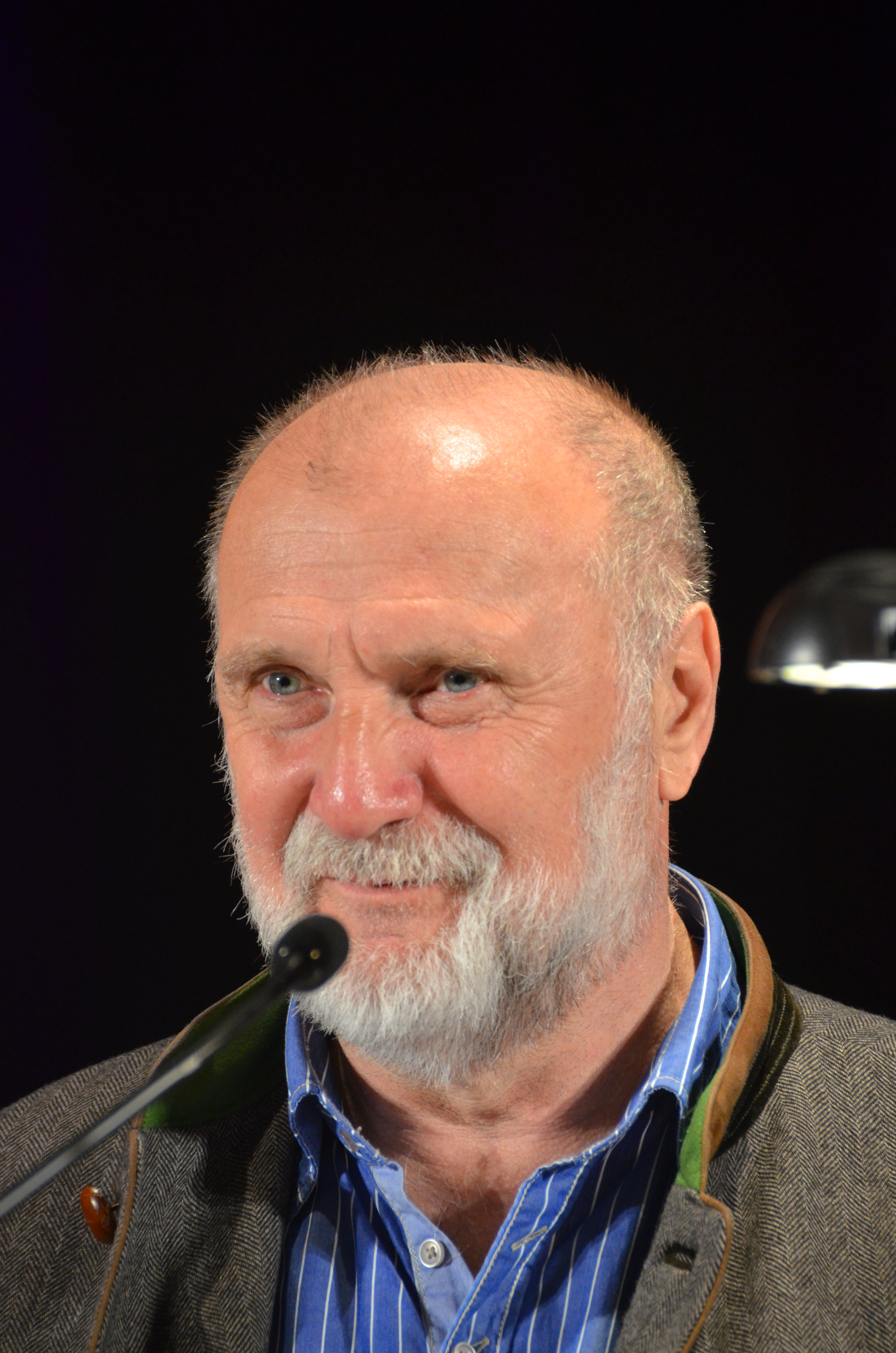
Dzevad Karahasan
Jetzt hat er ein Buch über das Reisen, das halbe Thema der heurigen Veranstaltung, geschrieben und zwar eines wo er durch Österreich und durch Italien reist und wenn man in Krems ist und die Doanu hinuntergefahren ist, werden natürlich diese Stellen gelesen, wo Krems, Göttweig und St. Pölten vorkommen.
Bora Cosic hat ein Stück auf Kroatisch und Christoph Mauz, wie immer die Übersetzung gelesen und von dem 1948 in Israel geborenen Meir Shalev, den ich, glaube ich schon einmal auf der „Buch-Wien“ hörte, habe ich „Judiths Liebe“ gelesen und er hat jetzt ein Erinnerungsbuch, die andere Themenhälfte geschrieben, wo es um seine Familie, seine Großmutter und ihren amerikanischen Staubsauger geht und wo dann er, beziehungsweise Christoph Mauz die Stellen lasen, wo der Erzähler mit roten Zehennägel, die ihm seine kleinen Nichten angemalt haben, zu einer Ausstellungseröffnung geht und sich dann an seine Großmutter erinnert, die mit ihren Staubsauer und ihren Putzlappen immer sehr viel reinigte und deren Klo man nie benutzen durfte, weil dort die Pflaumenkuchen zum Auskühlen standen.

Jaroslav Rudis
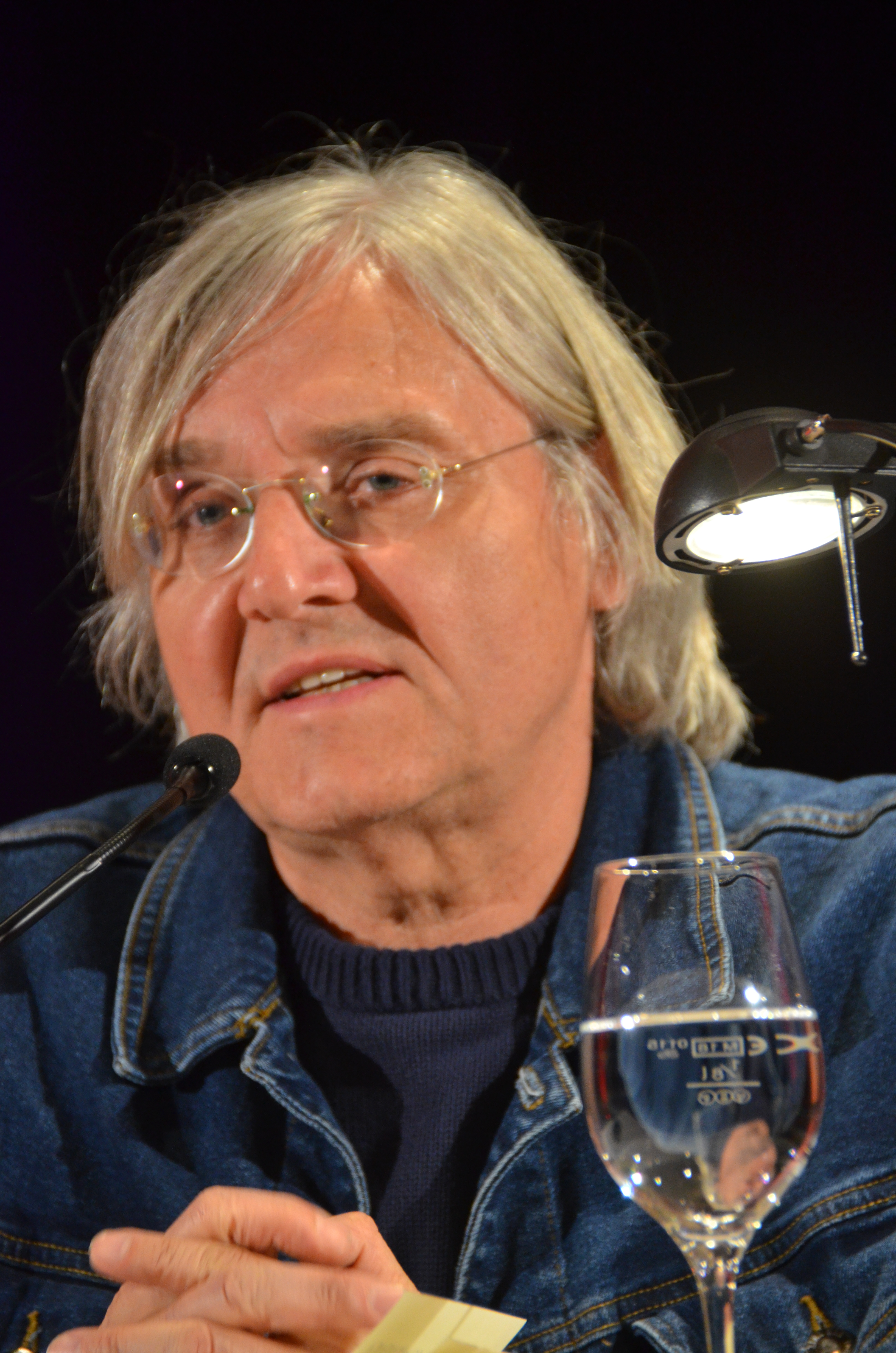
Erich Hackl
Am Freitag ging es in Göttweig weiter, wo der 1953 geborene bosnische Autor Dzevad Karahasan mit seinem „Erinnerungsbuch“ „Ein Haus für die Müden“, begann, das in das zwanzigste Jahrhundert, beziehungsweise in den ersten Weltkrieg zurück geht, wo Briefe von Baden bei Wien nach Sarajewo aus Schuld eines Briefträgers vierzehn Monate brauchten, bis sie ankamen.
Das nächste Buch nämlich Jaroslav Rudis „Winterbergs letzte Reise“, über das ich bei meinem Leipzig Surfing ja schon einiges hörte, geht auch in die Vergangenheit, nämlich bis in die Schlacht von Köngisgrätz zurück, beziehungsweise reist der Herr Winterberg mit seinem Altenbetreuer, glaube ich, auch bis nach Sarajewo, mache aber in Wien Station, wo er die Kapuzinergruft und noch einige andere Orte besuchte.
In der Pause versuchte ich dann in das Sommerreflektiorium und zu den Weinen, die diesmal, glaube, ich die gesamte niederösterreichische Region umfassten und wieder von den Winzern vorgestellt wurde, zu gelangen, was mit dem am Morgen ausgewechselten neuen Gips ein wenig angstrengend war. Der Zweigelt und der Pinot Noir schmeckten aber gut.
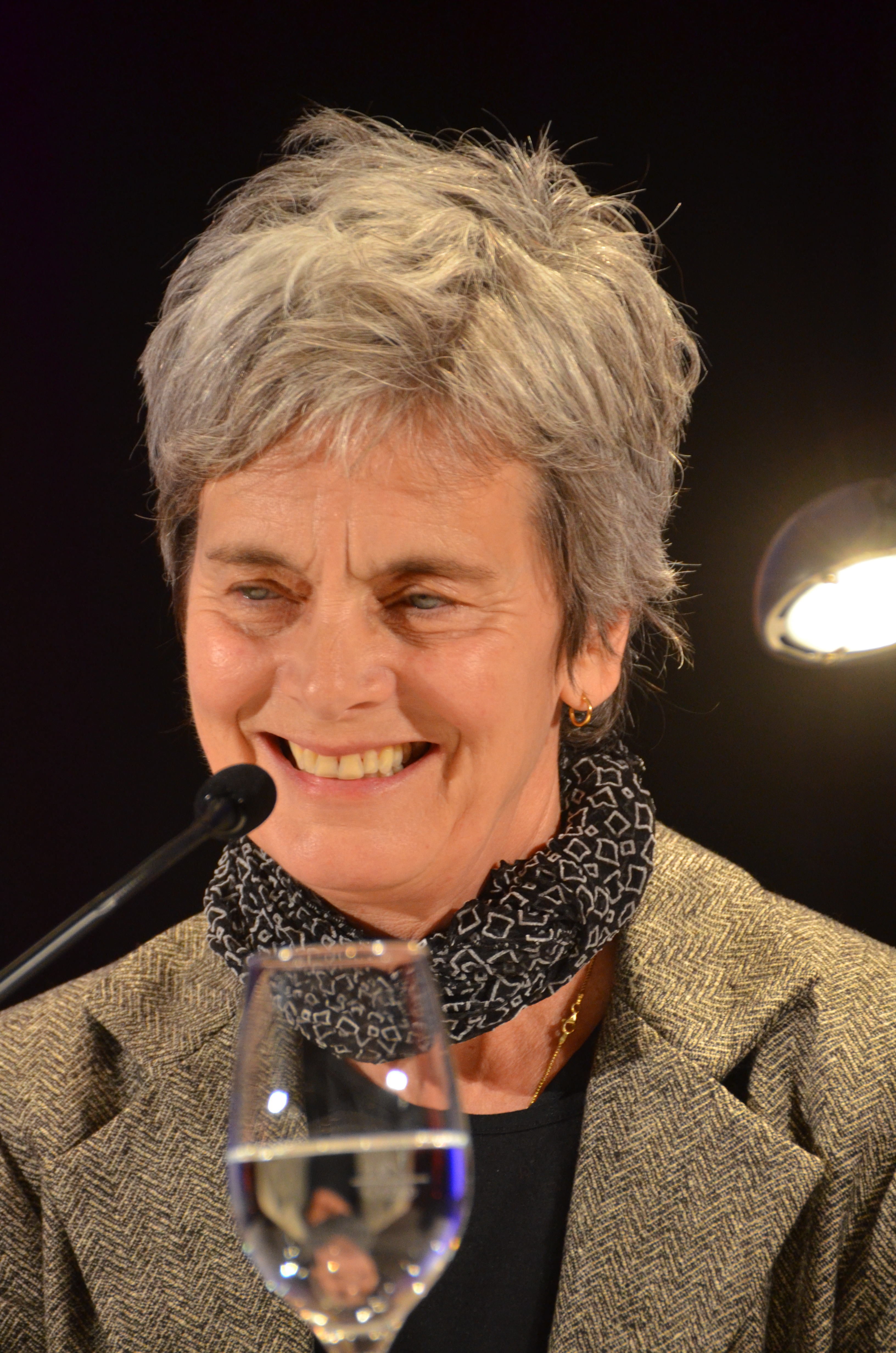
Christina Viragh
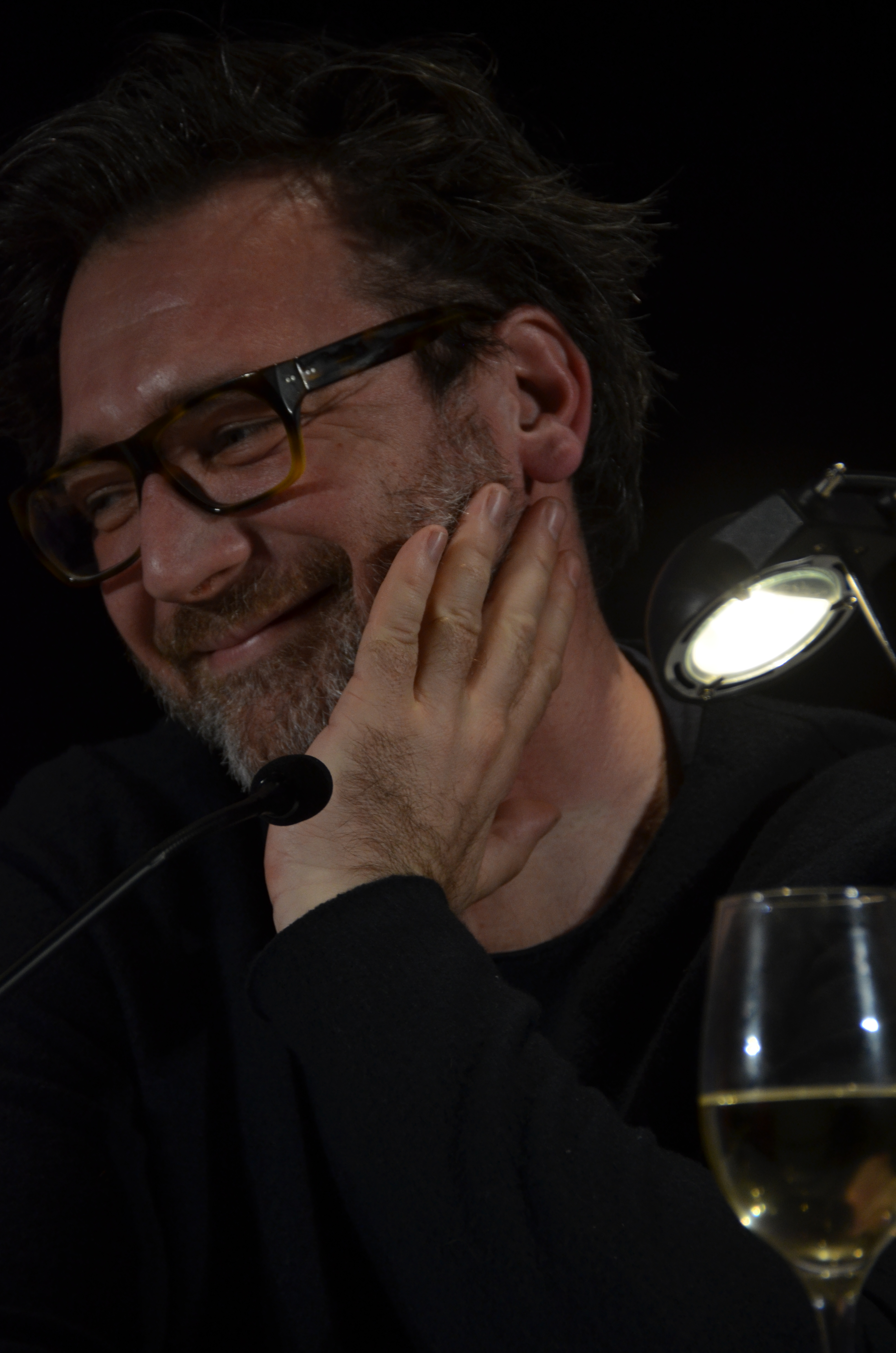
David Schalko
Aus Erich Hackls „Am Seil“ habe ich ja schon im Literaturhaus gehört, während das Buch der Christina Viragh in dem es wieder um das Reisen, nämlich um einen Flug nach Zürich geht, wo einer das ganze Flugzeug mit seinen Geschichten unterhält, obwohl es mir versprochen wurde, weilauf der 2018 Longlist des dBp stehend, nicht zu mir gekommen ist, so daß ich es jetzt über die <lesung kennenlernen konnte.
Die musikalischen Einlage stammten wieder von Roland Neuwirth, der diesmal mit dem radio string quartett, auftrat und diesmal nur zwei Sessions hatte. Die zweite haben wir versäumt, weil schon zu erschöpft, vorher aber wieder David Schalko aus seinen „Schweren Knochen“ gehört.
Am Samstag ging es dann mit der „Transflair-Reihe“, die von Klaus Zeyringer moderiert wurde, weiter, die diesemal ein sehr aktuelles Thema, nämlich „Frauen, Ohnmacht, Macht“ hatte, habe ich da ja vor kurzem auch einige Bücher gelesen, die „Zib-Moderatorin“ Lou Lorenz-Dittelbacher hat aber auch eines dazu geschrieben und hat da acht ehemalige Politikerinnen interviewt und zu ihrer Situation befragt. Das diskutierte sie mit dem stellvertretenden Spiegel-Chef Dirk Kurbjuweit, der auch als Autor tätig ist.
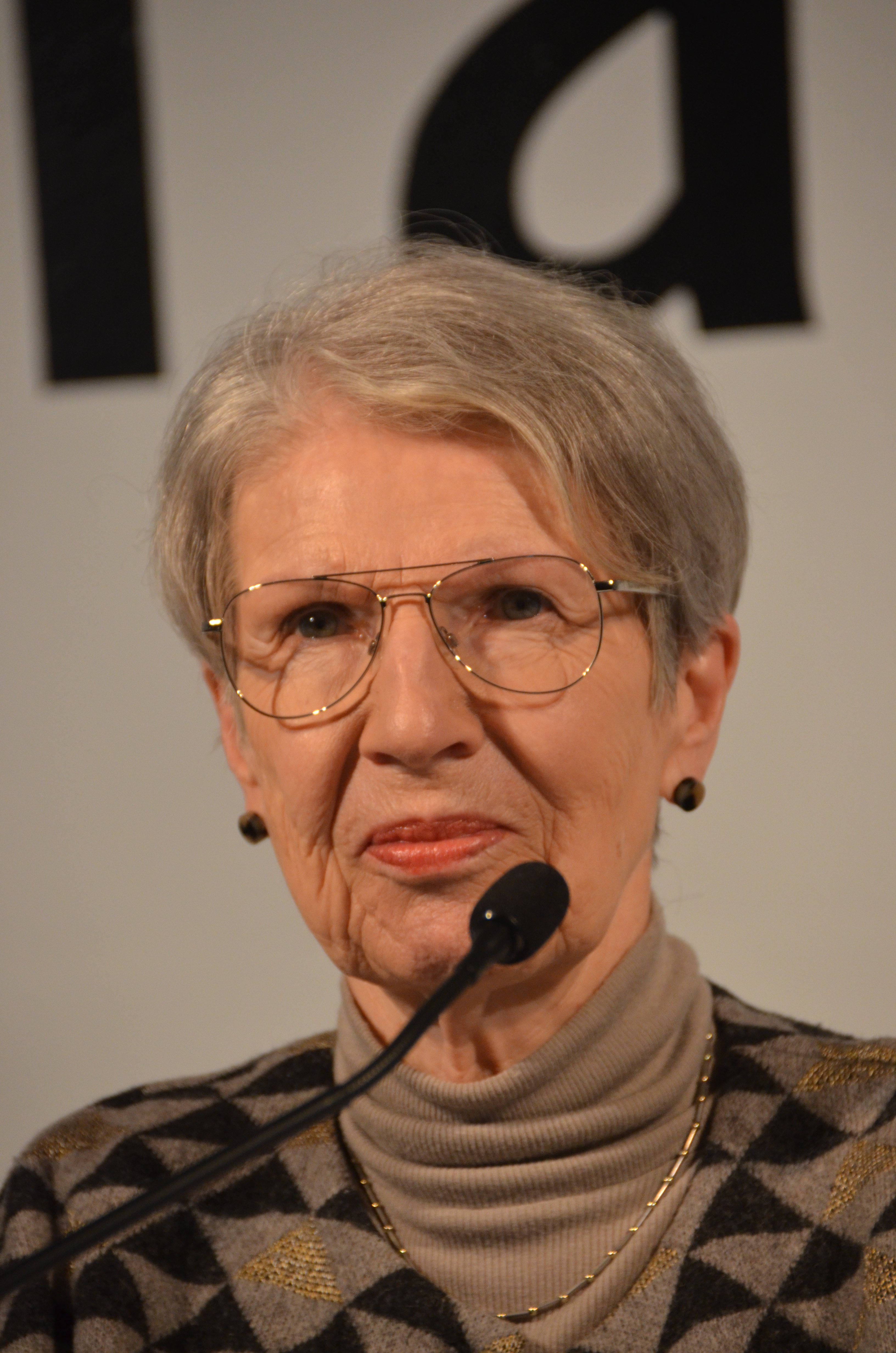
Barbara Frischmuth

Julian Schutting
Dann war Mittagspause und da bin ich ja meistens nach Krems gegangen und habe mir dort beim „Nordsee“ ein Fisch-Weckerl gekauft. Vor zwei Jahren habe ich in dem Gasthaus gegessen, wo das Alternativprogramm stattgefunden hat und diesmal wollte ich eigentlich in das Restaurant bei der Schifflandestation an der Donau gehen, habe aber gesehen, daß es dort, wo es einmal das Gasthaus zur „Stadt Krems“ gegeben hat und jetzt die neue Kunsthalle steht, auch ein Restaurant gibt, habe dort eine Leber gegessen und wollte dazu einen roten Spritzer trinken. Was dann kam, ist eigentlich Wert ein Stück Literatur daraus zu machen. Es kam nämlich ein weißer Spritzer, ich grinke aber keinen Weißwein, die Kellnerin war ein wenig ungehalten, sagte, es gäbe keinen roten Spritzer, also was anderes, haben sie einen „Hugo“ habe ich gefragt, aber das ist auch ein Wißwein, hat sie geantwortet, den trinke ich aber nur in der süßen Holunderform und eigentlich mit Prosecco.
Es kam dann von der Kellnerin bei der ich bestellt habe, ein Aperol Spritz, „Also gut, dann bringen Sie mir ein Achter rot und ein Glas Wasser!“, habe ich gesagt, weil ich auf der Karte gesehen habe, daß es das gibt, roter Spritzer tatsächlich nicht. Sie hat mir dann wahrscheinlich in den weißen Spritzer eine Zitronenscheibe und einen schwarzen Strohhalm gegeben und beim Bezahlen gesagt, daß es eigentlich schon roten Spritzer gäbe, dann zurück ins Literaturhaus, zwar nicht zur Wanderung, das geht mit Gips doch nicht, obwohl das andere eigentlich erstaunlich gut funktionierte.

Antonio Fian

Wienerblond
Also mit dem Lift in den zweiten Stock gefahren, wo diesmal das Alternativprogramm abgespult wurde. Da gab es schon am Vormittag die „Wo Lyrik zu Hause-Reihe“ wo es ja auch immer die kleinen bunten Hefterln gibt, die zur freien Entnahme aufliegen oder auch bei den Goodies waren ist, die im Festivalpaß enthalten sind.
Da wurden diesmal Vladimir Durisic aus Montenegro, Eleaor Rees aus GB, Marija Andrijasevic aus Kroatien und Jakobe Mansztajn aus Polen vorgestellt und am Nachmittag gab es dann „Dichtung entdecken, wo Christoph W. Bauer, die derzeitge Writerin in Residence die Serbin Sofia Zivkovic, Sabine Gruber, Julian Schutting und Kathrin Schmidt vorstellte, die jeweils aus ihren Werken lasen.
Das hat etwa eine Stunde gedauert, wahrscheinlich so wie die Wanderung, die schon eine halbe Stunde früher weggegangen ist, so daß ich noch bequeum in den Veranstaltungssaal kam, wo die Lesung mit Lorenz Langenegger, der eigentlich aus Zürich ist, aber in Wien zu leben scheint, weil ich ihn sehr oft bei Veranstaltungen sehe, gerade begonnen hat.
Das heißt Sylvia Treudl stellte gerade ihn und seinen Krimi um einen Polizisten namens Wattenhofer, der eigentlich keiner ist, vor und Lorenz Langenegger hat zuerst zum Thema passend aus den zwei Bücher gelesen, die ich auch gelesen habe und dann ein Stück aus „Dorffrieden“ was ich sehr interessant fand.

Verena Doublier

Sebastian Radon
Dann gab es Wein zu verkosten, allerdings wieder nur weißen, also habe ich mich zuerst in das Foyer und dann in den kleinen Park wo es das Denkmal bezüglich „April in Stein“ gibt, gesetzt und mein aktuelles Buch gelesen, bis der Bus kam, der mich nach Göttweig brachte.
Der Alfred ist diesmal erst um acht gekommen, weil er in Wien bei einer Besprechung wegen seiner Kuba-Reise war, die ja bald stattfindet und in Göttweig hat es mit Hans Platzgumer, von dem ich ja „Am Rand“ gelesen habe angefangen.
Jetzt hat er ein neues Buch, das „Drei Sekunden jetzt“ heißt und von zwei Findelkindern handelt. Dann kam Barbara Frischmuth und von der wurde ja nicht nur ihr altes „Macht nix“ aufgelegt, sie hat auch ein Erinnerungsbuch, das „Verschüttete Milch“ heißt und von einem Kind handelt, das im Ausseerland in einem Hotel aufwächst und weil niemand Zeit hat, sich mit ihm zu beschäftigten mit Geistern und mit Elfen spricht, bis es dann in die Klosterschule kommt.
Sehr bekannt also, während mir der Schweizer Schriftsteller Klaus März dessen Buch „fima“ heißt, höchstens vom namen bekannt war. Karl Markus Gauss habe ich dagegen gekannt und er hat etwas gemacht, was, glaube ich, sowohl Ilse Kilic, als auch ich selber schon machte. Er hat sich mit den ganz banalen Gegenständen in seinem Zimmer beschäftigt und die beschrieben. Das heißt er hat von seiner Wohnung und seinen Büchern gelesen, er hat auch ungefähr zehntausend Stück und gibt sie wie ich nicht mehr her und dann davon, daß er aus den Hotels in denen er logiert immer die Duschhauben mitnimmt und sie sammelt.
Sehr interessant, dann kam Ernst Molden mit seinerm „Frauenorchester“ und danach wäre Natascha Wodin gekommen, die ja im vorigen Jahr den „Leipziger- Buchpreis“ bekommen hat. Der Alfred war auch schon da und so sind wir noch in der Pause und nach einem Glas Wein, es bleiben uns diesmal die Gutscheine über, zurückgefahren, weil das Ganze nach vier Wochen Abstinenz doch sehr anstrend ist und ich auch noch bloggen mußte.
Am Sonntag ging es aber gleich weiter mit der berühmten Sektmatinee im Literaturhaus, diesmal mit einem jungen und mir bisher unbekannten Musikduo „Wiener Blond“, das heißt Verena Doublier und Sebastian Radon, die moderne frische Wiener-Lieder gesungen haben und sich mit dem Publikum darum duellierten, ob die schönste Stadt an der Donau nach Krems nun Linz oder Wien wäre?
Darüber kann man sicher streiten und die Wiener sehen, das wahrscheinlich anders, als es die Linzer sehen, es gab aber auch einen Literaturblock, beziehungwweise außer den „Wo Lyrik zu Hause ist-Hefterln“, die Sonderpublikation „Herbst in der Nußschale“, mit Texten von Barbara Frischmuth und Julian Schutting, die diese verlesen haben.
Danach ist wieder der „Priessnitzpreisträger“ Antonio Fian auf die Bühne gekommen und hat sich durch Werner Koflers Werkauswahl, die neu herausgegeben wird, gelesen und an den 2011 verstorbenen Kärntner Dichter Werner Kofler erinnert, mit dem er früher gemeinsam aufgetreten ist, beziehungsweise, wie er es bezeichnet, als sein Sekretär tätig war.
Danach drang wieder Sylvia Treudls Stimme aus dem Off, die allen „Schöne Ostern!“, wünschte, sowie das einundzwanzigste „Literatur und Wein Festival“ für beendet erklärte und wir sind wieder in das NÖ-Kunsthaus-Beisl gegangen, wo ich feststellen mußte, daß es trotz anderslautender Versicherung im schönen Weinland Krems doch keinen roten Gspritzen, sondern nur ein Achtel Rot, um vier Euro achtzig gab, was aber nicht wirklich etwas machte, haben sich Verena Doubler und Sebastian Radon in ihrer Zugabe doch ohnehin über die Winer Marotte, sich den guten Wein mit Soda oder Mineralwasser zu verdünnen, lustig gemacht, mich aber zu einem Text veranlaßen wird, den man demnächst hier lesen kann.