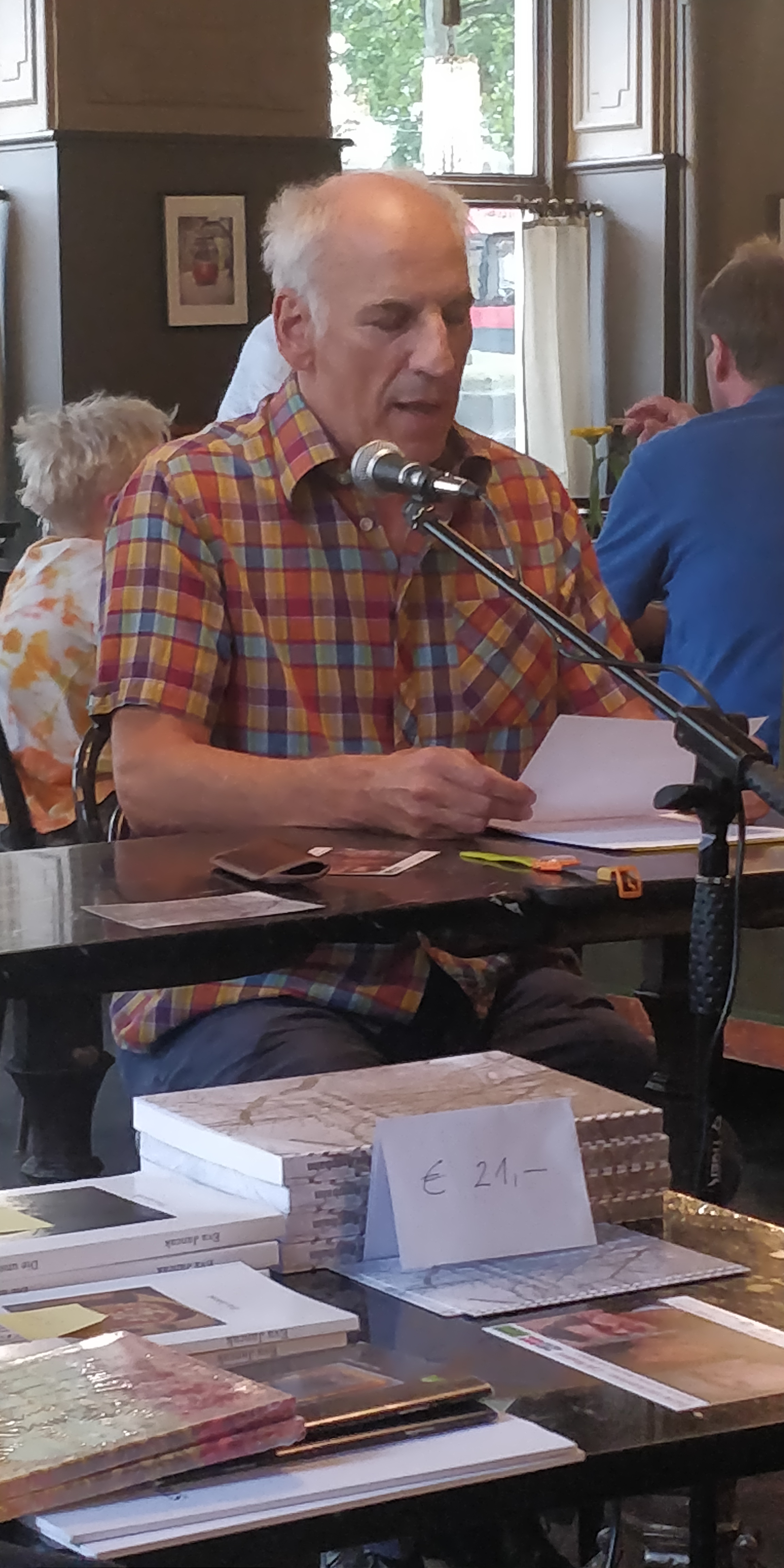Zwischen dem Neuerscheinungslesen jetzt schnell noch ein altes Buchpreisbuch eingeschoben, denn das stand ja auf meiner 2019 Backliste und, daß ich vielleicht die alten Buchpreisbücher, die sich inzwischen angesammelt haben, lesen will, das habe ich mir ja auch vorgenommen. Sibylle Lewitscharoff „Consummatus“, ein Longlistbuch von 2006 und ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob es aus den Schränken oder einer Abverkaufskiste stammt, war doch eine „Morawa-Rechnung“ zwischen den Seiten eingeklemmt, ich dachte aber, ich hätte es aus dem Schrank.
Von der 1954 in Stuttgart geborenen Sibylle Lewitscharoff, die 2013 den „Büchner-Preis“ bekommen hat, habe ich schon einiges gelesen und kennen tue ich sie, glaube ich, seit ihrem „Bachmannpreislesen“,1998.
„Montgomery“ habe ich von den Büchertürmen der „Literatur im März“, das habe ich gelesen und, glaube ich, nicht sehr verstanden, denn Sibylle Lewitscharoff ist ja eine sehr komplizierte Schriftstellerin, die kunstvoll mit der Sprache spielt und dabei auch manchmal übertreibt oder sie da mit den „halben Kindern“ oder den „Selbstmördern“ auch manchmal übers Ziel hinausschießt.
In dem vorliegenden Buch gibt es auch so eine Stelle:
„Man sollte die Sträflinge wieder in Ketten schließen, um ihnen wieder die Würde zurückzugeben“, heißt es da doch auf Seite vierundfünzig und da könnte ich genauso ein Fragezeichen machen, wie ich auch eines ans Ende des Buches gesetzt habe.
Aber wieder schön der Reihe nach, damit ich nicht zu unverständlich bin.
Sibyille Lewitscharoff die“ Büchner-Preisträgerin“ und „Preisträgerin des Leipziger Buchpreises“, stand auch noch 2015 und 2011 auf der deutschen Buchpreisliste, beide Bücher habe ich gelesen
Aus „Blumenberg“ stammt der Satz mit den Selbstmördern, auf der „Buch-Wien“ hat sie glaube ich laut verkundet, daß sie „Amazon“ nicht mag.
Gut, da ist sie nicht allein und das „Pfingstwunder“ hat mir sehr gut gefallen. Bei diesem Buch bin ich mir nicht so sicher, da würde ich zu dem Fragezeichen auch hinzusetzen „Was soll denn das, da ist die Phantasie doch zu weit durchgegangen und was wäre, wenn ich das geschrieben hätte?“
Dabei habe ich doch Bücher die im Himmel spielen und die Toten mit ihren Anverwandten reden, aber Sibillye Lewitscharoffs „Consummatus“, das nicht, wie ich annahm, vomKonsumieren kommt, sondern „Vollendet“ heißt spielt an einem Vormittag in einem Stuttgarter Cafe, wo ein Gymnasiallehrer sitzt, weiche Eier und Croissants verzeht, unzählige Tassen Kaffee konsumiert und sich außerdem noch mit Wodka betrinkt.
Dabei hält er einen Monolog auf seine Toten, das heißt eigentlich ist das ein Dialog, denn die Toten, seine Eltern, seine Geliebte, Andy Warhol und Jim Morrison sind auch in dem Cafe und reden munter zurück und damit man das in dem Buch auch gleich bemerkt, sind diese Stellen unterschiedlich stark ausgedruckt.
„Falls es Sie interessiert, was uns nach dem Tod erwartet und was Jim Morrison und Andy Warhol heute so treiben, kommen Sie um diesen Roman nicht herum. Und falls es Sie nicht interessiert, dann sind Sie wahrscheinlich schon tot und haben es nur noch nicht gemerkt“, hat der Literaturkritiker Denis Scheck auf das Buch schreiben lassen.
Und das klingt genauso gut, wie manche schöne Sätze in dem Buch, stimmt aber nicht, daß das darin vorkommt oder wir haben schon wieder zwei verschiedene Bücher gelesen.
Es geht um Gott und die Welt und vieles andere in dem Buch, dazwischen wird mit der Kellnerin geschäkert und dann geht es, ich muß noch erwähnen, daß der Handlungszeitraum mit dritter April datiert ist, in den Schnee hinaus.
der Betrunkene tappt sich durch die verschneite Landschaft und damit man das optisch gut erkennt, sind Schneeflocken in dem Buch eingezeichnet. Das war für mich ein bißchen schwer zu lesen und ich habe nicht sehr viel verstanden, als ich aber schon dachte „Aha, das ist die Vollendeung, er bleibt im Schnee liegen und geht heim zu seinen Vätern!“, kommt das Kapitel null zwei, da muß ich noch eine besondereheit erwähnen, die Kapitelüberschriften bestehen aus einem Quadarat, wo die Zahlen ein bis sechzehn durcheinander gewürfelt sind und das jeweilige Kapitel schwach ausgedruckt ist, zwei Nullkapitel gibt es auch, am Anfang und am Ende und bei diesem Kapitel hat Sibylle Lewitscharoff geschrieben: „Die Geschichte des Mannes, der seine Toten immer um sich hat, endet fröhlich. Wer will, kann ihm jetzt dabei zusehen, wie er die Stufen zu seinem geliebten Weinhaus hinaufsteigt, wie er nach Altherrenart ablegt und mit steifen Fingern nach dem Aufhänger sucht, um den Mantel am Garderobehaken zu versorgen, wie er sich noch einmal mit der Hand über den beperlten Stoff streicht, aus der Tasche ein Tuch zieht und sich das Gesicht damit abtupft, wie er sich nach dem Jenseitsberater im Eck umsieht, der ihm ein Bier zum Wohl entgegenhebt, wie plötzlich Leben in ihm kommt, er sich die Hände reibt und vergnügt nach der Kellnerin umdreht, die ein Schatz ist.“
Nun ja, könnte ich da sagen, das ist halt die große Literatur und Sibylle hat es sicher Spaß gemacht mit der Sprache zu spielen und vielleicht auch die Leser ein bißchen zum Narren zu halten. Das Meine ist es nicht gerade, ich mag es ja nicht so abgehoben und bleibe realistischer, auch wenn meine Geschichten im Himmel spielen.
Trotzdem bin ich nicht empört, schreie nicht „Pfui!“, habe nur ein paar Mal den Kopf geschüttelt, ein Fragezeichen gesetzt und eigentlich bin ich stolz, daß ich mich in Sibylle Lewitscharoff schon so gut eingelesen habe, denn von „Mongomery“ habe ich ja nicht soviel mitbekommen.