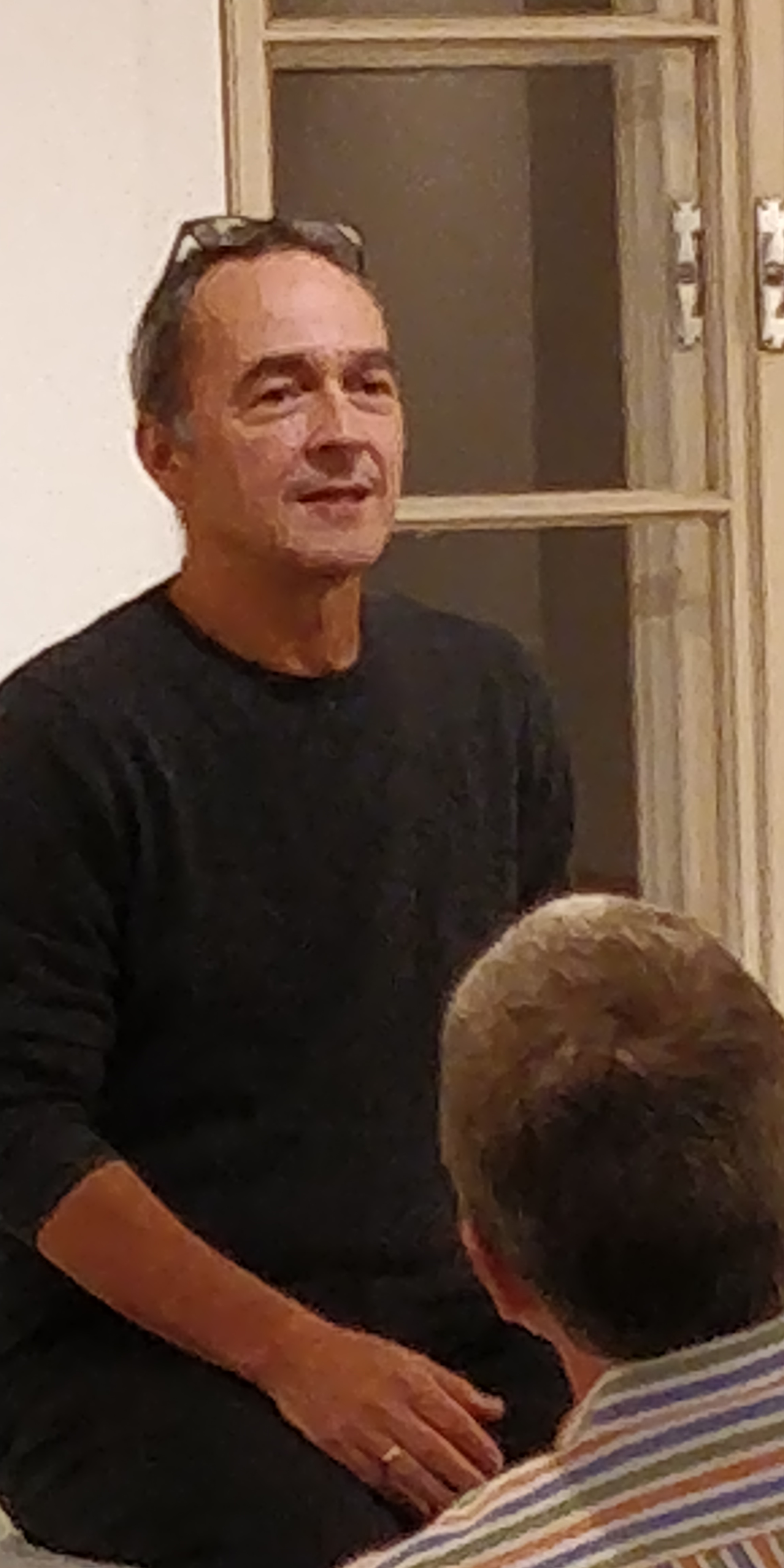Während sich die Literaturbegeisterten, Autoren, Blogger, Verleger, etcetera in Frankfurt tummeln oder sich vielleicht ein paar Unentwegte über das Netz auf das „Blaue Sofa“ setzen, bin ich ab Donnerstag in die Wien-Bibliothek in die Bartensteingasse gegangen, um mir dort das Internationale Symposium „H.C. Artmann und Berlin“ anzuhören.
Aufmerksame Leser, falls ich solche haben, werden jetzt vielleicht sagen, aber das gab es doch schon vor ein paar Jahren, daß du dorthin gepilgert bist und dir dort zwei Tage lang H. C. Artmann beziehungsweise seinen poetischen Akt angehört hast, beziehungsweise am Freitag früher weggegangen bist, um mit dem Alfred nach Göttweig hinauszufahren, wo, glaube ich, auch Rosa Pock, die Artmann Witwe, gelesen hat.
Ja, habe ich, aber H. C Artmann ist offenbar ein wichtiger österreichischer Autor, mit dem sich die Germanistik sehr beschäftigt, während sich die Lleute im Literaturcafe, was ich immer noch ein wenig seltsam finde, darüber streiten, ob Peter Handke eine Schlaftablette oder vielleicht doch ein würdiger Nobelpreisträger ist und es hat sich, glaube ich, auch seit dem ersten Symposium eine „H. C. Artmann Gesellschaft“ gegründet, die sich jetzt mit H. C. Artmanns Berliner Jahren beschäftigt, denn der H. C., der 1921 in Wien-Breitensee geborenen Hans Carl Artmann, da gab es auch noch ein Symposium in den Breitenseer-Lichtspielen, der im zweiten Weltkrieg verwundet wurde, lebte von 1961 bis 1965 in Stockholm und ist dann nach Westberlin gegangen, wo er sich offenbar auch mit anderen Wiener Autoren mit Gerald Bisinger, Elfriede Gerstl, beispielsweise zusammengetan hat und auch mit Ernst Jandl und Friederike Mayröcker gelesen hat und diese Berliner Zeit wurde nun in der Bartensteingasse beleuchtet.
So gab es das erste Referat von der Mitveranstalterin Sonja Kaar, die über H. C. Artmann und Gerald Bisinger referierte und der 1999 verstorbene Gerald Bisinger, der in erster Ehe mit Elfriede Gerstl verheiratet war, hat mit mir auch einige Zeit in Berlin gelebt, ist dort im literarischen Colloquiim tätig gewesen, bis er wieder nach Wien zurückging, wo ich ihm, nachdem ich in die GAV aufgenommen wurde, kennenlernte und eigentlich ein Fan von ihm war, weil mir sein Gedichte „Ich sitze im Zug, trinke ein Glas Rotwein und denke an Karl August!“, die ja wahrscheinlich streng genommen keine sind, sehr gefallen.
Gerald Bisinger war, glaube ich, auch ein bißchen ein Fan von mir, zumindestens hat er ein paar Texte von mir in Ö1 und in der „Rampe“ veröffentlicht und mir auch den Rat gegeben mein „Zwischen Hütteldorf und Heiligenstadt“ an „Residenz“ zu schicken, was ich aber schon gemacht habe, so daß Jochen Jung über die zweite Zusendung eher verärgert war.
Daß er in Berlin war, habe ich zwar gewußt, in den sechziger Jahren war ich aber etwa fünfzehn und habe mich da noch nicht so sehr für Literatur interessiert.
Interessant war aber das zweite Referat, das in zwei Filmen, die österreichische Szene in Berlin und eine Lesung mit Friederike Mayröcker, Ernst Jandl und H. C. Artmann zeigte, die von Walter Höllerer moderiert wurde, die in einem Sprechgesang endete.
Interessant ist in diesem Zusammenhang vielleicht auch, wer oder was die Wiender Gruppe ist?
Streng genommen gehörten, glaube ich, Friedrich Achleitner, der vor kurzem gesgtorben ist, Gerhard Rühm, H. C. Artmann, Konrad Bayer und Oswald Wiener, also fünf Personen dazu und es wird, glaube ich, gestritten, ob man Elfriede Gerstl, den Jandl und die Mayröcker auch dazu zählen soll oder nicht?
H. C. Artmann hat den Dialekt „med ana schwoazzn dintn“ in die Literatur hineingebracht und in Berlin, glaube ich, sein „Dracula, Dracula“ geschrieben. Die anderen Mitglieder sind aber, glaube ich, nicht so sehr wegen des Dialektes, sonder eher wegen der Sprachexperimente in die Literatur eingegangen.
Herbert J. Wimmer hat über Elfriede Gerstl und ihre Berliner Erfahrungen, sie hatte damals kein Geld und hat öfter ihre Wohnung, sprich die Untermietzimmer gewechselt, aber eine Zeitlang auch in der „Kleisstraße 35“ wo auch Artmann wohnte, gelebt.
Es gab ein Referat über die Musik, denn H. C Artmann hat auch mit dem Musiker Gerhard Lampersberg zusammengearbeitet, obwohl seine Oper „Der Knabe mit dem Brokat“ nicht aufgeführt worden ist und dann kam der in Amerika lebende Germanist Peter Pablisch an die Reihe, der, glaube ich, einen erweiterten Begriff der „Wiener Gruppe“ hat und auch Peter Handke dazuzählt, die aber in Amerika verbreitet, berichtete darüber und hat dann die Fritzi angerufen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen konnte und sie gefragt, ob sie sich an die Lesung in den Sechzigerjahren erinnern kann?
Sie konnte es und Rosa Pock, die Witwe, kam auch auf die Bühne und erzählte, daß sie den H. C. in Berlin kennengelernt hat. Gerhard Rühm mußte absagen. Dafür erschien aber, welch überraschung Oswald Wiener, den ich, glaube ich, noch nie live gesehen habe, der auch etwas über seine Beziehung zu dem H. C. etwas erzählen sollte.
Leider mußte ich die interessante Erinnerungsrunde verlassen, weil ich eine sechs Uhr Stunde hatte, die ich nicht verschieben konnte, so mußte ich auf das Brot und den Wein und das Gespräch mit der Angela und dem Josef verzichten, kann aber noch ein bißchen „Frankfurtsurfen“ und aufs blaue Sofa gehen, um mir beispielsweise die „Aspekte-Preisverleihung“ an Miku Sophie Kühmel, sowie den „Diogenes-Talk“ anzusehen, bis es Morgen um neun weitergeht.
Am Freitag ist es dann mit Alexandra Millner, der Präsidentin der „Artmann-Gesellschaft“, die ja einmal Praktikantin in Annas Schule war, weitergegangen. Sie hat das „Artmannsche Universum“ im „wackelatlas“, sprich in einem Film, den Artmanns Tochter Emily und seine Nicht kurz vor seinem Tod gedreht haben, vorgestellt und da kann ich mich gleich an eine GAV-Veranstaltung im AK-Theater, in den neunziger Jahren wahrscheinlich erinnern, wo der H C. in einem schönen weißen Anzug mit seinem Stock aufgetreten ist, im Dezember 2000 ist er, ein halbes Jahr nach Ernst Jandl und Arthur West gestorben. Da gab es dann eine Veranstaltung im Literaturhaus an die ich mich erinnern kann und in einem Film im Filmcasino bin ich auch gewesen.
Wie der aber geheißen hat, habe ich keine Ahung mehr. Beim Symposium ist es mit der Druckwerkstatt der Dichter in Rixendorf weitergegangen, die Uwe Bremer vorstellte und die nie in Rixendorf war.
Dann gab es eine Mittagspause und anschließend gab es noch eine Gesprächsrunde zu „Dracula, Dracula“, da bin ich aber schon in die „Alte Schmiede“ gegangen, zum „Kulturpolitischen Arbeitskreis“ der GAV, deren Präsident oder Generalssekretär H. C. Artmann, als er wieder nach Wien zurückgekommen ist, ja einmal war.