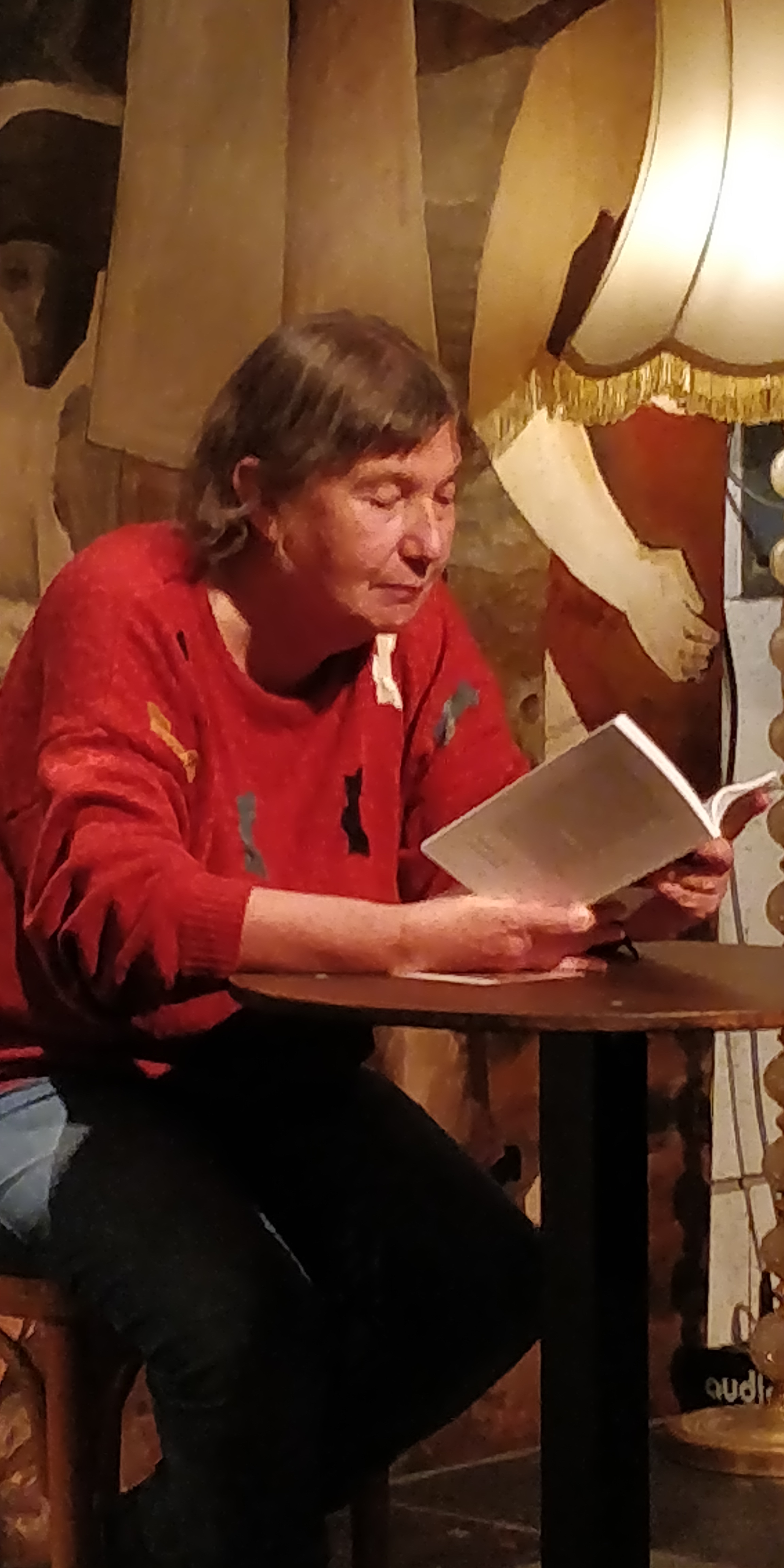Nach der kurzen Schweiz-Unterbrechung, geht es weiter mit dem östBp, das heißt ich fange jetzt so richtig damit an, habe ich bis jetzt ja nur die Bücher gelesen die auch auf der dBp und der Schweizer Liste standen und werde vielleicht wieder unterbrachen, da nächste Woche ja die Shortlist des Bloggerdebuts-Preises“ bekanntgegeben wird von der ich hoffe, daß ich einige Bücher schon gelesen habe
Jetzt aber Buch fünf des öst Bp, Gerhard Roths „Die Hölle ist leer, die Teufel sind schon alle hier“, ein Zitat von Shakespeare aus dem „Sturm“, des 1942 in Graz geborenen Gerhard Roth, einem österreichischen Doyen, der mehrere Romanzyklen geschrieben hat und von dem ich auch schon einiges gelesen, bezeihungsweise in meinen Regalen habe.
Jetzt kommt sein zweiter Vendig-Romanund ich muß gestehen, daß ich keine Ahnung hatte, daß er sich für Venedig interessiert, hielt ich ihn doch für einen Grazer Expressionisten, der sich für die „Archive des Schweigens“ etcetera, interessiert und da ich ja eine Namensfetischist bin und bei meinen Preisprognosen immer an die Berühmten denke, war ich sehr erstaunt, das Buch nicht auf der Shortlist zu sehen, hätte ich Roth seines Alters wegen neben Florjan Lipus, den ich noch lesen muß, für einen Favoriten gehalten.
Jetzt bin ich nicht mehr so davon überzeugt, denn ich muß zugegen, daß das Buch, das mich stellenweise an das Debut der Raphaela Edelbauer erinnerte, ist es ja ähnlich absurd und während bei Edelbauer eine seltsame Gräfin alles dominiert, ist es hier ein uralter Herr Egon Blanc, sehr verwirrte und ich mich auch ein bißchen wunderte, daß ein literarischer Doyen, der an den Achtziger geht, seit Jahrzehnten schreibt, sich so etwas traut und gedruckt wird. Aber wahrscheinlich deshalb und bei mir wäre es wieder oder ist es ganz anders, obwohl ich wieder Ähnlichkeiten mit meinen Schreiben entdeckte.
Es geht also um Venedig, in einigen Rezensionen wird sogar von einem Venedig-Führer geschrieben und um den Tod und das Sterben, beziehungsweise um das Verwirrspiel darum herum.
Die Psychologin würde da wieder an das Hineingleiten in eine Psychose. wie beim „Letzten Huelsenbeck“, denken, spielen ja Pilze auch eine Rolle, aber das nur am Rande.
Der oberflächlige Leser, der der sich nicht so gut auskennt und den Namen Gerhard Roth vorher vielleicht noch nicht gehört hat, wird vielleicht an eine billige Kriminal und Verfolgungsstory denken.
Aber schön der Reihe nach, damit man mir nicht wieder unverständliches Schreiben vorwirft.
Vielleicht sollte ich noch anmerken, daß ich am Anfang erstaunt gedacht habe, aha Gerhard Roth schreibt auch einen dieser Midlifekrise Rome, wo es um den Sex und der Angst vor dem Sterben geht.
Da ist also Emilio Lanz, ein Übersetzter, er kommt aus Südtirol, hat lange in der Steiermark bei seiner Frau, einer Weinbäuerin gelebt und nach deren Unfalltod von ihr geerbt, lebt jetzt am Lido, übersetz den „Gulliver“ und ist des Lebens überdrüssig.
Zwei alte Pistolen hat er auch aus der Steiermark mitgenommen mit einer davon fährt mit dem Vaporetto auf eine Insel und beschließt sich dort umzubringen. Bis er dorthin kommt, macht er viele Beobachtungen und die kleinen feinen Beobachtungen sind auch eine Stärke des Buchs, kauft sich ein Schachspiel und betrinkt sich an drei Flaschen Wein. Nebenbei ist er, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, ein Büchersammler, der sich ständig neue Bücher bestellt, die ihm dann ein afrikanischer Briefträger bringt, obwohl er längst nicht mehr alle lesen kann. Das ist vielleicht ein autobiografisches Detail und erinnert auch stark an mich.
Lanz beschließt sich also umzubringen. Aber bevor er das tun kann, beobachtet er einen Mord. Ein Mann wird von zwei anderen mit einem Boot gebracht und dann erschossen glaube ich. Eine schöne Fografin namens Julia hat Lanz da auch schon kennengelernt, die sieht er während er zum Vaporetto will, um die polizei zu holen in einem Hotel, hört sie telefonieren und bekommt heraus, daß ihr Lebensgefährte in den Fall verwickelt war und den Mord in Auftrag gegeben hat.
Er landet mit Julia in einem Hotelzimmer, sie entwendet ihm die Pistole mit der dann später ihr Freund und Auftragsgeber erschossen wird und verschwindet. Er geistert durch Venedig, beschäftigt sich mit der Frage, ob er zur Polizei gehen soll oder nicht? Spaziert durch Spitäler und Friedhöfe, sieht sich Kirchen an, macht wieder Beobachtungen, wird verfolgt und schließlich von einem Auto niedergefahren, so daß die Polizei zu ihm kommt.
Da redet er sich auf Gedächtnisausfälle aus und nun schaltet sich der reiche Hundertjährige ein, der neben ihm wohnt, der offenbar den Unfall verursacht hat und vermittelt einen Übersetzungsauftrag von Shakespeares gesammelten Werken, was fünfundzwanzig Jahre dauern wird und ihm monatlich viertausen Euro einbringen soll.
Einen Falkner hat Emil Lanz inzwischen auch kennengelernt, der stellt ihm andere Angestellte des Egon Blanc vor. Da gibt es einenImker, einen Gärtner, einen Koch und eine Frau namens Caecilila, die nun Lanz Geliebte wird.
Es kommt zu weiteren Verfolgungsjagden und Todesfällen, ein Commissario Galli taucht immer wieder auf und stellt zynische Fragen. Im letzten Kapitel gibt es dann den für das Buch symbolisch stehenden Sturm. Lanz Haus wird durch einen Brandtanschlag zerstört und richtig, die Flüchtlingsfrage, das hätte ich fast vergessen spielt auch noch eine Rolle.
Am Beginn des Buches hat Lanz bei seinen täglichen Spaziergängen ein totes Flüchtlingsmädchen gesehen, die Stadt ist von illegalen Handtaschenverkäufern überschwemmt und die Flüchtlinge, Julia und ihr Liebhaber waren, stellt sich heraus, im Schlepperwesen verwickelt, wurden in ein verfallenes Sptial untergebracht und dort zur Prostituion und illegalen Taschenverkauf verpflichtet.
Die Frage ob das jetzt alles real oder, ob Lanz nicht schon längst gestorben ist oder alles nur träumt, taucht auch immer wieder auf und ich bin, wie gesagt ein bißchen verwirrt, daß Gerhard Roth so schreibt und sollte mich vielleicht genauer mit seinen Büchern beschäftigen.
Wenn ich eines seiner Werke in den Schränken finde, nehme ich es ja mit, denn ich habe ja auch eine umfangreiche Büchersammlung, die mir hoffentlich nicht verbrennt. Aber ob ich dazu komme, sie zu lesen, ist fraglich, kommt ja soviel Neues auf mich zu. Aber wenn Gerhard Roth dann auf einer der Buchpreislisten steht, werde ich ihn lesen und ich erlebe vielleicht wieder eine Überraschungen und das ist ja sehr schön.