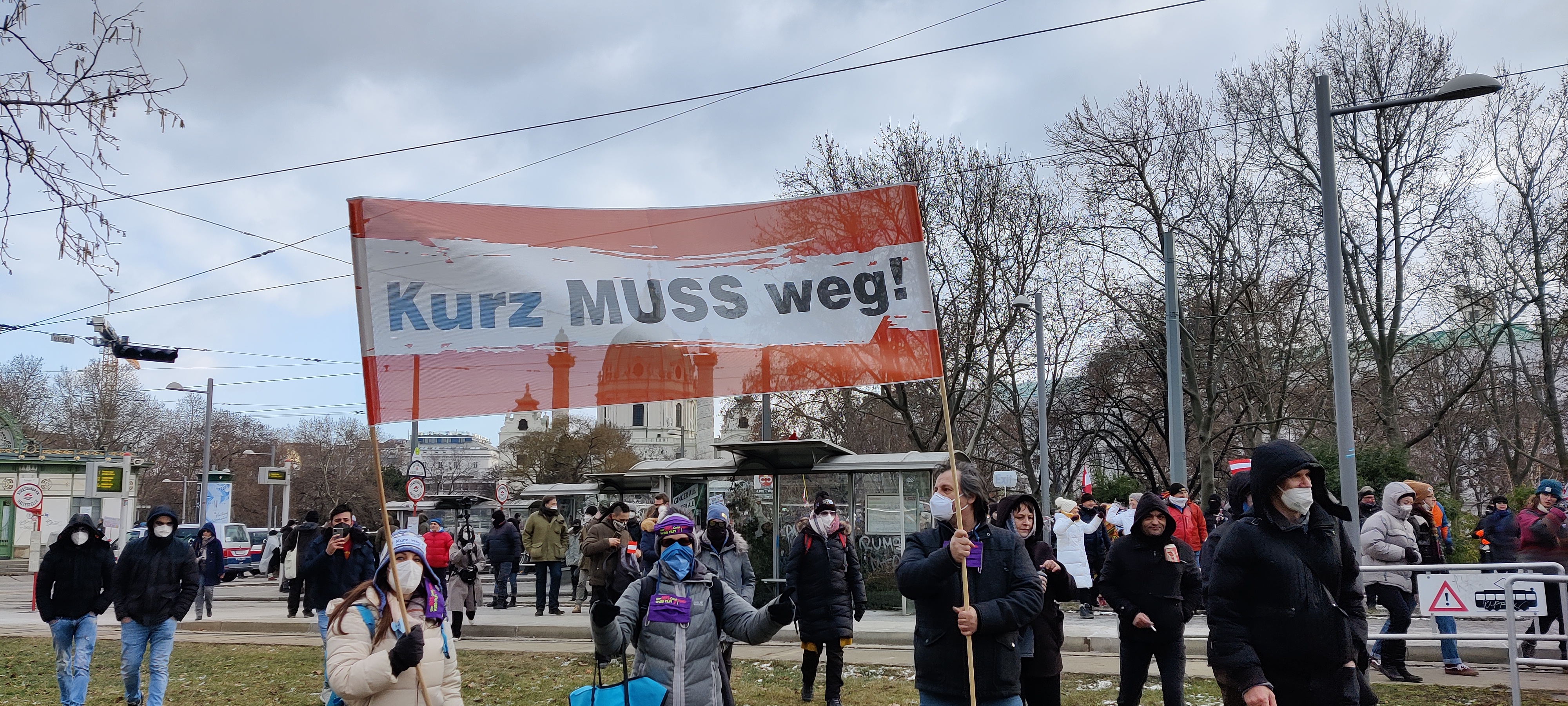Von Hans Pleschinski habe ich, glaube ich, bei einem Frankfurter Buchmessensurfing das erste Mal etwas gehört, das heißt, ich habe ihn mit Ludwig Fels verwechselt, der vor kurzem verstorben ist, da wurde sein „Ludwigshöhe“ vorgestellt, das mich interessierte, weil ich mich mit dem Thema Sterbehilfe ja auch sehr beschäftigte. Bei dem Bücherkauf von Alfreds literaturversierter WU-Kollegin habe ich das „Bildnis eines Unsichtbaren“ um einen Euro wahrscheinlich, erstanden und ich gestehe es, immer noch nicht gelesen, auch „Wiesenstein“ das Portrait über den großen Gerhard Hauptmanns noch nicht. Das hatte ich bei „Beck“ angefragt, nicht bekommen, es mir dann aber einen Literaturhaus-Flohmarkt um fünf Euro gekauft, noch nicht, dafür aber, Kritiker hört her „Königsalle“ über den noch berühmteren Thomas Mann.
Woher ich das Buch bekommen habe, weiß ich nicht mehr, vielleicht wars im Kasten oder in einer Abverkaufskiste und bin so daraufgekommen, daß sich der 1956 in Celle geborene, in letzter Zeit für literarische Biografien interessiert, denn jetzt ist ein weiters Bildnis eines Unsichtbaren oder Unbekannten, herausgekommen, nämlich das Portrait des ersten deutschen Nobelpreisträgers von 1910 Paul Heyse und ich höre jetzt schon rufen „Paul Heyse wer wer ist denn das?“
Ein klein wenig Ahnung hatte ich schon, denn es gibt einen Briefwechsel zwischen ihm und Marie von Ebner- Eschenbach und da war ich mal bei einem Symposium und da hat ihn, glaube ich, Alexandra Millner oder war es Daniela Strigl vorgestellt und als ich einmal erschöpft von dem Writersstudio-Marathonschreiben nach Hause beziehungweise an einen Bücherschrank vorbeigegangen bin, habe ich dort ein Buch über die „Deutschen Nobelpreisträger“ gefunden, das dann auch in meine „Unsichtbare Frau“ hineingefunden hat.
Ein Biografie über einen unbekannten Nobelpreisträger, wie fad könnte man da unken. Wen interessiert denn das? Das ist doch altmodisch und verstaubt!
Mitnichten, liebe mögliche Vorauskritiker, denn Hans Pleschinski macht es sehr originell. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das auch schon beim Thomas Mann so war. Aber hier marschieren eines Abends in München drei Frauen um die sechzig, die Baustadträtin Antonia Silberstein, die Bibliothekarin Therese Flößer auf Krücken und die Münchner Literaturpreisträgerin Ortrud Vandervelt, die gerade von einer Lesereise aus Sibirien zurückkommt, vom Rathaus in die Luisenallee, wo sich das Haus befindet, in dem Paul Heyse 1914 wahrscheinlich gestorben ist oder zuletzt dort lebte. Heute ist das eine verfallene Villa in der alte Waschmaschinen stehen, ein Konditor und ein Uhrmachen mit ihren kinder leben und sich die Spekulanten reißen. Die Stadt München will aber ein Kulturzentrum daraus machen. Deshalb hat ein Praktikant, die drei Damen angemeldet, die dort noch einen Erlanger Heyse-Experten treffen sollen.
So stolpern die drei Frauen durch die Stadt und machen mancherlei Alltagsbeobachtungen dabei. Da wird eine taubenfütternde Alte vom Portier vertrieben wird, AfD-Wäher unterhalten sich, etcetera.
Die Bibliothekarin hat ein paar Heyse-Bücher im Rucksack. So werden immer wieder Gedichte zitiert, die man auch im Buch finden kann und über Paul Heyse, der 1830 in Berlin geboren wurde, erfährt man auch sehr viel. Der war damals ein berühmter Dichter, wurde sogar geadelt, hatte viele Künstlerfreunde und hat auch Künstlerkreise zum Beispiel einen namens „Krokodil“ gegründet. Hundertzwanzig Novellen, acht Romane und unzählige Theaterstücke hat er geschrieben. Da kommt dann eine Anspielung, daß man heutzutage keine Novellen mehr schreiben kann, weil keiner weiß, was das ist und sogar schon „Haikus“ als Romane betitelt werden.
Die Gruppe torkelt weiter durch die Stadt, kommt dann zu der Villa, aber zuerst nicht hinein. Die Bibliothekarin hat Schwierigkeiten mit den Krücken und bekommt Alpträume, wo sie sich an ihren Schreibtisch wähnt. Dann dann gibt es auch ein Zwischenkapitiel in Italien, denn da besucht 1905 offenbar der berühmte Verleger der Cottta´schen Buchhandlung, den alten Dichter in seiner Sommerredsienz am Gardasee, denn der war sehr Italophil, hat das auch studiert und Ende eine Villa dort gehabt. Frau Anna fragt was sie kochen soll? Der Verleger deutet schon den möglichen Nobelpreis an
Dann geht es wieder zurück in dieLuisenstraße, beziehungweise in das Cafe nebenan, wo die die fünf, der Erlanger Spezialist vom Department of literatur, auch so eine Anspielung mit seinem chinesischen Mann ist inzwischen auch eingetroffen, um sich zu stärken. Dann kommen sie doch in die Villa hinein und am Ende erscheint noch der Direktor vom Touristenbüro von Gardone Riviera, der dort ein Paolo Heyse- Centro errichten will und bietet der Baurrätin oder der Stadt Münschen seine Vorschläge an.
Interessant merke ich an, sehr orignell und gewagt. Bin gespannt, was die Literaturkritik dazu sagt? Mir hat es jedenfalls gefallen und wieder viel gelernt. Vor allem das man Literatur und auch biografische Romane anders schreiben kann und kann das Lesen des „Götterbaums“ oder auch Paul Heyse selbst, von dem ich gar nicht weiß, ob der noch lieferbar ist, sehr empfehlen, der aber vielleicht verstaubter wirken kann, als das Buch über ihn.