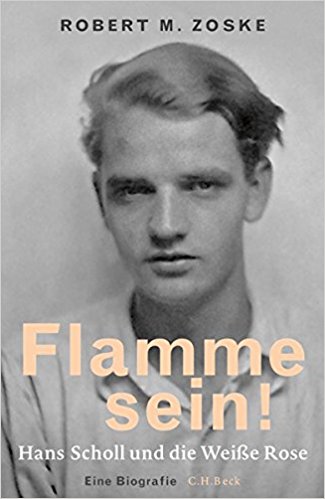Wenn Philosophen lesen…
Über John Gibsons und Wolfgang Huemers Aufsatzsammlung zur Bedeutung Ludwig Wittgensteins für die Literatur
Von Stefan Degenkolbe
Wenn Philosophen lesen, scheint sich dies von der Beschäftigung eines gewöhnlichen, eher literarisch orientierten Lesers zu unterscheiden. Denn während dieser versucht, einem Erzählfluss zu folgen, eine Erzähltechnik zu verstehen oder sich einfach nur gut zu unterhalten, verhalten sich Philosophen augenscheinlich ganz anders. Dieser Unterschied wird besonders deutlich, wenn die lesenden Philosophen Sprachphilosophen sind, die die Bedeutung Wittgensteins für die Literatur bestimmen wollen.
Dann stellen sie die Frage nach dem kognitiven Potential fiktionaler Erzählungen und denken über die Möglichkeiten des Erkenntnisgewinns aus nicht realistischen Sätzen nach. Oder sie betrachten Sätze wie "Sherlock Holmes wohnte in der Baker Street" und fragen sich, ob und welche Art von "Wahrmachern" diesem Satz zukommen, der ja schließlich in der empirischen Welt nicht verifiziert werden kann.
Liest man die Aufsätze, die sich mit derartigen Problemen beschäftigen, so drängen sich vor allem zwei Eindrücke auf. Einerseits, dass diese Philosophen das Denken Wittgensteins viel zu einfach und einseitig als reine Sprachphilosophie betrachten. Andererseits, dass sie eine ungeheuer einfache, vereinfachende Auffassung von Sprache haben, die an der spezifischen Komplexität der literarischen Sprachen scheitert. Sicher, sofern man der Meinung ist, dass recht angewandte Sprache reale Sachverhalte beschreibe oder abbilde, so begegnen einem die Sprachen der Literatur als Formen des Sondergebrauchs oder gar des Missbrauchs von Sprache. Und der Philosoph muss dann versuchen, mit Wittgensteins mehr oder weniger bereitwilliger Hilfe, seine Begeisterung für Literatur mit seinen sprachphilosophischen Auffassungen in Einklang zu bringen.
Glücklicherweise können lesende Philosophen aber auch zeigen, dass Literatur integraler Bestandteil der menschlichen Lebenspraxis ist und nicht ein eigentümlicher Sonderfall der menschlichen Sprachpraxis. Diesen Aspekt betont besonders John Gibson, der Dostojewskis "Aufzeichnungen aus einem Kellerloch" mit Wittgenstein betrachtet. Literatur sei die Fähigkeit des Menschen, nicht nur Wirklichkeit abzubilden, sondern auch mögliche Wirklichkeiten und mögliche Blicke auf die Wirklichkeit darzustellen. Durch die Literatur wären die Menschen in der Lage, Visionen der Wirklichkeit und Fiktionen von Wirklichkeiten aufzubewahren. Und unser literarisches Erbe ermögliche es uns, auf diesen nahezu unendlichen Fundus zurückzugreifen, um unsere Welt zu begreifen, statt immer nur in der einen auf unser gegenwärtiges Erleben beschränkten Welt zu leben.
Ganz anders sieht es aus, wenn Stanley Cavell Wittgensteins Werke als Literatur liest und ihn mit dem Kompliment bedenkt, er sei ein großer Schriftsteller gewesen. Als philosophischer Schriftsteller wehre sich Wittgenstein gegen die Aufdringlichkeit philosophischer Probleme und die Unzulänglichkeit der gängigen Antworten, und halte der Philosophie den realen, gelebten Alltag und seine normale Sprache entgegen. Wittgenstein breche herkömmliche philosophische Denkmuster auf, indem nach Formen der Klarheit suche, die immer wieder pendeln zwischen dem, was wir anstreben, und dem, was wir erreichen können. Als philosophischer Schriftsteller habe Wittgenstein viele philosophische Probleme als Scheinprobleme entlarvt und andere, zu Unrecht überwunden geglaubte Probleme wieder neu eröffnet, indem er sie aus ihren alten sprachlichen Formen herauslöste.
Der vielleicht lesenwerteste Aufsatz in dem Band stammt von Joachim Schulte. Dies schon aufgrund seiner außergewöhnlichen Detailkenntnis von Wittgensteins Werk, die auch eher Abseitiges und wenig Bekanntes einschließt. Schulte beschäftigt sich mit den verstreuten Aussagen Wittgensteins, denen eher eine literarische als ein philosophische Natur zuzukommen scheint. So denkt Wittgenstein über "lebendige" und "tote" Zeichen nach, über die Bedeutung von Tonfällen, dadurch ausdrückbaren Bedeutungsnuancen und deren Rolle in Sprachspielen. Dies sind Aspekte, die einer bestimmten Art "strenger" Sprachphilosophie, die Sprache zuerst für ein Mittel der Abbildung von Wirklichkeit hält, verschlossen bleiben. In Schultes Untersuchung zeigt sich, dass Wittgensteins Verständnis von Sprache sehr viel komplexer ist und ihrer literarischen Erscheinungsform sehr viel näher steht, als dies die berühmten holzschnittartigen Sprachspiele aus den "Philosophischen Untersuchungen" vermuten ließen.
Andere Aufsätze stellen die Frage nach Wittgensteins Bedeutung für die Literatur- und Übersetzungstheorie oder auch für die Bestimmung der Moralphilosophie. Rupert Read versucht eine Methode zum Verständnis der Sprache der Schizophrenie zu entwickeln, indem er William Faulkners "Schall und Wahn" vor dem Hintergrund von Wittgesteins Sprachphilosophie liest.
Bei der Fülle der behandelten Themen, bleibt der Aufsatzsammlung als bedeutendster Mangel, dass bis auf die Aufsätze von Majorie Perloff und David Schalkwyk alle Beiträge von Philosophen stammen. Hier wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, den Literaturwissenschaften mehr Raum zu geben. Auch die Bedeutung, die die Literatur für Wittgenstein hatte, wäre eine Untersuchung wert gewesen.