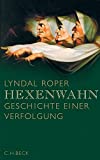Nachvollzug der Vergangenheit und ihre Aufklärung
Lyndal Ropers barockes Schauspiel "Hexenwahn" und der Sammelband "Wider alle Hexerei" von Sönke Lorenz und Michael Schmidt
Von Achim Saupe
Lyndal Roper legt mit ihrem Buch "Hexenwahn" eine Geschichte der Hexenverfolgung vor, die nur im Rückgriff auf die frühneuzeitlichen Geschlechterordnungen verstanden werden kann. Im Kern des Buches, welches sich auf den süddeutschen Raum der Verfolgung konzentriert, steht die Frage, warum die Verfolgung von Hexen konfessionsübergreifend insbesondere auf ältere Frauen zielte, und warum sich die Vorstellung von Hexen immer wieder um Fragen der Fruchtbarkeit drehte. So steht hier die frühneuzeitliche Wahrnehmung von Weiblichkeit und Sexualität im Zentrum einer Analyse, die den Leser immer wieder mit detailgenauen Rekonstruktionen von verschiedenen Verfolgungsschicksalen in die Hexenwelt entführt.
Ropers Buch ist nun weniger aufgrund ihrer Fragestellung oder aufgrund ihres genderorientierten Forschungsansatzes innovativ, sondern weil sie es insgesamt versteht, den vermeintlichen Widerspruch von Theorie und Erzählung zu überwinden und die Hexenverfolgungen vor einem dichten kulturhistorischen Horizont nachvollziehbar zu machen.
Zunächst führt Roper ihre Leser in eine barocke Welt von Reformation und Gegenreformation, in der die Vorstellung über die böse Macht der Hexen und Dämonen und der Teufelsglaube zu den Alltagsnormalitäten gehörte. Die Beschuldigungen wie Kannibalismus, Teufelsbuhlschaft und Hexensabbat, die gegen Hexen vorgebracht wurden, waren kulturell fest verwurzelt und im Vorgehen gegen Häretiker und Juden erprobt. Die Hexe und ihre teuflischen Liebhaber bildeten eine verschworene Geheimgesellschaft, die es auf den Schaden der christlichen Mehrheitsgesellschaft abgesehen hatte.
Gemeinsames Ziel der Konfessionen war es während der Hexenverfolgung - so Roper, die Welt von Hurerei zu befreien, gegen Ehebrecher vorzugehen, schwangere Bräute der Schmach auszusetzen und gegen Kindsmörderinnen den Tod zu verhängen. Doch für eine Erklärung, warum sich ganze Gemeinden an Hexenjagden beteiligten, warum sich Nachbarn gegenseitig denunzierten und Verwandte desselben Glaubens gegenseitig beschuldigten, reicht die konfessionelle Spaltung nicht aus, zumal die Autorin immer wieder auf Verfolgungen in Städten wie Nördlingen aufmerksam macht, in denen ein interkonfessionelles Zusammenleben praktiziert wurde.
Auch wenn Roper ihre Leser mit den Körperqualen der Opfer konfrontiert, relativiert sie doch die Bedeutung der Folter für die Hexenverfolgung. Die Folter ist für sie nicht nur eine fragwürdige Praxis der Wahrheitsforschung oder eine Herrschaftstechnik, sondern vielmehr ein Mechanismus, der es der Historikerin erlaubt, die gemeinsamen Vorstellungswelten, Ängste und Nöte einer Gesellschaft von Verfolgern und Opfern zu rekonstruieren. Roper interessieren weniger jene "Hexen", die sich weigerten, den Anschuldigungen der Verfolger stattzugeben und in der Hexenforschung oftmals als "Sozialrebellinnen" stilisiert wurden. Vielmehr fragt sie sich, warum Frauen mit den Inquisitoren "kooperierten". So sind die Hexenfantasien für Roper keine erpressten Geständnisse, die im Wesentlichen den Vorstellungswelten der Folterer entsprachen, sondern sie betont die intimen Interaktionen zwischen Inquisitoren und Hexen: Letztere mussten individuelle, an ihren eigenen Biografien anschlussfähige Fantasien entwickeln, damit ihre Richter den Erzählungen der Hexen Glauben schenkten. Und so wird auch den Verfolgern - oft genug einfache Ratsmänner - keineswegs mit Unverständnis begegnet. Zu sehr will die Autorin Verständnis für eine barocke Welt wecken, die von den Vorstellungswelten über die Macht des Bösen nicht getrennt werden kann.
Die Hexenverfolgung steht für Roper im Zusammenhang mit einer frühneuzeitlichen, von Polizeigesetzen und konfessionell geprägten Frauenbildern unterstützten Bevölkerungs- und Familienpolitik, die verstärkt versuchte, regulierend in die familiären Beziehungen einzugreifen und die Sexualität allein in die Institution der Ehe verbannen wollte. Doch hier - wie in manchen Passagen dieses Buches - verschwimmen die erklärenden Zusammenhänge in den konkreten Geschichten zwischen Verfolgern und Opfern. Keinesfalls sieht die Autorin in der Hexenverfolgung allein eine sozialdisziplinierende Praxis gesellschaftlicher Eliten. Und von einem misogynen Weltbild mag die Autorin nicht sprechen, denn - aber auch obwohl - die Hexenfeindschaft durch eine Gegenideologie konterkariert wurde, die die fruchtbare, junge und verheiratete Frau verehrte. So bleiben die Gründe für die Verfolgung nicht zeugungsfähiger älterer Frauen letztlich etwas diffus, auch wenn die Ängste um Fruchtbarkeit, Prosperität und Zukunftsaussichten und die Anklage des Schadenzaubers nachvollziehbar erscheinen und klassische Motive des Neides und der Rache - und zwar der Hexen auf die Fruchtbarkeit jüngerer Frauen und der jüngeren Generationen auf die vermeintlich ungezügelte Sexualität der Hexen - im Horizont der Kultur Überzeugungskraft entwickeln.
In der intensiven Lektüre der Verfolgungsakten liegt sicherlich die faszinierende Leistung Ropers. Immer wieder nennt sie ihre historischen Akteurinnen beim Vornamen, um jene Frauen nicht auf ihre Verfolgungsschicksale zu reduzieren, sondern ihre Ängste und lustbetonten Vorstellungen ernst zu nehmen. Doch gleichzeitig entsteht dadurch eine fragwürdige Spannung zwischen den historischen AkteurInnen und der rekonstruierenden Historikerin. Denn Roper verzichtet darauf, den Lesern die Folterakten zitierend vorzuführen, sodass im Zusammenspiel von historischer Imaginationskraft und erzählender Rekonstruktion trotz aller interpretativen Fragwürdigkeiten sinn- und bedeutungshafte Geschichten entstehen. So kann sich die Historikerin als souveräne Erzählerin in einem barocken Schauspiel behaupten. Mit ihrem Einfühlungsgestus und ihrem narrativen, individualisierenden Erzählstil schließt Roper modernisierend an Werke eines Jules Michelet oder Emmanuel LeRoy Ladurie an, während sie in der Adaption psychoanalytischer und ethnologischer Ansätze in der Tradition von Michel de Certeau und Carlo Ginzburg neue Maßstäbe setzt. Den Fallstricken der Mikrostudien entkommt die Autorin, indem sie die Einzelschicksale der vermeintlichen Hexen in einen dichten kulturgeschichtlichen Kontext webt, auch wenn letztlich - abhängig von der Logik des Fallbeispiels - sich manche Begebenheit im Sand der Geschichte verliert.
Gleiches betrifft nun auch das Ende der Hexenverfolgungen. Das Buch endet dreifach: Kontrastiert wird die tiefe Angst vor der alten, sexuell aktiven, gleichzeitig aber reproduktionsunfähigen Frau mit der Verfolgung und Disziplinierung von Kindern zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Roper zeigt, wie der Teufel langsam entzaubert wird und damit auch ältere Frauen nicht mehr als Hexe und Sündenbock der Gesellschaft herhalten können. So verfolgt sie die Anklagen gegen so genannte "gottlose" beziehungsweise "schwer erziehbare" Kinder, die von ihren Eltern abgeschoben worden waren und nun als vermeintliche Hexen ihr Unwesen trieben. Aus den Prozessakten bricht nun ein neuer Diskurs über Sexualität hervor: Angriffsfläche der Hexenvorstellung ist nicht mehr die vermeintlich deviante Sexualität der reifen Frau, sondern von Kindern, deren sexuelle Praktiken - insbesondere die Masturbation - man über die Hexenbeschuldigung zu regulieren versucht. Zur Hinrichtung reichen derartige Beschuldigungen allerdings nicht mehr aus. Nach mehrjähriger, von Prügel begleiteter Haft bescheinigt man den Kindern, sie von ihrer teuflischen Besessenheit befreit zu haben.
Einen weiteren Ausklang der Hexenverfolgung zeigt Roper an einem Beispiel aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Noch bleibt der religiöse Volksglaube und seine exorzistischen Praktiken latent, aber der Diskurs über den sexuell aktiven Körper wird nun in den Bereich der Erfahrungsseelenkunde und damit der modernen Psychologie verschoben. Die Hexenwelten der Frühen Neuzeit lösen sich in einem neuen Verständnis des Individuums auf, dem mehr Raum für Gefühle, Sensibilität und eine Wertschätzung der Kindheit zugestanden wird. Schließlich bleibt von der fantastischen Realität der Hexe nur noch ein mattes Märchenbild in den Kinderstuben des Bürgertums des 19. Jahrhunderts zurück, mit dem die Kinder fürsorglich gewarnt werden, keine Süßigkeiten von älteren Frauen oder bösen Stiefmüttern anzunehmen.
Sicherlich versteht es Roper insgesamt, die Welt sexueller Wünsche und Geheimnisse der Frühen Neuzeit wenn nicht freizulegen, doch zu eröffnen, auch wenn ihre psychoanalytischen Deutungsmuster manchmal recht suggestiv bleiben. So wäre insgesamt eine noch stärkere Zusammenschau von Körperbildern und Vorstellungen über Sexualität und die Entstehung der modernen Medizin und psychologischen Kontrollsysteme zu wünschen gewesen, um dann nachvollziehen zu können, warum im Zuge der Aufklärung, der Säkularisierung und der beginnenden Abkehr vom Teufelsglaube die Hexerei als Wahnvorstellung verstanden werden konnte. So verschwindet hinter der Lust am verstehen-wollenden Erzählen der Mut zur erklärenden Hypothese - ein Problem, welches seit der Rückkehr der Erzählung in die Geschichts- und Kulturwissenschaften oft genug diskutiert wurde.
Während Lyndal Roper sich auf ihre erzählerische Kraft verlassen kann, ist der von Sönke Lorenz und Jürgen Michael Schmidt herausgegebene Sammelband "Wider alle Hexerei" einer pragmatischen Tradition der Hexenforschung verpflichtet. Gewidmet ist der Band dem amerikanischen Historiker Erik Midelfort, der in einem kurzen Beitrag die Geschichte der abendländischen Hexenverfolgung nachzeichnet und zu den Begründern einer sozialgeschichtlich und empirisch orientierten Hexenforschung gehört.
Die hier versammelten lokalgeschichtlichen Studien zur Hexenverfolgung in süddeutschen Regionen reichen von Hexenverfolgungen in einzelnen Markgrafschaften bis hin zu den verschiedenen Reichsstädten, ohne dass dabei Verwaltungsgebiete wie die Fürstprobstei Ellwangen oder aber die Deutschordenskommende Mergentheim außer Acht gelassen werden. Der Band zeichnet sich durch eine Besessenheit für das Lokale aus, der dem Hexenmal noch hinter den letzten hügeligen Landschaften nachspürt.
Diese regionalgeschichtlichen Überblicke werden durch Beiträge begleitet, die den europäischen Horizont der Verfolgung verdeutlichen. Der einleitende Beitrag von Wolfgang Schild über den Begriff und die Vorstellung vom Hexereidelikt hat - bei einem engen Schriftsatz, der das Lesen dieses Sammelbandes insgesamt stark beeinträchtigt - schon die Ausmaße einer eigenständigen Monografie. Sönke Lorenz setzt sich in informativer Weise mit den juristischen Hintergründen auseinander und fragt, wie sich die rechtlich geregelte Anwendung der Folter - und die oft genug über die rechtliche Regelungen herausgehende Praxis der Folter - auf die großen Hexenjagden auswirkte. Anita Chmielewski-Hagius widmet sich in ihrem volkskundlichen Beitrag, der den Titel des Sammelbandes aufgreift und in seiner Ausrichtung etwas verlassen dasteht, der magischen Weltsicht und dem Volksglauben, sich mittels "magischer" Praktiken vor dem Unwesen von Hexen, Geistern und Dämonen zu schützen.
Abgeschlossen wird das Buch von einem fast 200 Seiten langen und mit knapp 1.100 Fußnoten gespickten, für die historische Forschung unverzichtbaren - wenn auch teilweise kritikwürdigen - Überblick von Wolfgang Behringer über die Geschichtsschreibung zur Hexenverfolgung. Dieser macht das ganze Ausmaß verschiedenster Forschungstraditionen deutlich, die sich seit der Aufklärung in eine von Jacob Grimm und Jules Michelet begründete romantische, am individuellen Schicksal interessierten Interpretationslinie, und in eine rationalistische, von Wilhelm Gottlieb Soldan und von Joseph Hansen maßgeblich beeinflusste Schule einordnen lassen könnten, wobei letztere den Hexen- und Zauberglauben konsequent als Wahnvorstellung interpretierte. Und so kann letztlich Lyndal Ropers Buch "Hexenwahn" als ein Versuch gedeutet werden, beide Stränge der Forschungen über die Hexenverfolgungen zu vereinigen.
|
||||