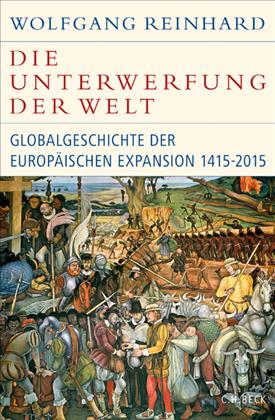Deutsche Abgründe
Marcel Feiges Blick auf die Berliner Zustände
Von Walter Delabar
Themen wie Politik, Prostitution, Korruption und Verbrechen ergeben ein immer gern gelesenes Amalgam, mit dem sich die Seiten eines Kriminalromans füllen lassen. Das Ganze gilt sogar als einigermaßen koscher, richtet man sich nach Mario Puzos Vito Corleone, der seinerzeit befürchten musste, dass ihm der aufkommende Drogenhandel die einigermaßen solide Geschäftsgrundlage zerschlagen würde. Bei Prostitution und Alkokol (während der Prohibition) ließen Politiker mit sich handeln, meinte der Pate seinerzeit, nicht aber bei harten Drogen, die den Zusammenhalt einer Gesellschaft rückhaltlos zu vernichten drohten, wie sie auch zur Verrohung der Sitten in den organisierten Unterweltgesellschaften führten. Japanische, italienische und amerikanische Krimis erzählen davon.
Nun, die Zeiten haben sich geändert. Der Drogenhandel hat ebenso von der Unterwelt Besitz ergriffen wie von der Gesellschaft, und Prostitution ist mittlerweile eine legale Sache. Zumindest ist Anschaffen gehen eine legale berufliche Tätigkeit, was Kapitalismuskritikern ja eh immer schon klar war.
In diesem Zusammenhang aber verlagert sich das Verbrechen - und das ist im Krimi sehr schön zu sehen - von der Zuhälterei hin zu den Infrastrukturen, hin zum Menschenhandel und zum Kindesmissbrauch. Daraus wählt sich dann jeder Autor das, was ihm für seinen Plot am gefälligsten zu sein scheint.
Feige nun wendet sich der Gemengelage von Politik und einschlägiger Geschäftswelt zu. Miguel Dossantos ist der "Rotlichtpate" von Berlin (so die Besetzungsliste, die Feiges Roman mitreicht). Nach wilden Jahren hat er sich so weit etabliert und seine Kontakte geknüpft, dass seine wesentlichen Tätigkeiten durchaus legal sind: Bordelle sind eben normale Wirtschaftsbetriebe mit spezifischem Service. Nur wenn es darum geht, sich die lukrativen Standorte zu sichern und die notwendigen Kredite, muss er gelegentlich nicht nur seine politischen Kontakte nutzen, sondern auch noch zu unangenehmen Mitteln greifen, vor allem dann, wenn die osteuropäische Konkurrenz ihm allzu nahe rückt. Als etablierte Größe verteidigt und vergrößert er sein Revier, wo er nur kann. Doch weiß er sich vorläufig sicher genug im Sattel. Die Nachfolge ist geregelt. Sein Sohn Samuel übt schon fleißig, um das Imperium Dossantos eines Tages erben.
Allerdings gerät das ganze Gebilde durch eine merkwürdige Mordserie ins Wanken: Erst töten zwei Schüler ihren Lehrer anscheinend im Streit. Dann wird der Sohn Dossantos mit den beiden vorgeblichen Mördern erschossen aufgefunden. Die Frau Dossantos, Catharina, stellt sich der Polizei als Kronzeugin zur Verfügung, und Dossantos "Buchhalter" (das ist letztlich immer die entscheidende Position, für Al Capone ebenso wie für Dossantos) schafft Geld beiseite, bevor er unter merkwürdigen Umständen Selbstmord begeht.
Polizei, Politik, Konkurrenz und ein bis zum Schluss unidentifizierter Akteur scheinen sich auf Dossantos einzuschießen. Was nur dazu führt, dass er sich seiner alten Zeiten und Kompetenzen erinnert und aufzuräumen beginnt.
Wie nicht anders Feige, der Autor, selbst schließlich einzusehen scheint, dass er das, was er angerichtet hat, auch irgendwie aufräumen muss. Vor das Aufräumen hat der Herr jedoch das Dreckigmachen gesetzt. Und Dreckigmachen heißt in diesem Fall: Figuren einführen, Fälle anreißen, Handlungs- und Ursachenketten unvollständig, Motivationen im Unklaren lassen. Und damit bloß keine Übersichtlichkeit aufkommt (das nennt man wohl Spannungsaufbau), werden die Erzählstränge in kleine Stücke gehackt und mit stilistischen Cliffhangern versehen. Irgendwer spricht zu irgendwem irgendwas, aber wer das ist und wie er das meint - dazu später.
Das ist in der Tat ein gängiges und einigermaßen taugliches Mittel, einen Text voranzutreiben. Und gelingt das auf rund 600 Seiten, ist das eine beachtliche Leistung - wie hier generell gesagt sein soll, dass es eine respektable Leistung ist, überhaupt einen Roman zu schreiben. Das kann nicht jeder, und erst recht kein Rezensent.
Auch wenn Feiges Roman gelegentlich ein wenig überfrachtet scheint und auf der Suche nach der originellen Anlage das Ganze doch ziemlich kompliziert wird, hat er seinen Fortgang doch wohl einigermaßen im Griff. Und er macht - wie gesagt - am Ende auch alles sauber, was er schmutzig gemacht hat: Täter werden überführt und die wirklich Bösen werden ihrer gerechten Strafe zugeführt. Das Leben bleibt zwar so wie es ist, aber alle, die übrig bleiben, haben ihre Blessuren davongetragen, der Kommissar steht ohne Geliebte da, der Unterweltkönig ohne Frau und Sohn. Jaja, so ist das. Immerhin aber ist die richtende Gewalt, die dafür sorgen soll, dass "der Gesellschaft die Realität" vorgeführt werden soll (hört sich schmerzhaft an und tut auch weh), am Ende wieder frei und wird wohl für Fortsetzung sorgen.
Dass die Prostitution neuerdings - eben auch bei Feige - eine einigermaßen legitime sozial- und individualhygienische Legitimation erhält, ist angesichts des Übermaß an Moralin, das sonst in Sachen Sexualität verabreicht wird, einigermaßen erholsam. Freilich bleibt der Eindruck, dass die Einsicht in die polymorphen Neigungen, die in gegenseitigem Einverständnis befriedigt werden, doch nicht ganz alltagstauglich ist, wie es - gelegentlich - auch bei Feige durchscheint. Aber auch das werden wir sehen.
|
||