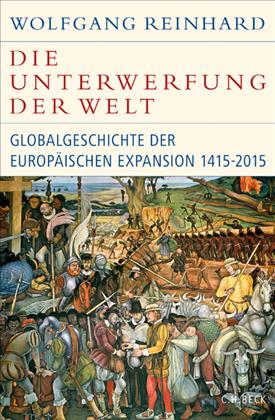Transatlantiker
Martin Pollack über den Völkerstrom von Galizien in die Vereinigten Staaten
Von Daniel Krause
Martin Pollack, Slawist und Historiker, ehemals „Spiegel“-Korrespondent, hat seit den 1980er-Jahren die historische Landschaft Galizien, das südliche, Österreich zugefallene Teilungsgebiet Polens, für deutsche Leserschaften wiederentdeckt. Wie sonst nur Wenige, darunter Wolfgang Büscher und Karl-Markus Gauß, hat Pollack dazu beigetragen, vernichtete und vergessene Welten vor der Haustür der Deutschen und Österreicher erneut ins Bewusstsein zu rücken. Sein jüngstes Buch, der Massenauswanderung aus Galizien um die Jahrhundertwende gewidmet, hält die Mitte zwischen sachlich referierendem Duktus und literarischer Verdichtung. An populären, dabei sachlich akkuraten Darstellungen der Wanderungsbewegungen herrscht wahrlich kein Überfluss. Umso wichtiger ist diese Neuerscheinung.
Mit Präsens und erlebter Rede, in schnörkelloser Syntax und wohlgesetzten Worten werden verschiedene Lebenswege polnischer, ukrainischer, slowakischer und jüdischer Auswanderer charakteristisch vergegenwärtigt. Mit ihren ‚Geschichten‘ wird, in nüchterner, luzider Weise sowie mit Empathie und Diskretion, ,Geschichte’ anschaulich gemacht. Hierin liegt Pollacks besondere Kunst: Den Archiven entnimmt er beispielhafte Lebensläufe, versieht sie mit Gesicht und Namen, ergänzt behutsam psychologische Details und füllt das archivierte Material mit Atem und Präsenz. In der effektvoll suggestiven Platzierung historischen Bildmaterials kommt Pollack W. G. Sebald nahe. Die Fotografien sind Pollacks „Privatarchiv“ entnommen und können als erstrangige Quelle dienen.
Was die inhaltliche Seite betrifft, nimmt die jüdische Auswanderung in der Darstellung breiten Raum ein, und dies aus guten Gründen: „In den achtziger Jahren sind sechzig Prozent aller Emigranten aus Galizien Juden, und das bei einem Bevölkerungsanteil von rund zehn Prozent. […] Noch in den neunziger Jahren liegt der jüdische Anteil an der Auswanderung aus Galizien bei etwa vierzig Prozent. Zwischen 1881 und 1910 macht sich mehr als ein Viertel der in Galizien lebenden Juden in die Vereinigten Staaten auf.“
Dass ausgerechnet Auschwitz – Österreichs Grenzbahnhof zum preußischen Oberschlesien – zum Nadelöhr der den Nordseehäfen zustrebenden, von hartgesottenen Hapag- und Norddeutscher-Lloyd-Agenten umworbenen jüdischen Auswanderer wird, muss als finsterer Treppenwitz der Geschichte gelten. Mit Bremen und Hamburg, den bevorzugten Ausreisehäfen der Amerikafahrer, kommen auch deutsche Verhältnisse in den Blick, so die notorische Hamburger Cholera-Epidemie des Jahres 1892, für die reflexhaft osteuropäische Auswanderer in Haftung genommen wurden.
Besondere Aufmerksamkeit wird dem Mädchenhandel gewidmet. Europas und Amerikas Bordelle waren um die Jahrhundertwende voller junger, oft minderjähriger Frauen jüdisch-galizischer Herkunft, die, teils sehenden Auges, teils fadenscheinigen Verheißungen der Schlepper folgend, nach Istanbul, New York oder Petersburg gezogen waren, um heimischem Elend zu entrinnen. Dies ist ein gern übersehener Aspekt der glanzvollen francisco-josephinischen Dekadenzphase Österreich-Ungarns: Die Armut in einigen Landesteilen war derart, dass Österreich trotz (wenig konsequenter) polizeilicher Kontrollen zu den weltweit führenden Menschen-Lieferanten zählte, wie heute Moldawien, die Ukraine oder Staaten der ‚Dritten Welt‘. „Nach vorsichtigen Schätzungen werden im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert aus Galizien pro Jahr ungefähr 10.000 Mädchen allein nach Südamerika gebracht […].“
Pollack weist auf politische Hintergründe der Auswanderung hin: Mochten galizische Juden wie katholische Polen als Armutsflüchtige aus wirtschaftlichen Erwägungen (durchaus mit Rückkehrperspektive) nach Amerika streben, so waren russische Juden, die Galiziens Grenzstädte zum Zarenreich passierten, nicht selten von Angst vor Pogromen getrieben. Solche Ängste übertrugen sich teils auf Galiziens Juden, zumal dem bäuerlich-kleinbürgerlichen christlichen Mob antisemitische Ressentiments keineswegs fremd waren. Zuweilen konnten sich diese auch in Galizien gewaltsam entladen. Massiver Polizei- und Militäreinsatz hielt solche Ausschreitungen, anders als im Zarenreich, im Zaum.
Auch die andere, ökonomische Seite – der Blick der Reeder und Agenten eingeschlossen –, wird kenntnisreich gewürdigt: „Die wichtigsten europäischen Atlantikhäfen, Hamburg, Bremen, Le Havre, Rotterdam, Antwerpen und Liverpool kämpfen mit allen erdenklichen Mitteln um die Emigranten. Die Zwischendeckpassagiere sind in aller Regel arme Schlucker, doch im Frachtgeschäft über den Nordatlantik erlangen sie als so genannte Ausfracht zunehmende Bedeutung. Die Schiffe transportieren Rohstoffe von Amerika nach Europa, in die andere Richtung finden sie jedoch nur selten genügend Ladung. Da kommen die Auswanderer gerade recht. […] Mit dem rasanten Ansteigen der Auswanderung wird die Beförderung von Zwischendeckpassagieren bald zum Hauptgeschäft der großen Schifffahrtslinien.“
Martin Pollack tut gut daran, unter den Unternehmern des Schifffahrtsgeschäfts Albert Ballin (Hapag) besonderes Augenmerk zu schenken: Ballin ist Jude, Unternehmer von Genie, Erfindungsgeist und Einfluss (auch am deutschen Kaiserhof), bei alledem ein überzeugter Europäer – als „Hofozeanjuden“ schmähen ihn Neider und antisemitische Kreise. Ballin, der als Erfinder des ‚Zwischendecks‘ wie der ‚Kreuzfahrten‘ gilt, hat die Massenauswanderung logistisch erst ermöglicht. Er stirbt, wahrscheinlich von eigener Hand, am 9. November 1938, dem wohl beziehungsreichsten Datum deutscher Geschichte. Mit sicherem dramatischem Gespür hat ihm Pollack den letzten Passus des Buches gewidmet: „Völlig zum Erliegen kommt die Auswanderung von Galizien nach Amerika mit Ausbruch des Krieges 1914 […]. Der aufgeschlossene Kosmopolit Ballin hat sich stets bemüht, den Krieg zu verhindern, trotzdem stellt er gehorsam die Schiffe seiner Hamburg-Amerika-Linie in den Dienst der deutschen Flotte. Als der Krieg verloren geht, scheint auch die Zerstörung seines Lebenswerkes […] besiegelt.“
|
||