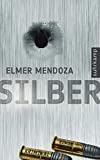Stilistischer Extremismus
Elmer Mendoza legt mit „Silber“ einen stilistisch ambitionierten Krimi vor
Von Walter Delabar
Das klassische stilistische Maß des Kriminalromans ist die Zurückhaltung. Das hat seinen guten Grund, denn allzu extensive Schreibexperimente kommen nicht gut an in einem Genre, in dem Nachvollziehbarkeit die Basis der Aufklärung ist. Wenn die Leser ihrem Autor nicht mehr folgen können, dann haben sie auch nichts mehr davon, dass er seine Figuren (wenn es solche überhaupt dann noch gibt) seine Fälle mit Bravour lösen lässt (wenn es dann Fälle und Lösung überhaupt noch gibt).
Die engen Grenzen des Genres, das der Unterhaltung und damit einem realistisch genannten Duktus verpflichtet ist, verbieten das stilistische Extrem. James Joyces „Ulysses“ könnte ein Krimi sein (ist keiner), niemand würde es merken. Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“ spielt immerhin im kriminellen Milieu, was ihm aber nichts nützt, wenn man ihn als Kriminalroman verstehen wollte.
Für das Problem, dass auch intelligente und ästhetisch gebildete Menschen Krimis lesen wollen, hat es verschiedene Lösungen gegeben. Eine davon verschiebt das Interesse auf das Rätsel und seine Lösung, andere probieren immerhin stilistisch etwas. Jerome Charyn gehört dazu, Heinrich Steinfest ebenfalls und nun eben auch Elmer Mendoza.
Dabei ist sein Sujet durchaus konventionell. Ein junger Mann aus der mexikanischen Oberschicht wird – mit einer Silberkugel – erschossen aufgefunden. Der Ermittler ist unerschütterlich, erst recht, wenn er korrumpiert werden soll. Der Fall ist symbolisch. Das Ganze drumherum – Mexiko, Drogenhandel, Gewaltexzesse – ist blutig genug. Das Ambiente ist insgesamt genau so, wie man es sich für den jüngeren mexikanischen Krimi vorstellt. Der Vorhof der USA ist nicht anders als andere Krimischauplätze ein Hort des Bösen und der Eintritt ins Höllenfeuer. Auch erfahren wir viel über die Vorlieben und Abneigungen des Protagonisten, inklusive Trink- und Liebesgewohnheiten.
Insofern ist mit Mendozas Krimi alles genau so, wie es sein soll. Wenn da nicht der große Stilwillen des Autors wäre. Mendoza, anscheinend ein Literaturprofessor (was immer das heißen mag), ist offensichtlich belesen und aufmerksam genug, um sein Krimi-Debüt stilistisch in der Tat zu einem außergewöhnlichen Exemplar seiner Gattung zu machen.
Keine Frage, Mendoza winkt immer wieder mit Lesefrüchten aus dem internationalen und mexikanischen Bildungskanon. Aber das stört nicht weiter. Interessanter und auf die Dauer tragfähiger ist jedoch Mendozas Schreibstil selbst. Die enge Verknüpfung der Figurenreden und deren Verschneidung mit der Erzählerstimme irritieren zwar anfangs. Immerhin muss man sich orientieren, was aber auffallend schnell geht.
Dann nimmt der Text Fahrt auf und entwickelt eine wunderbare anarchische Qualität. Die Komposition, die auf den ersten Blick so chaotisch wirken, ist anscheinend präzise komponiert. Die Erzähler- und Figurenstimmer zeigen ein erzählerisches Konzept an, das für Dynamik und Vitalität steht. Genau also das, was wir von einem mittelamerikanischen Autor erwarten.
Dass dabei die Konstruktion des Falles und seine Lösung fast schon nachrangig werden, bleibt nicht aus. Mendozas Hauptfigur, der verkrachte Detektiv Edgar Medieta, genannt Zurdo, übernimmt stattdessen die Hauptlast, den Leser zu vergnügen.
Vielleicht auch deshalb lernen wir über ihn mehr, als wir es müssten, wenn die Figur denn funktionieren würde. Das aber tut sie leider nicht. Zurdo geht derart unberührt durch das Chaos, das er selber zum Teil anstiftet, dass man um die Anlage der Figur fürchten muss. Er liebt und er leidet natürlich, er wird von seinen Vorgesetzten geschurigelt, die Kriminellen feuern auf ihn, wie und wo sie nur können.
Aber merkwürdiger Weise bleibt er ungetroffen und zeigt sich auch in der Öffentlichkeit unbeeindruckt. Insgesamt also ein unrealistisches Stück Literatur, das Vergnügen aber aus seinem Stil stiftet. Auch das Finale, das den Helden wieder in den Mittelpunkt rückt, ändert daran nichts. Dieser Mann und diese Konstruktion sind gewollt, das scheint gelungen zu sein, auch das Krimietikett kann man dem Text getrost überlassen. Aber wiederholen wird man diese Technik jedoch kaum.
Warum: Interessante Muster werden verbraucht in dem Moment, in dem sie interessant sind. Ein stilistisch gewollter Roman kann nicht einfach eine alte Masche wiederholen, das macht die Vergänglichkeit von Texten aus. Insofern kann man gespannt sein, ob Mendoza einen weiteren Krimi nachschieben kann, oder ob er sich einer anderen Hauptfigur und vor allem eines anderen Stils bedienen wird. Und was das dann sein wird.
|
||