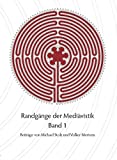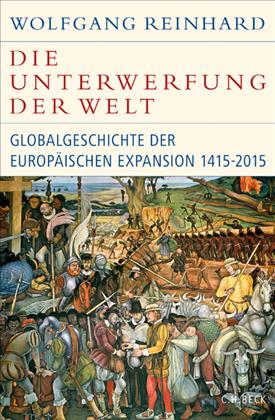Ein Hauch von Luxus im Irrgarten
Michael Stolz und Volker Mertens über entlegene Themen der Mediävistik
Von Alissa Theiß
„Randgänge der Mediävistik“, mit diesem zunächst ungewöhnlich anmutenden Titel hat das Institut für Germanistik der Uni Bern unlängst eine neue Reihe zu mediävistischen Themen eröffnet. Und wie der Titel vermuten lässt, handelt es sich dabei um eher weniger gut erforschte Phänomene der mittelalterlichen Kultur. Auf dem Cover ist eine stilisierte Abbildung des Labyrinths der Kathedrale in Chartres zu sehen, welche schon programmatisch auf die in der Reihe behandelten Themen und den Umgang mit ihnen hinweist. Im Vorwort heißt es, die Beiträge des ersten wie auch der kommenden Bände „unternehmen interdisziplinäre Grenzgänge an den Rändern der verschiedenen mediävistischen Disziplinen“ – das macht neugierig und lässt auch auf neue Herangehensweisen an alte Themen hoffen. Zeitlich widmen sich die „Randgänge“ den Jahrhunderten vor 1500, daneben stehen aber auch die Mittelalterrezeption der Moderne und der Vergleich mit der Gegenwart auf dem Programm.
Der erste Band beinhaltet lediglich zwei Beiträge, von denen der namensgebende erste den Einstieg in das Thema bietet. Dabei handelt es sich um die zu Papier gebrachte und überarbeitete Version der Antrittsvorlesung von Michael Stolz aus dem Jahr 2007. Bevor Stolz sich der Definition des Terminus „Mittelalter“ widmet, gibt er dem Leser eine zunächst verwirrend vielfältige Einführung in den Gegenstand des Randes, des Randständigen und Marginalen, der – nur durch ihre Ränder bestimmbaren – Mitte, der Grenzen und Grenzübergange und gelangt so schließlich zu Randphänomen des Mittelalters. Dabei sind „Randphänomene“ hier sowohl im übertragenen Sinn wie auch ganz konkret, etwa als lexematische Belege des Randes in mittelalterlichen Werken, zu verstehen.
Im Folgenden untersucht der Autor die Relation von Rand und Zentrum im Mittelalter, wozu er verschiedene Quellen heranzieht. Den Anfang bildet Otfrids von Weißenburg „Evangelienharmonie“, die mit der Abbildung eines Labyrinthes – man wird zwangsläufig an das Cover des Buches, das man selbst gerade in der Hand hält, erinnert – beginnt. Bevor Stolz zur Interpretation dieses Befunds ansetzt, wird eine kurze Geschichte des Labyrinths in Altertum und Mittelalter eingeschoben und erklärt, wie das antike Labyrinth der Theseus-Sage zum Symbol der Verstrickung des Menschen in der sündigen Welt wurde. Diese christliche Ausdeutung findet sich auch bei Otfrid und somit erklärt sich die Labyrinth-Darstellung als ‚Initium‘ seiner „Evangelienharmonie“. Überwunden werden kann die „sündige Welt“ durch die Anerkennung der christlichen Weltordnung, dargestellt durch das Kreuz, das sich als Illumination gegen Ende der Handschrift findet und auf die vorangegangene Labyrinthdarstellung Bezug nimmt. Beide Bildseiten sind als ganzseitige, farbige Abbildungen wiedergegeben, wie übrigens auch die meisten der anderen besprochenen Quellen. Die Überwindung des Labyrinths durch die Kreuzform wird auch an weiteren Beispielen gezeigt und der Autor kommt zu der Zwischenbilanz, dass das besondere der Labyrinthe darin besteht, dass „der Rand mit dem Zentrum über Umwege verbunden ist und dabei der vermeintlich entfernteste Punkt dem Mittelpunkt nahe stehen kann“, das Kreuz als Ordnungsgeber hingegen den Weg aus den Irrgängen weist. Über den Weg der Besprechung der Bilderdecke der St. Martin-Kirche in Zillis, Graubünden, die das Leben Jesu zeigt, gelangt Stolz schließlich zu mittelalterlichen Weltkarten, während der Leser hofft, den roten Faden durch die labyrinthische Themenvielfalt noch nicht komplett verloren zu haben. Am Beispiel der Ebstorfer Weltkarte macht der Autor deutlich, wie sich die Labyrinthstruktur auch in der Abbildung der mittelalterlichen Welt spiegelt und wie auch hier das Kreuz als großes Ordnendes, bei der Ebstorfer Weltkarte in Form einer Christusfigur, die Erde umspannt.
Von den Weltkarten geht es zu anderen, konkreteren Randphänomen, nämlich der mittelalterlichen Praxis des Glossierens von Handschriften sowie des typischen Layouts von Textkommentaren, bei dem der Quellentext in der Mitte steht und vom Kommentar umrahmt wird. Nahezu skurril wird es, wenn am Rande des Haupttexts im „Hausbuch“ des Michael de Leone, also in den Marginalien, Randphänomene der mittelalterlichen Gesellschaft, hier die Geißlerzüge in Würzburg zur Mitte des 14. Jahrhunderts, festgehalten werden.
Glaubte der Leser schon, nach diesen vielfältigen Ausführungen über unterschiedlichste Randphänomene dem Fazit nahe gekommen zu sein, schlägt Stolz, ganz in labyrinthischer Manier, einen weiteren unerwarteten Bogen und beginnt ein völlig neues Kapitel, nämlich über Randphänomene in der Literatur, namentlich Wolframs „Titurel“, der ja bekanntlich an den Rändern der Parzivalhandlung spielt und – um die Verwirrung komplett zu machen – auch noch einen Text im Text zum Gegenstand hat – geschrieben auf einer Hundeleine – dessen Inhalt sich metonymisch auf das Handlungsgeschehen der Liebesgeschichte zwischen Sigune und Schionatulander bezieht. Und dann, beinahe ist man versucht zu sagen ‚endlich‘, kommt Stolz zum Fazit. Ein Fazit in dem er noch einmal alle wichtigen abgeschrittenen Punkte aufgreift, die Struktur der gewählten Beispiele erläutert und daraus auch noch ein Statement über die Wichtigkeit der Disziplin Mediävistik „zum Verständnis einer komplexen Gegenwart“ ableitet. Nach dieser Rückschau erscheint plötzlich alles ganz einfach, logisch und wohl strukturiert und man fragt sich, was einem zuvor eigentlich so verwirrend erschienen ist, denn Stolz’ Beitrag ist durch und durch schlüssig und bietet einen hervorragenden Einstieg in das der Reihe überschriebene Thema.
Größere Schwierigkeiten bietet da leider der Beitrag von Volker Mertens, die aber in erster Linie dem fehlenden Fazit und dem gewählten Titel zuzuschreiben sein dürften: „Luxus in der Mittelalterrezeption. Edward Burne-Jones und das ‚Arts-and-Crafts-Movement’ lautet er. Mertens beginnt seinen Beitrag mit einer knappen Definition der Begriffe Luxus und Mittelalterrezeption und nennt als Anlass für seine Beschäftigung mit dem Thema die Burne-Jones Ausstellung „Das irdische Paradies“, die 2009/2010 in Stuttgart und Bern zu sehen war, auf die er aber nicht weiter eingeht. In zwei kurzen Sätzen erläutert Mertens, dass er im Folgenden die Beziehungen zwischen Edward Burne-Jones und dem Arts-and-Crafts-Movement sowie deren Resonanzen auf Erneuerungsbewegungen im deutschsprachigen Raum, wie dem Deutschen Werkbund, der Wiener Werkstätte und dem Bauhaus, untersuchen wird. Strukturell geht der Autor dabei so vor, dass er die Mittelalterrezeption in drei Bereiche aufteilt, die getrennt beleuchtet werden: Der ikonographische Bereich umfasst das Aufgreifen sowohl bildlicher oder dekorativer Formen des Mittelalters als auch mittelalterlicher Gestaltungsprinzipien. Unter dem thematischen Bereich wird die Wiederbelebung mittelalterlicher Erzählstoffe verstanden. Der dritte Punkt geht auf die Rezeption mittelalterlicher Organisationsformen im Handwerk (Stichwort „Bauhütte“) ein.
Zunächst widmet sich Mertens der Entstehung der ‚Pre-Raphaelite Brotherhood’ und den Vorbildern, die Burne-Jones geprägt haben, schiebt dann aber ein Kapitel über die Wiederentdeckung mittelalterlicher Erzählstoffe in England gegen Ende des 18. Jahrhunderts ein – konkret der Wiederentdeckung von Thomas Malroys „Morte Darthur“ – das in einen längeren Abschnitt über den viktorianischen Dichter Alfred Tennyson mündet. Tennyson hatte den Gral-Stoff durch seine 1842 veröffentlichte Ballade „Sir Galahad“ nicht zuletzt bei den Präraffaeliten bekannt und beliebt gemacht. An dieser Stelle bespricht Mertens unterschiedliche Umsetzungen des Gral- beziehungsweise Arthurstoffes in das Medium Bild durch Dante Gabriel Rossetti, allerdings ohne Abbildungen der diskutierten Gemälde beizugeben. Wenn – lässt man die einführenden Worte außer Acht – bisher noch nichts zu Burne-Jones gesagt wurde, so findet sich jetzt immerhin schon ein Kommentar zum im Titel angekündigten Luxus: „Mittelalterrezeption ist bei Rossetti noch nicht zum Luxus entfremdet. Diesen Weg werden erst Edward Burne-Jones und William Morris beschreiten.“ Bis dorthin gilt es aber noch ein gutes Stück Weges zurückzulegen. Zunächst werden nämlich die sogenannten Gralfenster besprochen, die Burne-Jones in Anlehnung an Malroys „Morte Darthur“ 1885/86 für die Küche seines Hauses entworfen hatte. Auch hier keine Abbildungen, dafür aber Umschriften der begleitenden Spruchbänder, die leider nicht immer ganz korrekt wiedergegeben sind: Bei der Besprechung des dritten Fensters liest man nämlich „how galahad sought the sangreal and found it because his heart was single […]“. Glücklicherweise löst sich das Rätsel des alleinstehenden Herzens auf der nächsten Seite. Dort wird nämlich noch einmal auf genau diese Stelle Bezug genommen, wo es heißt, die Gralfenster hatten den Zweck, im Alltag die Präsenz des Ideals zu evozieren. „Um es zu erreichen, muss sich das Herz von der Verstrickung in Liebe und Ruhm abwenden, simple sein, wie es von Galahad heißt, unverstellt, aufrichtig.“
Unter Bezugnahme auf seinen dritten Bereich der Mittelalterrezeption, die Orientierung an mittelalterlichen Produktions- und Vertriebsweisen, erläutert Mertens am Beispiel der Arts-und-Crafts-Bewegung, wie die Produkte von Morris & Co von der für jeden erschwinglichen Utopie des Schönen zu Statussymbolen der High Society wurden. Diese Entwicklung führt der Autor auf die veränderte Mode zurück: Nachdem der überladene Stil des 18. Jahrhunderts passé war, suchte die Oberschicht nach etwas Neuem, mit dem sie ihre repräsentativen Häuser auszustatten gedachte. Die außergewöhnlichen Ideen der Arts-und-Crafts-Bewegung kamen da gerade recht. Exemplarisch für diese Entwicklung stehen die Graltapisserien, die Morris und Burne-Jones 1890/91 für William Knox d’Arcy, dem Gründer von British Petroleum, entwarfen. Hier finden sich in Mertens Beitrag nun auch endlich Abbildungen zu den besprochenen Kunstwerken, wenn auch nur drei an der Zahl und diese sehr kleinformatig.
An dieser Stelle muss man sich fragen, warum der erste Beitrag, der sich nicht explizit mit bildender Kunst beschäftigt, mehr und größere Abbildungen enthält, als dieser, wäre doch ein gemeinsames Layouten beider Aufsätze nahe liegend gewesen, was aber offensichtlich nicht geschehen ist.
Bei der Diskussion der Tapisserien, wie auch bei der Besprechung vorangegangener Werke, geht Mertens auch immer auf den Umgang der Künstler mit dem rezipierten Stoffkreis ein und macht Veränderungen in der Auslegung, allen voran bei der Interpretation des Grals, deutlich. Nach der Vorstellung der Graltapisserien als Paradebeispiel des Oberthemas „Luxus in der Mittelalterrezeption“, hätte sich an dieser Stelle eigentlich ein Fazit und das Ende des Beitrags angeboten, denn auch der Edward Burne-Jones und die Arts-und-Crafts-Bewegung des Untertitels werden auf den folgenden Seiten nicht mehr thematisiert. Stattdessen schließen sich zwei Kapitel zur Wiener Werkstätte und zum Bauhaus an, die dem Beitrag ein heterogenes Gepräge geben und mit den – durch den gewählten Titel heraufbeschworenen – Erwartungen des Lesers nicht recht in Einklang zu bringen sind. Statt eines Fazits, das beim vorangegangenen Beitrag von Michael Stolz den krönenden Abschluss bildete, schlägt Mertens am Ende einen Bogen von der Nachkriegs-Architektur über die Postmoderne bis hin zu Unternehmen unserer Zeit, die damit werben, noch immer handwerklich hergestellte Dinge zu vertreiben. Die Produkte einer bestimmten Firma (deren Name hier nicht wiedergegeben wird) kommentiert Mertens folgendermaßen: „Es ist zwar kein Luxus mehr, sich damit einzurichten, doch ist auch hier der Charakter sozial distinguierender ‚Life-style-Accessoires‘ unverkennbar.“ Und daran zeigt sich dann mal wieder, dass „Luxus“ doch irgendwie relativ ist, denn wenn auch offensichtlich nicht für den Autor, so würde es doch zumindest für die Rezensentin durchaus Luxus bedeuten, einige, der dort angebotenen Gegenstände zu erwerben.
Mit Labyrinthen, luxuriöser Mittelalterrezeption und anderen „Marginalien“ wurden im ersten Band der „Randgänge der Mediävistik“ in der Tat entlegenere Gebiete des Fachs untersucht. Der Beschäftigung mit explizit ungewöhnlichen Themen einen Raum zu schaffen, ist eine viel versprechende Idee, denn bisher wenig beachtete aber des Erforschens würdige Randphänomene der mittelalterlichen Kultur gibt es zu genüge.
|
||