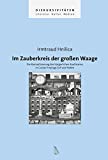Romantischer Realismus eines vergessenen Bestsellers
Irmtraud Hnilica unternimmt eine poetologische Neupositionierung von Gustav Freytags „Soll und Haben“
Von Manuel Bauer
Nachdem es sehr lange ruhig um einen der erfolgreichsten Romane der deutschen Literaturgeschichte war, hat die Forschung in den letzten Jahren, wenn auch noch zögerlich, Gustav Freytags problematischen Kaufmannsroman „Soll und Haben“ von 1855 wiederentdeckt. Problematisch ist dieses Buch nicht allein deswegen, weil es als epochenübergreifender Bestseller mit dem Ruch des Trivialen behaftet war, sondern vor allem aufgrund der, vorsichtig gesagt, unappetitlichen Schilderungen von Juden und Polen, die mit einem deutschnationalen Chauvinismus auf das Beste zu vereinbaren sind.
Diese Aspekte waren es zumeist, die von der Forschung, wenn überhaupt, aufgegriffen wurden. Die unrühmliche Geschichte der hermeneutischen Verrenkungen der Freytag-Forschung, die versuchte, den bezeugten Liberalismus des Autors mit der antisemitischen Erzählstrategie des Romans zu versöhnen, indem man letztere herunterspielte, soll hier nicht erzählt werden. Ganz vergessen werden darf dieser Zusammenhang aber nicht – obwohl oder gerade weil Irmtraud Hnilicas Studie „Im Zauberkreis der großen Waage. Die Romantisierung des bürgerlichen Kaufmanns in Gustav Freytags ‚Soll und Haben‘“ sich bewusst jenseits politisch ausgerichteter Interpretationen positioniert. Weder eine Rettung noch eine Verurteilung von Autor oder Text will Hnilicas Lektüre leisten. Die Verfasserin bemängelt an der bisherigen Forschung, dass der Roman bislang kaum je als literarischer Gegenstand beachtet, sondern zumeist als Symptom der Mentalität des 19. Jahrhunderts oder als Ausdruck politischer Tendenzen gelesen worden sei. Es wirkt beinahe wie eine Trotzreaktion, wenn Hnilica ihren Ansatz begründet: „Da die Forschung ihre Aufmerksamkeit in der Vergangenheit jedoch einseitig und häufig ohne Berücksichtigung der anderen Dimensionen auf die politische Aussage von Freytags Roman gerichtet hat, soll hier die Konzentration auf literaturgeschichtliche und poetologische Aspekte erfolgen.“ Bei aller Anerkennung für die originelle und eigenständige Lektüre und Sympathie für die als eine Begründung genannte „Freude am akademischen Dissens“: Dass die als „ideologiekritisch“ markierten Deutungen eines politisch hochgradig belasteten Textes beiseitegeschoben werden, ist heikel, da so der Eindruck erweckt wird, als wolle eine kulturtheoretisch avancierte Überinterpretation die eindeutig antisemitische Erzählstrategie einfach überschreiben.
Das ist nicht der einzige verblüffende Aspekt von Hinilcas Ansatz. Geleistet werden soll eine poetologisch ausgerichtete Interpretation, die einen der wegweisenden und populärsten Texte des Bürgerlichen Realismus aber nicht etwa vor dem Hintergrund des programmatischen Realismus, sondern in der Tradition der Romantik zu deuten sich anschickt, da im Rekurs auf die Romantik die Besonderheit von „Soll und Haben“ liege. Die Romantisierung, derer Freytag sich bediene, sei „als eine spezifische Strategie der Verklärung zu verstehen“ und daher mit dem Literaturprogramm des Realismus kompatibel. Allerdings bleibt dies diffus, da zum einen doch immer wieder Unterschiede zwischen romantischer und realistischer Programmatik herausgestellt werden. Zum anderen ermangelt es der Studie an einem klaren Realismus-Begriff. „Realismus“ wird offenbar eher mit fotografischem Realismus oder mit Naturalismus gleichgesetzt als mit einer ihrerseits nur bedingt mimetischen, im Kern idealisierenden literarischen Programmatik.
Als exemplarische romantische Texte zieht Hnilica „Heinrich von Ofterdingen“ von Novalis und E. T. A. Hoffmanns „Die Elixiere des Teufels“ heran und gewinnt aus ihnen Motive und Deutungsmuster, die sie auf Freytags Text bezieht. Von besonderer Wichtigkeit ist die Darstellung romantischer Künstlerfiguren, die als Vorläufer von Freytags Kaufmannsfigur in Anspruch genommen werden. Ob dabei die Wahl von Hoffmanns „Elixieren“ allzu glücklich ist, darf bezweifelt werden. Es gäbe etliche romantische Texte, die sich für die Exemplifizierung einer Künstlerfigur besser eignen würden. Neben der romantischen Kunstreligion, in deren Nachfolge die bürgerliche Kaufmannsreligion Freytags gedeutet wird, sind vor allem Raumkonfigurationen von Interesse. Auf der Grundlage des „spatial turn“ werden unter anderem das Kontor der Handlung, das deutsch-polnische Grenzgebiet und die im Roman erwähnte „Hauptstadt“ beachtet. Die Raumdarstellung sei dabei dezidiert nicht mimetisch, sondern erinnere an seelische Introspektionen, wie sie aus der Romantik vertraut seien, weshalb die Raumkonfigurationen von „Soll und Haben“ ebenfalls romantisch seien.
„Soll und Haben“ wird, darin dem romantischen Roman verwandt, als „Wiederverzauberung der Welt“ gelesen, da unter anderem eine Poetisierung der Arbeitswelt geleistet werde. Die ökonomischen Aspekte des Romans werden immer wieder gestreift, vor allem aber ist es Hnilica um den Nachweis zu tun, dass der Kaufmann ein Nachfolger des romantischen Künstlers ist. Das ist insofern stimmig, als Freytag im kaufmännischen Handeln poetische Aspekte erkennt und seine idealisierten Kaufmannsfiguren nicht als Vertreter des Mitte des 19. Jahrhunderts prosperierenden Kapitalismus zeichnet, sondern als traditionsbewusste Wirtschaftakteure, denen Menschlichkeit und Materialität wichtiger ist als Beschleunigung und Virtualität. Inwiefern aber T. O. Schröter, die maßgebliche Kaufmannsfigur bei Freytag, als Künstler angesehen werden kann, bleibt offen.
So plausibel der Nachweis romantischer Techniken bei einem der zentralen Texte des Bürgerlichen Realismus im Einzelnen auch ist: Ein ums andere Mal stellt sich die Frage, ob die Nähe von Freytag zur Romantik nicht überstrapaziert wird. In „Soll und Haben“ einen selbstreflexiven Text zu sehen, der auch von den frühromantischen Romantheoretikern goutiert worden wäre, fällt schwer, um nur ein Beispiel zu nennen. Häufig wird ein Schlagwort benutzt, um Texte miteinander in Verbindung zu setzen. Das ist attraktiv, aber auch stark assoziativ, so dass der exegetische Nutzen nicht immer ersichtlich wird und sich die Lektüre in Referenzen verliert. Hnilica verfällt etwas zu häufig der Versuchung, alles mit allem zu vergleichen. Mit bemerkenswerter Belesenheit werden zahlreiche Einzelaspekte aufgespürt, die mit avanciertem kulturtheoretischem Instrumentarium – neben in den letzten Jahren verstärkt diskutierten raumtheoretischen Fragen stellt die Studie unter anderem gendertheoretische oder psychoanalytische Überlegungen an – erhellt werden. Das ist im Detail oft überzeugend, allerdings leiden unter all den klugen Assoziationen die Stringenz der Argumentation und damit die Lesbarkeit. Doch auch wenn nicht alle Beobachtungen in letzter Konsequenz zu überzeugen vermögen ist kaum zu bezweifeln, dass dieses Buch eine gewichtige Rolle in der (gleichwohl noch immer überschaubaren) Freytag-Forschung spielen wird, da viele bislang noch nicht entdeckte Spuren aufgezeigt werden.