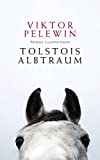Flirrender Parcoursritt durch die Geistesgeschichte
Über Viktor Pelewins Roman „Tolstois Albtraum“
Von Roman Halfmann
Es hebt an mit dem pointierten Aufruf der Klischees russischer Literatur, nämlich dem Geistlichen Paissi und dem Eisenwarenhändler Knopf, die sich während der gemächlichen Fahrt in der Eisenbahn über den berühmt-berüchtigten Graf T. unterhalten, welcher dem kirchlichen Glauben abgeschworen habe und daher von der Geheimpolizei gesucht werde. T. jedoch, ein Kampfkunstmeister allerhöchsten Grades, entkomme den Häschern immer wieder und sei zudem, wie Knopf verschwörerisch zwinkernd ergänzt, ein Verwandlungskünstler und schlüpfe als ein solcher gar zu gerne in die Kutte der Geistlichkeit. Kurz darauf fährt der Zug in einen Tunnel, und als die Sonne wieder ins Abteil scheint, ist Knopf bewusstlos und Paissi, natürlich niemand anderes als T., springt todesmutig aus dem Fenster und landet punktgenau in einem See.
Hier bleibt er aber nicht lange allein, naht doch eine von Sklaven angetriebene Galeere, in ihr eine Frau, die sich als Fürstin vorstellt und T. einen aus Fischen zusammengesetzten Drachen als Mahlzeit serviert – ein unappetitliches Konstrukt, welches dermaßen heiß diskutiert wird, dass es ein symbolische Darstellung des Romans sein muss: „Auf den ersten Blick scheint da ein echter Drache zu liegen – das sagt uns unser Gefühl. In Wirklichkeit aber sind es verschiedene Fische, die einander im Leben nicht einmal gekannt haben und jetzt einfach zusammengefügt wurden.“ Kurz darauf ist die Fürstin ermordet und mit ihr alle Menschen auf der Galeere – nur T. nicht, dem plötzlich ein Dämon erscheint, der sich Ariel nennt und erklärt, er, also Ariel, habe nicht nur die Welt um T., sondern auch T. selbst erschaffen und kontrolliere diesen auch in eben jenem Augenblick. Und damit beginnt T.s Suche nach dem Sinn seines Handelns und der Beantwortung der Fragen, weshalb es ihm immer wieder gelingt, trotz diverser aussichtsloser Situationen den Verfolgern unverletzt zu entkommen, warum diese Verfolgungen stets dermaßen spannend und exotisch ausgestaltet sind und warum zum Teufel er eigentlich Tolstoi heißt – derweil ein mürrischer Dostojewskij in einem Computerspielsetting Zombies erschießend um die tägliche Portion Mana kämpft.
Pelewin hat also einen neuen Roman geschrieben, in Russland bereits 2009 erschienen und diesmal von Dorothea Trottenberg und nicht Andreas Tretner übersetzt, was Pelewin, neben Vladimir Sorokin der Rabauke der russischen Moderne, einen etwas klassizistischen Glanz verleiht, aber in sich stimmig ist, legt der streitbare Russe nach einigen anstrengenden Experimenten doch endlich wieder ein Meisterwerk vor, welches mit „Buddhas kleinem Finger“ gleichzuziehen vermag. Gut, anstrengend bleibt es und dem Leser ist mit einer Vielzahl von Handlungsebenen, Zeiten und kabbalistischen Diskussionen ein geradezu undurchdringlicher Brocken zur Hausaufgabe gestellt. Doch macht der Roman eben aufgrund des flirrenden Stils und der überbordenden Handlung richtig Spaß.
Grundsätzlich genialisch ist aber die Art und Weise, in der Pelewin jedes Ereignis immer wieder aus unterschiedlichen Perspektiven bricht und damit stets andersartig motiviert: So wird die Erwartungshaltung des Lesers, der ja geschult an der Postmoderne die dräuenden Meta-Ebenen bereits erahnt, tatsächlich immer wieder unter- und im nächsten Schritt überlaufen. Glaubt der Leser sich also einmal im Vorteil gegenüber den Protagonisten, ja, gar gegenüber Pelewin höchst selbst zu sein, vermeint also hoffnungsfroh, den Autor ein-, überholt und also in eine bequeme Schublade verfrachtet zu haben, so wird diese Einschätzung zwei Seiten bereits wieder einkassiert und der Leser verbleibt offenen Mundes über die Waghalsigkeit der erzählerischen Manöver. Hier wird ganz bewusst ein Bruch mit den herkömmlichen Vorstellung über Literatur und literarische Produktion angestrebt und dieses Ziel auch erreicht, wie auf der Inhaltsebene ausführlich dargelegt, denn Ariel ist in Wahrheit kein Dämon, sondern Teil eines Autorenkollektivs, welches sich abmüht, das Klischee Tolstoi ins neue Jahrtausend zu überführen.
En passant entfaltet Pelewin einen satten Reigen aller erdenklichen sinnstiftenden Welterklärungsmuster und dekliniert diese anhand der zentralen Figur des Grafen T., der vom Actionhelden über einen „Matrix“-Neo-Verschnitt sich zum wahren Urheber all der Turbulenzen um ihn herum zu erheben scheint – jedenfalls bis der wahre Tolstoi in seinem Arbeitszimmer aus einem vielschichtigen Albtraum erwacht. Oder wie? Oder was? – Empfehlenswert, da neben Vollmanns „Europe Central“ die wichtigste und intellektuell belangreichste Veröffentlichung dieses Frühjahrs.
|
||