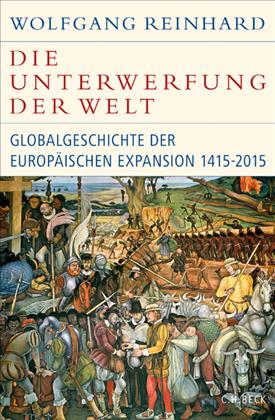Ein Zentrum für die Holocaust-Forschung?
Das 12. Dachauer Symposium zieht Bilanz und sucht Perspektiven für die deutschsprachige Geschichtswissenschaft
Von Martin Munke
Die historische Forschung zum „Dritten Reich“ im allgemeinen und zum Holocaust im besonderen war stets von kontroversen Debatten geprägt. „Intentionalisten“ und „Funktionalisten“ diskutierten darüber, ob die Verbrechen des Regimes primär mit der ihnen zugrundeliegenden Ideologie zu erklären seien, oder ob die von den Nationalsozialisten geschaffenen Strukturen zu einer immer stärkeren Radikalisierung führten. Adolf Hitler erschien in diesem Zusammenhang mal als „starker“, mal als schwacher“ Diktator. Bei Begriffen wie „Volksgemeinschaft“ wird bis heute diskutiert, ob sie als bloße Propagandaformeln zu gelten haben, oder ob ihnen eine wie auch immer gearteter realer Unterbau zugestanden werden müsse. Umstritten war lange, ob lediglich eine kleiner Gruppe fanatischer Nazis – neben der Führungsriege insbesondere die SS – für die Verbrechen verantwortlich gemacht werden könne, und ob der „große Rest“ damit exkulpiert sei. Ambivalent bewertet wurde stets das Verhältnis von Nationalsozialismus und Moderne. Und Ende der 1980er-Jahre wurde im „Historikerstreit“ kontrovers die „Einzigartigkeit“ von Auschwitz diskutiert, zugespitzt in Ernst Noltes Frage, ob nicht der bolschewistische GUlag „ursprünglicher“ gewesen sei als das nationalsozialistische Konzentrationslager. Die Wechselbeziehungen beider Großideologien, die im „Zeitalter der Extreme“ überall auf der Erde Tod und Verderben brachten, bleiben bis heute ein umstrittenes Feld.
Seit dem Jahr 2000 haben sich die von der Stadt Dachau durchgeführten Symposien zur Zeitgeschichte diesen und anderen Streitfragen der Historiografie zum Nationalsozialismus gewidmet. Die 12. Auflage dieser Veranstaltungsreihe, die am 30. und 31. Oktober 2011 stattfand, widmete sich dem Gegenüber zweier grundlegender Forschungsansätze: In der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft wird seit jeher ein Schwerpunkt auf die Täterseite gelegt, ausgehend von dem Bemühen, eine Antwort auf die Frage „Wie konnte es soweit kommen?“ zu finden – und damit zusammenhängend: „Was können wir tun, damit es nie wieder geschieht?“ In der anglo-amerikanisch geprägten Wissenschaft steht demgegenüber eher die Opferseite im Mittelpunkt, institutionell verankert in den großen Forschungszentren von Yad Vashem in Jerusalem und dem United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) in Washington. „Holocaust-Forschung“ ist hierbei ein eigenständiges Forschungsfeld mit Lehrstühlen, Studiengängen und großen Forschungsprojekten. Für beide Ansätze finden sich gute Argumente. Einerseits ist der Holocaust natürlich nur aus der allgemeinen Geschichte des NS-Regimes heraus zu erklären. Andererseits birgt die Konzentrationen auf die Täter immer auch die Gefahr einer Marginalisierung der Opfer mit sich. Hier liegt dann auch ein weiterer Kritikpunkt an mancherorts zur verzeichnenden Tendenz, die „Holocaust Studies“ in den allgemeineren „Genocide Studies“ aufgehen zu lassen, womit wieder die Frage nach der „Einzigartigkeit“ in den Mittelpunkt rückt.
Eine Reihe renommierter Historiker aus Deutschland, Österreich, England und den USA zieht in dem von Michael Brenner, Professor für Jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München, und Maximilian Strnad, Historiker am Münchener NS-Dokumentationszentrum, editierten Tagungsband „Der Holocaust in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft“ für die deutschsprachige Geschichtswissenschaft eine eher negative Bilanz, was die Verankerung des Themas der Vernichtung der europäischen Juden in Forschung und Lehre angeht. Andreas Wirsching, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der LMU und Direktor des IfZ, stellt in einer Auswertung von Lehrveranstaltungen an süddeutschen Universitäten zwar fest, dass die NS-Geschichte hier einen breiten Raum einnimmt. Dem stehe allerdings „eine verhältnismäßig geringe Präsenz des Holocaust entgegen“. Jürgen Matthäus, Leiter der Forschungsabteilung am Center für Advanced Holocaust Studies des USHMM, konstatiert gar, dass ein deutscher Holocaust-Forscher seine Vorhaben „zwar international vernetzt, aber in fachlicher Isolation und mit geringer Aussicht auf beruflichen Erfolg im eigenen Land“ betreibe. Auch Peter Longerich, Professur für Modern German History am Royal Holloway College der Universität London und zuletzt mit großen biografische Studien zu Heinrich Himmler und Joseph Goebbels hervorgetreten, sieht eine „auffällige Diskrepanz […] zwischen der großen Bedeutung, die dem Holocaust in der öffentlichen Debatte zugeschrieben wird und seiner Rolle am Rande der institutionalisierten Forschung in Deutschland“.
Gründe dafür gibt es viele. Der Veranstaltungsort Dachau für das Symposium, aus dem der vorliegende Band hervorging, verweist bereits auf einen davon. Untersuchungen zum Holocaust werden zu einem guten Teil von den Mitarbeitern der breiten Gedenkstättenlandschaft in Deutschland getragen. Die Behandlung dieses Themas weist zudem nach wie vor starke Politisierungen auf, wie an den Debatten um das „richtige“ Gedenken und dem Imperativ „Nie wieder Auschwitz!“ deutlich wird. Eine starke Rolle nimmt der Holocaust auch in der Laiengeschichtsbewegung ein, wie Mitherausgeber Maximilian Strand ausführt. Hierbei stand und steht meist „ein didaktischer Anspruch in der Vermittlung der NS-Vergangenheit im Vordergrund“, im Sinne eines „Wehret den Anfängen“ gegenüber tatsächlichen oder vermeintlichen neonazistischen Tendenzen in Deutschland. Sowohl die universitäre Forschung als auch die großen außeruniversitären Institute wie das IfZ oder das Zentrum für Zeitgeschichtliche Forschung Potsdam legten demgegenüber ihren Fokus einerseits auf die traditionelle NS-Forschung, entwickelten aber auch neue Schwerpunkte in Forschungen etwa zum „Kalten Krieg“ im allgemeinen und der deutsch-deutschen Teilungs- oder aktuell eher: Verflechtungsgeschichte zwischen 1945/49 und 1989/90 im Besonderen.
Der Anspruch jedoch, in der Forschung zum Nationalsozialismus neben der Täterseite die Opferseite nicht zu vernachlässigen, bleibt unbedingt bestehen. Eine Reihe von Untersuchungen hat diesen Anspruch in den letzten Jahren bereits eingelöst oder ist dabei, ihn einzulösen: etwa die vom IfZ gemeinsam mit dem Bundesarchiv und dem Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Universität Freiburg von Ulrich Herbert verantwortete, auf 16 Bände angelegte Dokumentenedition „Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945“, das von 2005 bis 2009 am Zentrum für Antisemitismusforschung bearbeitete und von Wolfgang Benz und Barbara Distel herausgebenen neunbändige Werk „Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager“, oder Einzelbeiträge wie „Die Endlösung in Riga“ von Andrej Angrick und Peter Klein (Original 2006, englische Übersetzung 2009), die – obwohl auf die Täter konzentriert – auch die Perspektive der Opfer in eindringlicher Art und Weise wieder aufleben lassen und die auch in die angloamerikanische Forschung hineinwirken. Die Forderung nach einem „Mehr“ bedarf natürlich auch der entsprechenden Strukturen, die in Zeiten sinkender Finanzausstattungen und starker Projektbezogenheit der Forschung nicht unbedingt gegeben sind. In einem Punkt jedenfalls wurden die Forderungen zahlreicher Beiträger zwischenzeitlich erhört: Das IfZ unter seinem Direktor Wirschung gab mit Pressemitteilung vom 9. Juli 2013 die Gründung eines „Zentrums für Holocaust-Studien“ bekannt, das „die deutsche und internationale Forschung zum Holocaust institutionell […] stärken und erstmals auch in Deutschland ein Kompetenz- und Kommunikationszentrum für die empirische Erschließung des Holocaust […] schaffen [soll].“ Der Anfang für eine stärkere institutionelle Verankerung und Förderung der Holocaust-Forschung in Deutschland scheint also gemacht.
|
||