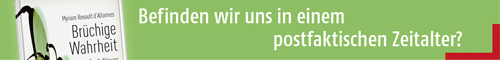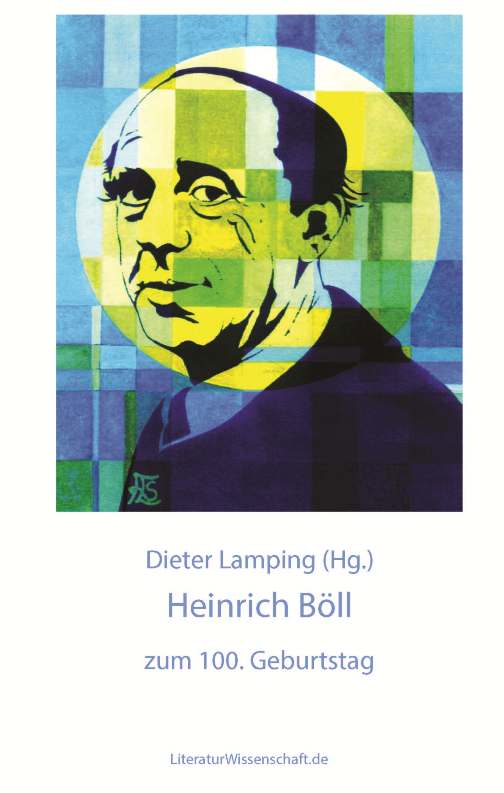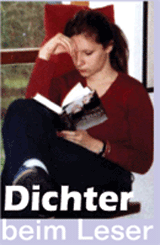Diderot: unerschöpflich aktuell
Zum 300. Geburtstag des französischen Philosophen
Von Caroline Mannweiler
Am 5. Oktober vor genau 300 Jahren wurde Denis Diderot geboren, Philosoph, Aufklärer, Schriftsteller und einer der großen Drei des französischen 18. Jahrhunderts, neben Voltaire und Rousseau. Letztere haben schon länger ihren Platz im Panthéon inne, einem republikanischen Tempel unweit der Sorbonne, in dem die „großen Franzosen“ ihre letzte Ruhe finden. Diderots Überreste (die allerdings nicht auffindbar sind) sollen dieses Jahr, dem Jubiläumsjahr, nun endlich auch ins Panthéon transferiert werden, dafür möchte der Präsident François Hollande höchst selbst sorgen.
Dass es Diderot lange Zeit schwerer hatte als seine illustren Mitstreiter, angemessen gewürdigt zu werden (wobei man die Diskreditierungskampagnen, denen etwa Voltaire von katholischer Seite ausgesetzt war, auch nicht verachten sollte), ist in der Diderot-Forschung immer wieder thematisiert worden. Einer der Gründe hierfür lag sicher in der scheinbar fehlenden Einheit und Systematik des Diderot’schen Oeuvres und, schlimmer noch, des Diderot’schen Denkens, das als „vulkanisch“ oder schlicht als „sprunghaft“ galt. Eine Eigenschaft, die man gar mit der geographischen Herkunft Diderots zu begründen suchte, wozu Diderot selbst Vorschub geleistet hatte: In einer berühmt gewordenen Briefpassage mutmaßte er, dass die raschen Wetterwechsel in seiner Heimatstadt Langres wohl die Ursache für die „inconstance de girouette“, die „Unbeständigkeit einer Wetterfahne“ seien, die die Bewohner der Stadt auszeichne. Dass Diderot sich zwar zu selbigen Bewohnern zählte, aber im gleichen Brief ebenso feststellte, dass er im Laufe seines Lebens gelernt habe, begründete und nicht-volatile Urteile zu fällen, änderte freilich nichts an dem Vorurteil von Diderot als „girouette langroise“.
Diderot gegen solche Anmaßungen und Vorwürfe zu verteidigen, sah sich schon Goethe aufgerufen, allerdings weniger indem er die Systematik des Werkes aufdeckte, sondern eher indem er die Forderung nach unmittelbar einsichtiger Systematik zurückwies: „Diderot ist Diderot, ein einzig Individuum; wer an ihm oder seinen Sachen mäckelt, ist ein Philister, und deren sind Legionen. Wissen doch die Menschen weder von Gott noch von der Natur noch von ihresgleichen dankbar zu empfangen, was unschätzbar ist.“ (Brief an Zelter vom 9. März 1831)
Eine solche Verteidigung hat Diderot schon länger nicht mehr nötig. Zwar besteht über die „Einheit“ des Werkes und die Notwendigkeit einer solchen noch immer kein Konsens in der Forschung – wenn auch die Suche nach selbiger zweifelsohne ein Motor unzähliger Publikationen war – , aber dessen ungeachtet hat sich der Status Diderots zweifelsohne verändert. Nicht selten findet man gar die Einschätzung, Diderot sei der „modernste“ Denker des 18. Jahrhunderts, der, der uns am meisten zu sagen habe.
Nun mag man diese Thesen, sofern es sich um aktuelle Äußerungen handelt, schlicht damit erklären, dass es zu den Ritualen von Jubiläumsjahren gehört, die Aktualität des Gefeierten herauszustellen, etwas, was Experten solcher gefeierter Dichter und Denker auch nicht schwer fällt, da sie ja in der Regel große Liebhaber der betreffenden Werke sind und damit zumindest subjektiv von deren Aktualität überzeugt. Die These der Aktualität Diderots ist allerdings unabhängig vom Jubiläumsjahr aufgekommen und findet sich auch bei eher „unparteiischen“ Autoren: „Heute, das ließe sich wohl vertreten, bedeutet Diderot mehr, uns Leser des zwanzigsten Jahrhunderts spricht er mit mehr Schriften unmittelbar an als Voltaire und Rousseau.“[1] Dies schreibt 1983 Jürgen von Stackelberg, der einer einseitigen Diderot-Verehrung unverdächtig ist, da er nicht minder begeistert über Voltaire geschrieben hat. (Eine gleichermaßen ausgeprägte Begeisterung für Voltaire, Diderot und Rousseau ist hingegen eher selten, Seitenhiebe gegen Rousseau aus dem Lager der Diderotisten wiederum nicht unüblich. Selbst solch integere Philosophinnen wie Elisabeth de Fontenay verraten in ihrer Wortwahl gewisse Präferenzen, wenn sie Diderot als „passionément objectif“ („leidenschaftlich objektiv“) und Rousseau als „perfidement sincère“ („perfide aufrichtig“) beschreibt.[2])
Welche Gründe mag nun diese postulierte Aktualität Diderots haben? Eine gewisse Rolle könnten zunächst ganz handfeste editorische Fakten gespielt haben, denn Diderots Werk lag nie als fertiges Oeuvre vor, so dass neue Funde die Auseinandersetzung immer wieder aufs Neue beförderten. Bekannt war Diderot zu Lebzeiten für seine bürgerlichen Dramen und die zugehörige Theorie, aber allen voran für die „Encyclopédie“, das verlegerische Mammutprojekt des 18. Jahrhunderts, das zugleich so etwas wie das Vermächtnis der „Aufklärer“ war und das Diderot zwar nicht im Alleingang, aber doch mit enormem persönlichen Einsatz zu einem erfolgreichen Ende führte. Inwiefern diese Sammlung von Wissen und – gerne in scheinbar nebensächlichen Artikeln versteckter – Herrschafts- und Gesellschaftskritik die Revolution vorbereitet hat, mag dahingestellt bleiben. (Voltaire war früh der Auffassung, dass das Werk zu teuer und zu umfangreich sei, um damit Revolutionen anzuzetteln, weshalb er sein Ergänzungsprojekt, den „Dictionnaire philosophique portatif“, das „Tragbare philosophische Wörterbuch“ verfasste.) Laut Sainte-Beuve jedenfalls hat Diderot mit der „Encyclopédie“ seinen Dienst an der Menschheit und an seiner Epoche geleistet, das eine Werk geschaffen, das Genies, nach Sainte Beuves Auffassung, ihrer Zeit schuldig sind.[3]
Wie wir wissen, hat sich Diderot aber keineswegs mit diesem Werk begnügt, wovon die Zeitgenossen allerdings wenig erfuhren, da ein Großteil des Diderot’schen Oeuvres nur in der von Friedrich Melchior Grimm herausgegebenen und handschriftlich vervielfältigten „Correspondance littéraire“ veröffentlicht wurde, einer nur von ausgewählten aristokratischen Lesern empfangenen Publikation. Es blieb also der Nachwelt vorbehalten, Diderots Werk zu würdigen bzw. es erst einmal in seiner Vielfalt zur Kenntnis zu nehmen.
Ein besonders illustrer Fall aus der Publikationsgeschichte des Diderot’schen Oeuvres macht die Schwierigkeiten, die diese Kenntnisnahme begleiteten, deutlich. Es handelt sich um die Publikation eines der bekanntesten Werke Diderots, des „Romans“ „Le Neveu de Rameau“: Verfasst ab den Jahren 1761/62, erschien es nie in der „Correspondance littéraire“, sondern erst posthum und zunächst in der deutschen Übersetzung Goethes von 1805, zu der ihm Schiller geraten hatte, der das Buch wiederum von Maximilian Klinger erhalten hatte. Diesem war es während seines Aufenthalts in St. Petersburg in der Hofbibliothek in die Hände gefallen, wo die Zarin Katharina II. die Bibliothek Diderots lagerte, die ihr der um die Mitgift seiner Tochter besorgte Philosoph schon zu Lebzeiten verkauft hatte, deren Nutzung ihm die Zarin aber bis zu seinem Tod gewährte. Von Goethes Übersetzung des „Neveu“ ausgehend, kursierten ab 1821 dann zwei Rückübersetzungen des Werks ins Französische, bis durch Zufall in den Beständen eines Bouquinisten am Seineufer 1891 ein Manuskript des „Neveu“ von der Hand Diderots gefunden wurde. Über 100 Jahre nach seiner Abfassung hatte der „Neveu“ es also vermocht, sich eine neue französische „Aktualität“ zu verschaffen, nachdem er in Deutschland auf Basis der Goetheschen Übersetzung bereits Spuren hinterlassen hatte – nicht zuletzt in Hegels „Phänomenologie des Geistes“, in der die Figur des Neffen aus dem „Neveu de Rameau“ zum kongenialen Illustrator von Hegels Thesen zum sich entfremdeten Geist avancierte.
Eine zeitlich noch sehr viel später erfolgte „Neuentdeckung“ des Diderot’schen Werkes ist dem US-Romanisten und Diderot-Experten Herbert Dieckmann zu verdanken, der 1948 auf dem Château des Ifs in der Normandie den Teil des Nachlasses Diderots entdeckte, der nach dessen Tod in den Besitz seiner Tochter Mme de Vandeul übergegangen war und den Diderot neben dem Nachlass für Katharina II. in Frankreich zurückbehalten hatte. Aus diesem „Fonds Vandeul“ war es den Nachkommen Diderots allerdings nie gelungen, eine Ausgabe zu besorgen, so dass die Ausgabe, die Diderots Vertrauter Naigeon 1798 herausgebracht hatte, lange Zeit die beste Quelle für Diderots Werk blieb. In der Werkausgabe von Assézat von 1875-77 konnten inzwischen grobe Irrtümer nachgewiesen werden, unter anderem bezüglich mehrerer Enzyklopädieartikel, die fälschlicherweise Diderot zugeordnet wurden. Der Fund Dieckmanns kommt also in mancherlei Hinsicht einer editorischen Rettung gleich, denn auf Basis des „Fonds Vandeuils“, der „Correspondance littéraire“, des Nachlasses aus St. Petersburg und aller sonstigen Funde konnte ein neuer, vielversprechenderer Versuch einer Werksausgabe gemacht werden. Das Projekt, das Dieckmann gemeinsam mit den Diderot-Forschern Jacques Proust, Jean Fabre und Jean Varloot unternahm und dessen erster Band 1975 erschien, ist bis heute nicht abgeschlossen.
Es ist also sehr wahrscheinlich, dass sich Diderots Werk weiterhin schon alleine über seine Editionsgeschichte stets neue Aufmerksamkeit verschaffen wird, wie es in bemerkenswerter Weise etwa mit den „Salons“ Diderots geschehen ist. Diese zu Lebzeiten Diderots in der „Correspondance littéraire“ veröffentlichten Kunstkritiken waren lange Zeit nur in sehr kostspieligen Ausgaben verfügbar. Erst mit leichter zugänglichen Ausgaben erhielt die Forschung zu den „Salons“ regen Auftrieb, der bis heute nicht abebbt. Zwar hatte bereits Sainte-Beuve die Bedeutung der „Salons“ für die Entwicklung der Kunstkritik hervorgehoben, ihre Bedeutung für Diderots Denken wurde aber erst allmählich aufgearbeitet.
Tiefgreifende Neuerungen insbesondere in der Einschätzung von Diderots politischen Ideen brachte im 19. Jahrhundert die Entdeckung von Diderots Mitautorschaft an der „Histoire des deux Indes“ des Abbé Raynal, in der Diderot in aller Schärfe Kolonialismus und Sklavenhandel kritisiert – und zwar nicht nur die unmittelbare Ausbeutung durch die Kolonialisten, sondern auch die mittelbare ökonomische Ausbeutung der Sklaven durch die Reeder, die genau kalkulieren, wie sehr sie einen Sklaven schinden können, um möglichst viel Profit aus ihm zu ziehen[4] – Zeilen, die der Diderot-Forscher Gerhardt Stenger mit der „Banalität des Bösen“ bei Hannah Arendt vergleicht[5] – Zeilen, die aber durchaus an Marx‘ Analyse des Kapitalismus denken lassen, in der der Arbeiter und die Ausgaben, die zu seiner Subsistenz vonnöten sind, einen Kostenfaktor neben anderen darstellen, ein Faktum, das die Ausbeutung des Arbeiters kausal mit einer Erhöhung der Produktivität verbindet. Doch Stenger ist sicher Recht zu geben, wenn er die Assoziation zu Hannah Arendt und der „Banalität des Bösen“ vorzieht. Denn Diderots antikoloniale Emphase in der „Histoire des deux Indes“ ist in erster Linie mit einer moralischen Empörung verbunden, was Stenger in dem rührenden Zitat Diderots nachzeichnet, der Helvétius Satz aus „De l’esprit“ „Il n’arrive point de barrique de sucre en Europe qui ne soit teinte de sang humain.“ („Kein Fass Zucker, das nach Europa gelangt, an dem nicht Blut klebt.“) folgendermaßen kommentiert hat: „Ces deux lignes ont empoisonné tout le sucre que je mangerai de ma vie et je l’aime beaucoup“.[6] („Diese zwei Zeilen haben allen Zucker, den ich in meinem Leben essen werde, vergiftet, und ich mag Zucker sehr.“) Diderots Aufruf zum Aufstand der Sklaven oder besser die Vorablegitimierung eines solchen Aufstandes in der „Histoire des deux Indes“ steht insofern weniger im Zeichen einer Umwälzung des kapitalistischen Systems denn im Zeichen der Ablehnung des moralisch Intolerablen. Gleichwohl stellt dieser Aufruf eine Radikalisierung gegenüber früheren Ausführungen Diderots zum Thema dar: Im „Supplément au Voyage de Bougainville“ findet sich zwar Kolonialismuskritik, aber auch der vielzitierte Satz: „Nous parlerons contre les lois insensées jusqu’à ce qu’on les réforme et en attendant nous nous y soumettrons […].“[7] („Gegen unvernünftige Gesetze werden wir Reden halten, bis man sie bessert, und unterdessen werden wir uns ihnen unterwerfen.“)
Am Beispiel des politischen Diderot lässt sich somit eindrucksvoll belegen, wie sehr die editorische Arbeit, das Auffinden neuer Texte (im 20. Jahrhundert wären hier noch Diderots Kommentar zu Hemsterhuis „Lettre sur l’homme et ses rapports“ zu nennen, seine „Apologie des abbé Galiani“, die „Pages contre un tyran“, einer Streitschrift gegen Friedrich II., und die „Observations sur le Nakaz“, Folge seiner Erfahrungen am Hof Katharinas II.) die Sichtweise auf Diderots Werk zu verändern und dessen Aktualität zu unterstützen vermag.
Und doch ließe sich wohl ebenso gut sagen, dass die Editionsgeschichte des Werkes nur am Rande mit dem Bedürfnis von Diderot-Liebhabern zu tun hat, diesen als „aktuellen“ Denker zu präsentieren. Es scheint vielmehr, als liege diesem Bedürfnis die sehr subjektive, von Werkinhalten und deren (Neu)interpretation weitgehend unabhängige Empfindung zugrunde, dass Diderot den Leser seiner Texte, und insbesondere den „forschenden“ Leser, unmittelbar anspricht. Wie gelingt ihm das?
Zum einen wohl durch eine besondere Art von Aufrichtigkeit, die Widersprüche nicht verschweigt, sondern eher sucht, was Diderot in dem ebenfalls vielzitierten Satz aus seinem ersten eigenständigen philosophischen Werk, den „Pensées philosophiques“, so ausgedrückt hat: „On doit exiger de moi que je cherche la vérité, mais non que je la trouve.“[8] („Man soll von mir verlangen, dass ich die Wahrheit suche, aber nicht, dass ich sie finde.“)
Zum anderen durch die Betonung dessen, was Dieckmann in einer Studie zu Diderot die „Erkenntnisfunktion des Gefühls“[9] genannt hat, die sich bei Diderot in einem Gestus äußert, der in allem zunächst einmal das sucht, was ihn – und damit vielleicht auch den Leser – ansprechen, berühren könnte. Ein Gestus, der in seinen Überlegungen zur Malerei besonders deutlich zum Ausdruck kommt: „Apage, Sophista! Tu ne persuaderas jamais à mon coeur qu’il a tort de frémir, à mes entrailles qu’elles ont tort de s’émouvoir.“[10] („Apage, Sophista ! Nie wirst Du mein Herz davon überzeugen, dass es irrt, wenn es erbebt, nie wirst Du mein Innerstes davon überzeugen, dass es irrt, wenn es sich erregt.“)
Dass diese Mischung gerade für forschende Menschen besonders attraktiv ist, ist leicht zu erklären: Während erstere Tendenz, das Suchen, ohne zu finden, desillusionierend oder zumindest kräftezehrend sein kann, gibt letztere Tendenz, die Bereitschaft, sich begeistern zu lassen, stets neue Energie. Neue Energie, die dabei eben weniger der Erreichung eines Zieles dient, denn dem Festhalten an einer unter Umständen nicht lösbaren Lebensaufgabe.
In Diderots Fall liegt diese „Lebensaufgabe“ wohl in erster Linie in der Frage nach einer nicht religiös fundierten Moral, die ihn umtrieb und umtreiben musste, da sein Atheismus und seine philosophischen Überzeugungen, die man dem Materialismus zuordnet, mit seinem emotionalen Bedürfnis nach Freiheit oder vielmehr nach „Besserungsmöglichkeiten“ mitunter unvereinbar schienen. „J‘enrage d‘être empêtré d‘une diable de philosophie que mon esprit ne peut s‘empêcher d‘approuver, et mon coeur de démentir.“[11] („Es ist mir unerträglich, in solch eine Philosophie verwickelt zu sein, die mein Verstand nicht umhin kann, zu befürworten, und mein Herz zu widerlegen.“)
Dieser vielzitierte Satz wurde häufig zum Ausgangspunkt genommen für eine These, die Diderot eine zunehmende Frustration mit seinen philosophischen Positionen und deren Konsequenzen unterstellte, eine Frustration, die in seinem späten Werk „Le Neveu de Rameau“ besonders greifbar sei. Gewiss, die „Zuversicht“, die Diderot unter anderem noch in der „Lettre à Landois“ ausstrahlt, in der er das Streben nach Tugend zwar als nichts als einen glücklichen Zufall bezeichnet, aber an den Vorteilen von Philanthropie und moralisch gutem Handeln festhält, ist im „Neveu“ verflogen. Tugend, das macht der „Neveu“, der Neffe des berühmten französischen Komponisten Rameau und eine der zwei Hauptfiguren, klar, ist in der Gesellschaft, in der er lebt, keine sehr erfolgreiche Eigenschaft. Weder hilft sie bei der Sicherung des Lebensunterhalts, noch garantiert sie dem Tugendhaften das Ansehen der Mitmenschen, wovon Diderot in der „Lettre à Landois“ noch selbstverständlich ausgegangen war: „La vertu se fait respecter; et le respect est incommode. La vertu se fait admirer, et l’admiration n’est pas amusante.“[12] („Die Tugend erfordert Ehrfurcht, und Ehrfurcht ist unbequem; die Tugend fordert Bewunderung, und Bewunderung ist nicht unterhaltend.“) So der Neffe.
Starker Tobak für den Philosophen, der als Dialogpartner des Neffen auftritt, und wacker Tugend und Autonomie verteidigt, wiewohl ihm die Argumente des Neffen doch sehr zu denken geben. Nun ist es kaum möglich, die historischen Hintergründe und vielen Bedeutungsschichten des Romans auf knappem Raum zu erläutern, geschweige denn die zahlreichen schlüssigen Interpretationen des Werks zusammenzufassen. Was sich aber wohl behaupten lässt, ist dass „Le Neveu de Rameau“ nur schwer als Werk eines frustrierten Philosophen empfunden werden kann. Dazu ist es zu dynamisch, mit zu viel Sympathie für seine Figuren, zu viel Verve und zugleich zu viel Leichtigkeit geschrieben. Eine Leichtigkeit, die umso erstaunlicher ist, als die Inhalte des Romans in der Tat Grund zu Desillusion und Resignation böten. Aber Resignation, Verzweifeln an der Welt und an den Menschen, kam für Diderot nicht in Frage, schon aus prinzipiellen Gründen: „Ne rien reprocher aux autres, ne se repentir de rien : voilà les premiers pas vers la sagesse.“[13] („Den anderen nichts vorwerfen, selbst nichts bereuen: das sind die ersten Schritte zur Weisheit.“)
Diese Haltung scheint Diderot die Kraft gegeben zu haben, auch solche Entwicklungen und Verhaltensweisen nicht auszublenden, die jedes aufklärerische Projekt in Frage zu stellen scheinen. Und so ist es nicht Resignation, sondern Zeichen von Energie und Klarsichtigkeit, wenn Diderot gegen Ende seines Lebens, als er Verfechter von Revolution und Widerstand gegen Tyrannei zu werden beginnt, zugleich feststellt, dass die Menschen in gewissem Sinne zu „egoistisch“ für Revolutionen seien: Anstatt das zu verteidigen, was ihnen zusteht, begnügen sie sich mit dem, was man ihnen überlässt, und anstatt eine Änderung der Verhältnisse herbeizuführen, von denen vielleicht erst kommende Generationen profitieren werden, verharren sie im Status quo, in dem jeder seine Interessen verfolgt und nie ein gemeinsamer Wille entsteht.[14]
Doch Diderot wäre nicht Diderot, wenn er daraus einen Vorwurf an die unterdrückten Menschen konstruieren würde. Mit großer Konsequenz lehnte Diderot jede Haltung ab, die mit Beschuldigungen operiert, ohne die Umstände von „Fehlverhalten“ zu berücksichtigen. So mag der Aufstand eines Sklaven ein Fehlverhalten sein (zumindest in Diderots zeitlichem Kontext), aber kann man von den Umständen seines Handelns absehen? So mag das opportunistische Verhalten des verarmten Neffen in „Le Neveu de Rameau“ unwürdig sein, aber wird man es ihm angesichts der Pariser Gesellschaft, die ihn umgibt und sein Verhalten „belohnt“, als rein persönliches Verschulden anlasten können?
Besondere, auch persönliche Relevanz erlang diese kritische Haltung Diderots in seinem Verhältnis zur Religion und zur Institution Kirche. Auch hier machte ihm zu schaffen, dass die Kirche Regeln aufstellt, die völlig von den „Umständen“ des Menschen, d.h. von seiner physischen Konstitution absehen. Nicht zuletzt in Auseinandersetzung mit seinem streng religiösen Bruder, der eine Laufbahn in der Kirche, die Diderots Vater auch für Denis vorgesehen hatte, verfolgte, und in Anbetracht der Leiden seiner Schwester, die an dem Ordensleben, das man ihr zugedacht hatte, psychisch zerbrach, sind folgende Sätze aus den „Pensées Philosophiques“ zu lesen: „C’est le comble de la folie, que de se proposer la ruine des passions. Le beau projet que celui d’un dévot qui se tourmente comme un forcené, pour ne rien désirer, ne rien aimer, ne rien sentir, et qui finirait par devenir un vrai monstre s’il réussissait!“[15] („Es ist der Gipfel der Verrücktheit, sich den Ruin der Leidenschaften vorzunehmen. Welch schönes Projekt: ein Frommer, der sich wie ein Wahnsinniger quält, um nichts zu begehren, nichts zu lieben, nichts zu fühlen, und der am Ende ein Monster würde, wenn es ihm gelänge!“)
Dass die „Pensées philosophiques“ sogleich nach Erscheinen verboten wurden, kann nicht überraschen. Doch Diderot behielt seine Kritik, wenn auch versteckt, durchaus bei. Denn an seiner Auffassung, dass der Mensch als sinnliches Wesen an der geltenden Moral eigentlich nur scheitern könne, hatte sich nichts geändert. So hielt er etwa das Ehegelübde für schwer umsetzbar und damit „unvernünftig“. „L‘homme sage frémit à l‘idée seule d‘un engagement indissoluble. Les législateurs qui ont préparé aux hommes des liens indissolubles n‘ont guère connu son inconstance naturelle. Combien ils ont fait de criminels et de malheureux?“[16] („Der weise Mensch erzittert bei der bloßen Vorstellung einer unauflösbaren Verpflichtung. Die Gesetzgeber, die den Menschen unauflösbare Verbindungen zugedacht haben, wussten nichts von seiner natürlichen Unbeständigkeit. Wie viele Kriminelle und Unglückliche haben sie damit erzeugt?“) Diesen Passus versteckte Diderot in einem „Encyclopédie“-Artikel zum Stichwort „indissoluble“ (unauflöslich) – hatte er doch nach einer mehrmonatigen Haft in der Bastille versichern müssen, nie wieder etwas gegen die Kirche zu schreiben. Er hat sich tatsächlich weitgehend daran gehalten. Und auch das Gesetz der Ehe hat er nie wirklich in Frage gestellt. Wenn Gesetze nichts mehr gelten, herrscht Anarchie. Dieses Ziel verfolgte Diderot keineswegs. Es hätte ihn wohl schon gefreut, wenn das rigorose moralische Urteil sich etwas mehr an den gegebenen Voraussetzungen des Menschen orientiert hätte. Voltaire, ein anderer Zeitgenosse, der mit der Kirche so seine Schwierigkeiten hatte, prägte im Zuge seiner Auseinandersetzungen nicht nur mit der Kirche den „Kampfbegriff“ der Toleranz. Aber Diderot ist nicht Voltaire. Und doch ist nicht einzusehen, warum der eine im Panthéon liegt und der andere nicht, wiewohl beide zu diesem Thema sicher gesagt hätten, dass es wichtigere Probleme gibt…
[1] Jürgen von Stackelberg: Diderot. Eine Einführung. München, Zürich 1983, S. 10.
[2] cf. Elisabeth de Fontenay: Diderot ou le matérialisme enchanté. Paris 2001, S. 33.
[3] cf. Sainte Beuve: Portraits Littéraires. Bd. 1. Paris 1864, S. 239 – 264.
[4] cf. Diderot in Raynal, G. T.: Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes. Bd. 11, Kap. 24. Genf 1780.
[5] cf. Gerhardt Stenger: Diderot. Le combattant de la liberté. Paris 2013, S. 660-661.
[6] Denis Diderot: Réflexions sur le livre ‘De l’esprit’ d’Helvétius. In: Ders.: Oeuvres complètes. Hg. v. Herbert Dieckmann u.a. Bd. 9. Paris 1981, S. 278.
[7] Denis Diderot: Supplément au voyage de Bougainville. In: Ders.: Oeuvres complètes. Hg. v. Herbert Dieckmann u.a. Bd. 12. Paris 1989, S. 643.
[8] Denis Diderot: Pensées philosophiques. In: Ders.: Oeuvres complètes. Hg. v. Herbert Dieckmann u.a.. Bd. 2. Paris 1975, S. 34.
[9] Herbert Dieckmann: Zur Interpretation Diderots. In: Romanische Forschungen 53 (1939), S. 47—82, S. 79.
[10] Denis Diderot : Essais sur la peinture. Salons de 1759, 1761, 1763. Hg. v. Jacques Chouillet und Gita May. Paris 1984, S. 76.
[11] Denis Diderot: Lettre à Mme de Maux, septembre 1769 (?). In : Ders. : Correspondance. Hg. v. Georges Roth und Jean Varloot. Paris 1955-70. Bd. 9, S. 154.
[12] Denis Diderot: Le Neveu de Rameau. Genf 1977, S. 44-45.
[13] Denis Diderot: Lettre à Landois. In: Ders.: Oeuvres complètes. Hg. v. Herbert Dieckmann u.a. Bd. 9. Paris 1981, S. 258.
[14] cf. Denis Diderot : Pensées détachées. Contributions à l’Histoire des deux Indes. Hg. v. Gianluigi Goggi. Bd. 1. Siena 1976, S. 210 – 211.
[15] Denis Diderot: Pensées Philosophiques. In: Ders. : Œuvres complètes. Hg. v. Herbert Dieckmann u.a. Bd. 2. Paris 1975. S. 19.
[16] Denis Diderot: Oeuvres complètes. Hg. v. Herbert Dieckmann u.a. Bd.7. Paris 1976. S. 526.
Ein Beitrag aus der Komparatistik-Redaktion der Universität Mainz