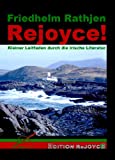Friedhelm Rathjens „Rejoyce!“ bietet einen kleinen Leitfaden durch die irische Literatur
Besprochene Bücher / LiteraturhinweiseDieser Band, eine stark erweiterte Neufassung des 2004 unter dem Titel „Die grüne Tinte“ erschienenen Vorläufers, präsentiert in kritischen Einzeldarstellungen 108 irische Bücher folgender 45 Autorinnen und Autoren:
John Banville, Sebastian Barry, Samuel Beckett, Dermot Bolger, John Boyne, Mary Breasted, Seamus Deane, Roddy Doyle, Dermot Healy, Seamus Heaney, Hugo Hamilton, Desmond Hogan, James Joyce, Richard Kearney, Claire Keegan, Walter Macken, Eugene McCabe, Patrick McCabe, Colum McCann, Frank McCourt, Malachy McCourt, John McGahern, Sean McGuffin, Bernard Mac Laverty, Eoin McNamee, Deirdre Madden, Paul Murray, Flann O’Brien, Bridget O’Connor, Joseph O’Connor, Tomás O’Crohan, Timothy O’Grady, Marian O’Neill, Kate O’Riordan, Maurice O’Sullivan, Patrick Quigley, Keith Ridgway, Frank Ronan, Peig Sayers, John Millington Synge, Alice Taylor, Colm Tóibín, William Trevor, Robert McLiam Wilson, William Butler Yeats.
Das Spektrum der hier behandelten Literatur reicht zeitlich vom endenden 19. bis ins beginnende 21. Jahrhundert, in gewissem Maße also von PreJoyce zu ReJoyce. Über die Klassiker Joyce, O’Brien und Beckett geht es zum metropolen Boom der 1990er-Jahre, auf denen ein besonderer Schwerpunkt liegt – ist dieser Schwerpunkt kein Endpunkt, auch im neuen Jahrtausend hat sich die Literatur Irlands weiter- oder vielleicht auch wieder ein wenig zurückentwickelt, eine Entwicklung, die sich in diesem Buch ebenfalls an markanten Beispielen festgehalten findet.
Die jungen rabiaten Autoren wie Roddy Doyle und Patrick McCabe, die zu Beginn der 1990er-Jahre auf sich aufmerksam machten, hatten es einfach, sich von überholten Irland-Klischees abzusetzen: während die Altvorderen ihre Bücher in ländlichen Gefilden ansiedelten, in denen Fischer, Moorbauern und Musiker ein hartes, aber unentfremdetes Leben zwischen Suff und zeitloser Romantik führten, mussten nun nur als Schauplatz die Großstadt (unter Bevorzugung slumähnlicher Wohngebiete), als Figuren entsprechend kaputte Kriminelle, als Verlockungen harte Drogen, Sex und Geld her, und schon war das neue Irland in aller Schärfe getroffen. Dieses neue Irland war damals ein Land im Übergang, in dem die alten Strukturen (etwa die Macht der Kirche und reaktionäre Moralgesetze) zu zerbröckeln begannen und damit bestens kritisierbar waren. Der gesellschaftliche Wandel erreichte dann aber unverhofft ein Tempo, mit dem die Literatur kaum mithalten konnte; heute ist all das, was damals als antiquiert anzugreifen war, so komplett verschwunden, dass mancher ehemalige Rebell den alten Zeiten schon wieder dicke Tränen nachweint.
Für irische Kontinuität insbesondere in deutschen Buchverlagen sorgen heute vor allem Altmeister William Trevor, der allzu souverän die traditionelle Erzählweise pflegt, John Banville, der der Generation vor Roddy Doyle angehört, und Colm Tóibín, der konventionellste Stilist der Doyle-Generation. Vielleicht könnte die Besinnung auf die Spitzen der Tradition in der Tat für neue Qualität sorgen, gerade auch in formaler Hinsicht. Nachdem es in den Boom-Jahren Mode war, auf Übervater Joyce zu schimpfen, bekennen sich heute viele jüngere Autoren wieder ausdrücklich zu ihm, und auch die jüngste Hinwendung etlicher – auch namhafter – Autoren zur lange überholt geltenden Short Story deutet vielleicht auf eine Rückbesinnung auf tiefere Qualität hin.
Lust aufs Lesen all dieser sehr unterschiedlichen Bücher will der Autor von „Rejoyce!“ machen, und damit im Zweifelsfall die Leselust nicht in Frust umschlägt, spricht er in einigen Fällen auch ausdrückliche Warnungen aus. Das Kompendium richtet sich an eine Leserschaft, die aus Normalsterblichen besteht, und nicht an Expertenklüngel. Deshalb wird auf Wissenschaftsjargon ebenso verzichtet wie auf Insideranspielungen. Über lesbare Bücher lesbar schreiben – das ist es, worum es dem Autor geht.
Anmerkung der Redaktion: literaturkritik.de rezensiert grundsätzlich nicht die Bücher von regelmäßigen Mitarbeiter / innen der Zeitschrift sowie Angehörigen der Universität Marburg. Deren Publikationen können hier jedoch gesondert vorgestellt werden.
|
||