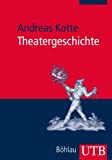Theatralität, Theaterkunst und Anti-Theater
Andreas Kotte führt problemorientiert durch die Schauspielgeschichte
Von Bernd Blaschke
Theatergeschichte ist mehr und kategorial anderes als die Geschichte des Dramas als Teil einer allgemeinen Literaturgeschichte. Die Texte der Tragödien, Komödien, Dramen oder der postdramatischen Theateressays sind nur ein Baustein unter vielen, die zum Gemeinschaftswerk jeder Theateraufführung hinzugefügt werden. Dieses Grundbekenntnis ist die Unabhängigkeitserklärung der Theaterwissenschaften. Jede theatergeschichtliche Überblicksschrift muss es beherzigen – und erst recht eine Einführung in die komplexe Materie. Andreas Kotte bewältigt die gründliche Reflexion auf seinen komplexen und heiklen – weil in seinen zentralen Aufführungsereignissen flüchtigen – Gegenstand mit Bravour.
Durch konsequentes Fragen nach dem Zusammenhang von Lebenswelten, Institutionen und Theaterformen gerät Kottes „Einführung in die Theatergeschichte“ zu einem Werk, das zum Mitdenken und Nachforschen anregt. Umsichtig richtet er seine gut 400 großen, mit Bildern und Tabellen angereicherten Seiten nicht positivistisch am Übermaß der Daten europäischer Theatergeschichte seit der Antike aus. Hier wird kein schnell langweilig werdendes Personen- und Ereignisgestöber ausgebreitet. Verhandelt wird vielmehr die spannende Frage, seit wann, warum, mit welchen (wechselnden) Formen, Bauten und sozialen Organisationsformen Menschen Theater spielten und zudem ihren Alltag und ihre Feste mehr oder weniger inszenierten und bestimmte Rollen – oder sich selbst – spielten. Als aufschlussreiche Ergänzung wird in jedem der sieben Epochenkapitel den jeweiligen Ausprägungen und Argumenten jener Theaterfeindschaft nachgegangen, die das Schauspiel seit Platon und dem Christentum fundamental kritisierte und ablehnte.
Andreas Kotte, der das Institut für Theaterwissenschaft der Universität Bern leitet, orientiert sich in seiner theoretischen Grundlegung wie in einigen seiner materialen Schwer- und Vertiefungspunkte (etwa der Geschichte der Narrenfiguren, der Commedia dell’arte-Tradition, dem österreichischen Volkstheater) an den Schriften Rudolf Münz’ – zu erinnern ist hier vor allem Münz’ Buch über ‘Theatralität und Theater’. Rudolf Münz ist das Buch, dessen Entwurf Kotte noch mit seinem Lehrer diskutieren konnte, auch gewidmet. Die je spezifische ‘Theatralität’ einer Epoche soll ermittelt werden als das Verhältnis der lebensweltlichen Schau- und Ostentations-Aspekte einer Gesellschaft (etwa von Fürstenumzügen, Festen oder öffentlichen Hinrichtungen), dem Kunst-Bühnentheater, den subkulturellen Neben- oder Gegenströmungen dazu in Formen des Volkstheaters oder der Spielleute und schließlich den jeweiligen Diskursen der Theaterablehnung.
Kotte widmet in Anlehnung an Münz (und seiner Fortschreibung durch Stefan Hulfeld) jeweils den ersten Abschnitt eines jeden Epochenkapitels den lebensweltlichen Inszenierungs- und Schau-Paradigmen einer Zeit. Der vorletzte Kapitelabschnitt gilt stets den Argumenten und Protagonisten der Theaterablehnung, der letzte den Entwicklungen der Theaterbauten, der Bühnen-, Kulissen- und Zuschauerraumgestaltung. Die Beschreibung der im engeren Sinne theatralischen Aufführungen werden – derart eingebettet in Ideen-, Bau- und Alltagsgeschichte – nochmals untergliedert in die bedeutenden Evolutionen des Theater der Hochkultur (Tragödie, Humanistentheater, Hoftheater, Reformkonzepte der Aufklärung) und in die parallel und komplementär tradierten Theaterformen der Spielleute und Commedia-Künstler. Deren Funktionsstelle wurde – gemäß Kottes Gliederungs-Heuristik – im 19. Jahrhundert von Nestroy und Consorten übernommen, im 20. Jahrhundert vom politischen Theater und jüngst vom postdramatischen Theater.
Die Gegenströmung gegen das offizielle Kunsttheater betone gegen dessen Natürlichkeits- und Mimesis-Imperative gerade die Künstlichkeit der Mittel (etwa durch Masken) und stelle das Spiel als Spiel mittels Übertreibungen aus. Auf der anderen Seite gilt es, den Berührungs- und Abgrenzungspunkt des inszenierten Theaters von den Darstellungs- und Schau-Aspekten alltäglicher Handlungen zu beschreiben. Als Abgrenzungskriterium verweist Kotte auf die ‚Konsequenzverminderung‘ theatralischer Handlungen, die etwa einen gespielten Bühnentod von dem einer (ebenfalls inszenierten) realen Hinrichtung unterscheidet. Die ästhetische Hervorhebung der Handlung unterscheidet das Theater wiederum von anderen Spielen (etwa dem Kartenspiel).
Da szenische Abläufe vermutlich schon vor 400.000 Jahren als Lernhilfen (und Lustspender) für menschliche Kooperations-Handlungen, etwa bei der Jagd, eingesetzt wurden, hält Kotte die verbreiteten Theorien des Theaterursprungs im antiken Griechenland für zu kurz gedacht. Viele synchrone Theaterformen lassen einen viel früheren, aus Rhapsodenauftritten, aus Erzählung, Musik und Tanz als elementaren Kulturtechniken abgeleiteten Theaterursprung wahrscheinlich erscheinen. Griechenland sei stark überrepräsentiert in der Theaterhistoriografie schlicht wegen seiner großen und vielfach erhaltenen Theaterbauten und seiner überlieferten Stücktexte. Allerdings hebt auch die folgenreiche, philosophisch argumentierende Theaterablehnung in der griechischem Antike an und wird dann von Tertullian mit ähnlichen Argumenten im Namen des Christentums fortgeführt. War es bei Platon die alltägliche Nachahmung des besten Lebens, die im angestrebten idealen Staatswesen eine nachahmende Schauspielerei hinfällig und schädlich mache, so erklärte Tertullian das Jüngste Gericht zum größtmöglichen Schauspiel, das alle weiteren Schauspiele überflüssig mache. Als Hilfskunst und Übungsfeld für politische Rhetoren erlangt die Schauspielerei jedoch in Aristoteles‘ ‚Politik‘ und vor allem in seiner ‚Rhetorik‘ eine Würde, die ihr in der ‚Poetik‘ des wirkmächtigen Philosophen (die auf Tragödientexte abhebt) noch nicht zukam.
Der als Spezialist für Theaterformen des Mittelalters ausgewiesene Autor legt einen sehr informativen Schwerpunkt auf die sonst meist sehr knapp als ‚Lücke‘ oder ‚Vakuum‘ der Theatergeschichte ausgeblendeten Entwicklungen im langen Mittelalter. Hier verweist er auf belegte oder indirekt erschließbare, vielfältige Spielformen neben den bekannten, nur vermeintlich direkt aus der Gottesdienst-Liturgie sich entwickelnden Osterspielen. Die Annahme eines Theatervakuums von der Spätantike bis zum Hochmittelalter marginalisiere die auch damals auftretenden Spielleute und Mimen und sei zu eng am christlichen Texttheater orientiert. Da es nach dem Zusammenbruch des römischen Reiches im späten fünften Jahrhundert keine zusammenhängende Überlieferungstradition von der römischen oder gar griechischen Antike über das Mittelalter in die Neuzeit gab, müsse man stärker als bisher die lokalen Kulturen und auch die Theaterspielpraktiken der europäischen Völker und Regionen erforschen. Zehn Seiten widmet Kotte der Genealogie der für das Lachtheater so wichtigen Figur des Narren, indem er seinen nicht-christlichen wie christlichen Vorläufer-Figuren und ihren genealogischen Wandlungen nachspürt. Das vermeintliche frühmittelalterliche Theatervakuum füllt Kotte mit Auferstehungsfeiern, Herodesspielen und durch Hinweise auf Verbote der Giulleria-Spielmannstradition. Verbote und Regulierungen seien Indizien, aus denen man auf deren permanente Existenz schließen kann.
Kottes Epochenkapitel beginnen stets mit grundlegenden Problemstellungen und offenen Fragen an die Theatergeschichte. Für die Zusammenhänge von Humanismus und Commedia im 15. und 16. Jahrhundert sei fraglich, warum höfisches Lebenstheater (kodifiziert in Castigliones Buch ‚Vom Hofmann‘) zum Vorbild bürgerlicher Schauspielkunst wurde und wie und warum die Commedia dell’ Arte das Modell der Repräsentationskunst konterkarierte. Gründlich und kenntnisreich sind Referat und Diskussion von vier Theorien zum Ursprung der Commedia dell’arte. Auch hier problematisiert Kotte monokausale Ursprungstheorien. Präzise geraten auch die Darlegungen zur Übernahme von Commedia-Elementen durch Molière. Für das 19. Jahrhundert und für die deutsche Theaterentwicklung höchst bedeutsam war die Idee (und ihre Umsetzungsversuche) eines Nationaltheaters. Hierzu werden nicht nur eingehend die Konzepte des Nationaltheaters und ihre Hamburger Umsetzung referiert; in vorbildlicher Klarheit wird in einer Tabelle auch Bilanz gezogen, in der das in Hamburg Angestrebte dem (weit bescheideneren) Erreichten gegenüber gestellt wird.
Die für jegliche Theatergeschichtsschreibung zentrale Problematik der Rekonstruierbarkeit von Aufführungsereignissen wird exemplarisch an der Aufführungsgeschichte von Heinrich von Kleists ‚Käthchen von Heilbronn‘ vorgeführt. Gefragt wird nach den überlieferten Materialien auf der Objektebene und nach den jeweils verfügbaren Quellen auf der metasprachlichen Ebene. Die Institutionen, Räume, Spielweisen der Akteure werden soweit wie (nach Datenlage) möglich rekonstruiert; ebenso Textfassungen samt Zensureingriffen und Publikumsreaktionen.
Besonders wichtigen Theatermachern, die exemplarisch interessant sind, weil sie Spannungen oder Entwicklungen ihrer Zeit verkörpern, werden längere pointierte Portraits gewidmet. Zu diesen Schlüsselfiguren zählen bei Kotte der Schauspieler und Theaterreformer Riccoboni, der das Theater zunehmend aus religiösen Gründen ablehnte, ferner Molière, Johann Nestroy und Johann Wolfgang von Goethe, der hier als Theaterorganisator und weniger als Dramenautor bedeutsam wird.
Im Hinblick auf die theatergeschichtliche Entwicklung im 20. Jahrhundert und ihre in allen vorliegenden Theatergeschichten übermäßig breite Darstellung moniert Kotte, dass die Vorstellung einer Ausdifferenzierung von Theaterformen speziell im 20. Jahrhundert ebenso ein unhaltbarer Mythos sei, wie die Behauptung, in diesem rezenten Jahrhundert habe eine verstärkte Theatralisierung des Lebens stattgefunden. Für das letzte Jahrhundert betont Kotte eher die Fortschreibung des Kontinuums vielfältiger nebeneinander bestehender, überlieferter Theaterformen (zwischen Laientheater, Schultheater, Privat- und Staatstheater) als die harten Brüche oder gänzlichen Neuerfindungen, die von vielen Avantgarden und Regietheater-Experimenten angestrebt und behauptet wurden. Während die meisten theatralischen Formen des 20. Jahrhunderts auf Vorgänger und schon vorhandene Funktionsstellen im Theatergefüge zurückführbar seien, sieht Kotte nur im immer weiter verbreiteten Spielen vor der Kamera eine wirklich neue Entwicklung. Der Bezug zwischen Agierenden, Aufnahme-Objektiv und Aufnahmeteam schaffe neue Formen der Theatralität. ,Medientheater‘ nennt der Theaterhistoriograf diese Spielart des Schauspielens, die dem, was dann als Film, Fernsehen, Videokunst oder als Alltagsvideo auf YouTube medial versendet wird, elementar vorausliege.
In seinem Epilog fasst der in der DDR ausgebildete Berner Forscher sein Credo, das gegen den Mainstream theatergeschichtlicher Ursprungs- und Evolutionsnarrative gerichtet ist, zusammen: „Theater entwickelt sich nicht, es wandelt sich nur. Es stellt sich auf veränderte soziale Verhältnisse ein. Es kennt weder bruchlose Kontinuitäten noch berührungslose Diskontinuitäten. Die angedeuteten Theatralitätsgefüge betonen die Diskontinuität einzelner Theaterformen genauso wie die Kontinuität von Theater.“ Sehr hilfreich sind die zahlreichen Skizzen, Tabellen und Bilder, die besonders die Entwicklungen des Theater- und Kulissenbaus anschaulich werden lassen.
An Kritik- oder Ergänzungspunkten für diese insgesamt gelungene, informative und didaktisch überzeugend gestaltete Einführung seien hier nur zwei Aspekte erwähnt: Trotz des systematischen Schwerpunkts auf die Ausprägungen der Theaterfeindschaft durch die Jahrtausende fehlt in dieser Einführung und ihrer Bibliografie der Hinweis auf Martin Puchners wichtige Monographie und seine Aufsätze zur Theatralitätskritik in modernen (Lese-)Dramen. Schwerer wiegt, dass diese Einführung gerade im Hinblick auf das 20. Jahrhundert einen recht engen Fokus auf Europa, näherhin auf die Schweiz und Deutschland wählt. Dabei sind gerade in den letzten 40 Jahren zunehmend interkulturelle Theaterformen interessant und wichtig geworden. Institutionell ermöglicht und provoziert etwa durch zahlreiche Festival-Koproduktionen. Diese Beziehungen zwischen europäischem, amerikanischem und östlichem Theater, sowie zwischen Metropolen und (Ex-)Kolonien haben eine Vorgeschichte spätestens seit dem 19. Jahrhundert. Diese rückt in jüngster Zeit zunehmend in den Vordergrund akademischer Forschungen. (Post-)Migrantisches Stadttheater ist ein hot spot der aktuellen Diskussionen um die Zukunft des Theaters im nachbürgerlichen Medienzeitalter. Postkoloniale und transkulturelle Fragestellungen einer globalisierten Weltgesellschaft sind Kottes Sache nicht – auch wenn das christliche Theater wie sein Gegenpol der italienischen Commedia schon seit dem Mittelalter eine weitgehend gesamteuropäische Angelegenheit waren.
Theaterbegeisterung als Leidenschaft und Theaterwissenschaft als akademische Reflexionsinstanz stehen stark im Zeichen des Gegenwärtigen. Dies hat seine Gründe zu guten Teilen wohl im genuin präsentisch-gegenwärtigen Charakter der je einmaligen Theatersituation zwischen Spielern und Publikum. Die vorliegende, problem- und forschungsorientierte Einführung in die Theatergeschichte, die in bezahlbarer Ausführung bei UTB vorgelegt wurde, bietet einen klugen und spannenden Gegenpol zur Präsenz- und Aktualitätsfixierung vieler Theaterfreunde. Im Gegensatz zu vielen älteren Theatergeschichten gilt ihr Hauptaugenmerk nicht der gut dokumentierten jüngeren Vergangenheit des 20. Jahrhunderts. Kotte behandelt diese sogar nur knapper als das 17., 18. und 19. Jahrhundert oder als das Mittealter und die frühe Neuzeit, denen er je circa 60 Seiten widmet. Dass man trotz dieser Schwerpunktverschiebung in frühere Zeiten – die bis zu Kottes begründeten Vermutungen über weitestgehend undokumentierte Theater-Frühformen der Jahre 400.000 bis 10.000 vor Christi reichen – nie den Eindruck des Trocken-Verstaubten oder gänzlich Erledigten bekommt, das zeichnet die Attraktivität und Überzeugungskraft dieser Einführung aus.
Dieses grundlegende Buch zur Theatergeschichte ist umsichtig gegliedert, nachvollziehbar argumentiert und anschaulich illustriert. Es kann jedem empfohlen werden, der sich informieren möchte über den großen historischen und anthropologischen Rahmen der gerade gestern gesehenen Theateraufführung. Es beglückt jeden, der nachdenken möchte über allfällige Theorien unserer Gesellschaft des Spektakels, der Selbstinszenierung und des Auftretens vor Zuschauern. Selten erschienen auch dem fortgeschrittenen Theaterfan und Forscher vergangene Ereignisse und uralte Probleme der Theatergeschichte so virulent und aktuell wie bei der Lektüre von Andreas Kottes Einführung in die Theatergeschichte.