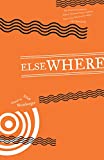Irgendwo anders und doch nah
„Elsewhere“ – eine Anthologie von Eliot Weinberger zusammengestellt
Von Emily Wollenweber
Die unterschiedlichen Autoren, deren Gedichte hier vom Herausgeber Eliot Weinberger zusammengestellt und teils übersetzt wurden, beschäftigen sich mit dem Thema des Exils und des Anders-wo-seins. Das englischsprachige Buch beinhaltet Lyrik, die zu verschiedenen Zeitpunkten, in unterschiedlicher Machart und über verschiedenartige Plätze geschrieben wurde. In die Materie werden wir mit der Erklärung eingeführt: „Being elsewhere was the common condition in a century of mass migration and deportation, political exile and casual tourism.” Die verschiedensprachigen und mehr oder weniger bekannten Autoren setzen sich mit diesen nach wie vor aktuellen Phänomenen auseinander. Damit einher geht das Reisen, Grenzen zu überschreiten oder sich auf neue Dinge einzulassen. Auch die Wahrnehmung verändert sich in diesem Zustand. Nach jedem Gedicht ist eine kurze Biografie von dem Autor zu finden. Thematisch eingeteilt sind die Gedichte nach Städte wie New York und Paris und Kategorien wie dem Transfer „Trains and Cars“ oder „Coda“.
Der Amerikaner Eliot Weinberger (geb. 1949), einer der bekanntesten Essayisten unserer Zeit, ist hierzulande mit seinem Essay „Was ich hörte vom Irak“ bekannt geworden. Seit 1995 veröffentlichte er diesen und weitere Texte und Gedichte in der bekannten Kulturzeitschrift „Lettre International“. Weinberger wurde 1992 für seinen Beitrag zur Förderung hispanischer Literatur in den USA zum ersten Preisträger des PEN/Kolovakos Award ernannt. Seine Essays wurden in vielen Sprachen übersetzt und er hat einige Gedichtsammlungen veröffentlicht. Auch in diesem Werk zeigt er sein Gespür für eine Lyrik, die sich an einem gemeinsamen Punkt trifft, obwohl sie doch unterschiedlich ist.
Die liebevolle Gestaltung der äußeren Erscheinung, wird von der enthaltenen Poetik noch übertroffen. Nahegebracht wird uns zunächst die Kathedrale von Notre-Dame in Paris von Kotaro Takamura. Takamura (1883–1956), ein Schriftsteller der nach einem einjährigen Studium der Bildhauerei in Paris die Stadt nicht mehr vergessen konnte, kommt aus Japan und ist zu einem Bohemian in Lyrik und Bildhauerei geworden, der sich eher französisch als japanisch fühlt. Ein ambivalenter Charakter, der zunächst enthusiastisch für den zweiten Weltkrieg schrieb, es dann aber bedauerte diese Position bezogen zu haben. Takamura schreibt in einer haptischen Bildsprache, seine bildhauerische Wahrnehmung ändert unsere Sicht auf die eigentlich typische Touristenattraktion der Stadt.
Vincente Huidobro und Jorge Carrera Andrade schreiben über den Eiffelturm. Huidobro (1893–1948), ein chilenischer Dichter, erfand seinen eigenen „Kreationismus“. Er war in nahezu jeder avantgardistischen Bewegung dabei, nahm an der irischen Unabhängigkeitsbewegung sowie am spanischen Bürgerkrieg teil, machte aus seinen Gedichten Bilder, war ein Drehbuchautor in Hollywood, ist als Kandidat für die Wahl zum Präsidenten von Chile aufgetreten und hat sich niemals von den Wunden, die er sich im zweiten Weltkrieg als Korrespondent zuzog, erholt. Das Besondere an seinen Texten ist seine Mehrsprachigkeit. Auch dieser Text ist in Französisch, Englisch und Italienisch geschrieben, ist von den Bildern des Künstlers Robert Delaunay inspiriert und während des ersten Weltkrieges entstanden. Andrade (1902–1978), heute weitestgehend in Vergessenheit geraten, war in den 1940er Jahren einer der bekanntesten lateinamerikanischen Dichter in den USA. Er nimmt den Eiffelturm auseinander und macht ihn zu einem metaphorischen Baum, der sich in die Stadt integriert hat und von seiner „natürlichen“ Beschaffenheit aus gesehen, auch in die Stadt passt. Er steht für das Zeitalter der Industrie.
Nach Paris kommt der Melting Pot New York ins Spiel. In „The Dawn“ beschreibt Federico Garcia Lorca die Härte und die Spielregeln im Untergrund der Stadt. Er zeichnet einen Ort, der niemals schläft, der keine wirkliche Hoffnung aufzeigt, der schmutzig ist und gerade beim Anbruch der Nacht Gefahren offenbart. Der spanische Autor Lorca (1898–1936) kam 1929 zur Zeit des Börsencrashs nach New York und bleibt für ein Jahr dort. Sein Buch „Poet in New York“ wurde 1942 in den USA veröffentlicht und legt Zeugnis von einer unwirtlichen, verstörenden und gefährlichen Stadt ab.
Auch Los Angeles, als ein Treffpunkt von Künstlern, darf in dem Konzept vom „Anders-wo-sein“ nicht fehlen. Die Hollywood-Elegien von Bertolt Brecht dürfte vielen Lesern schon zu Ohren gekommen sein. Mit dazu nimmt Weinberger auch ein weniger bekanntes Gedicht „L.A. Nocturne: The Angels“ von dem mexikanischen Dichter Xavier Villaurrutia (1903–1950), in dessen Erfahrung die Stadt eine immer währende aber auch eine sich erneuernde Beziehung von den Menschen untereinander darstellt. Seine Lyrik wird von Zeitgenossen als ein von Orten unabhängiger Raum beschrieben, in dem die Zeit stehengeblieben zu sein scheint.
Nach dem Exkurs in die Großstädte geht es nun ums Reisen. Eingeleitet wird dieser Teil durch „Things I didn’t know I loved“ von Nazim Hikmet, der darin beschreibt wie er als sechzigjähriger auf einer Fahrt von Prag nach Berlin endlich entdeckt, wie viele Dinge und Erfahrungen er durch sein Leben lieben gelernt hat. Hikmet (1902-1963) schüttet einen Koffer voller Bilder vor uns aus und zieht uns mit sich direkt hinein ins (Er-)leben. Der türkische Kommunist und Schriftsteller verbrachte sein halbes Leben im Gefängnis und setzte sich gegen Ungerechtigkeiten ein. Er hatte trotz seines ungewöhnlichen Lebens auch den Hang zum Normalen.
Als ein Highlight kann noch „Ocean-Letter“ von Guillaume Apollinaire empfohlen werden. Apollinaire (1880–1918) spielt mit der externen Gestalt von Lyrik. Er verbindet seine collagenartigen Wortfetzen mit der Form von Ortungswellen, die man eigentlich nur auf einem Radargerät, wie es häufig auf Schiffen benutzt wird, sehen würde. Der Inhalt setzt sich aus Zeitungszitaten zusammen, die frühe oder spätere Ereignissen in Mexiko aufgreifen. Apollinaire starb in jungen Jahren an dem letzten Tag des ersten Weltkriegs u.a. an seinen Wunden, die er sich als Soldat zuzog, konnte aber mit seiner Lyrik schon damals auf die zunehmende Technisierung der Sprache und des Lebens hindeuten, indem er seine Gedichte zu kleinen Kunstwerken machte.
Nachdem sich der Leser auf eine Reise um die halbe Welt begeben hat, endet das Buch mit „Stay“ von Ingeborg Bachmann (1926–1973). Ein Appell an das Ankommen oder ein sich-selbst-finden in einem durch Globalisierung, Vernetzung und sich ausbreitenden Kapitalismus, scheinbar immer schnellerem Leben und Handeln? Warum so viel Drum-rum und wenig zum Inhalt, fragt man sich nun vielleicht. Wie meistens bei guter Lyrik, spricht der Primärtext für sich. Den englischen Band gibt es zwar nicht in deutscher Übersetzung, er bleibt aber für den international orientierten Leser empfehlenswert. Auch für alle, die sich nicht oft mit poetischer Dichtung auseinandersetzen, kann das Werk einen Zugang vermitteln, da es leicht zu verstehen ist und die Hintergründe zu den Inhalten erklärt. Anders als bei ausschweifender Prosa, liegt hier die Würze in der Kürze. Und über Gedichten lässt es sich selbst bei Hitzewellen immer wieder gut brüten.
Ein Beitrag aus der Komparatistik-Redaktion der Universität Mainz