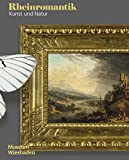Arbeit an der Inszenierung
Der romantische Rhein ist bis heute ein wirksames Bild. „Rheinromantik“ geht bis zu seinen Anfängen zurück
Von Walter Delabar
Der „romantische Rhein“ windet sich zwischen Bingen und Bonn einigermaßen aufwendig durch die Landschaft, was sich verkehrstechnisch lange Jahrhunderte nachteilig auswirkte. Aber das 19. Jahrhundert entwarf zu jenem gewundenen Stück Fluss, der sich zu einem der Kernelemente des Nationalbewusstseins der Deutschen entwickelte, eine spezifische Haltung, in der Bewunderung, Furcht und ästhetische Anschauung eine enge Verbindung eingingen. Wobei der Fluss und sein Verlauf wohl am wenigsten Grund dafür sind. Er beginnt in der Schweiz, ist heute eine Zeit lang deutsch-französischer Grenzfluss, macht schließlich dann ein paar hundert Kilometer in jenem Gebiet, das von den Preußen nur mit Mühe zu Deutschland geschlagen wurde und setzt seinen Lauf dann in den Niederlanden fort, wo sich auch seine Mündung befindet.
Und dennoch, der Rhein ist in der Ausstattung deutsches Kernland. Noch heute sind Touren auf seinem Mittelteil romantisch. Der Dom zu Köln, der Rhein und die Loreley bilden ein fast untrennbares Ensemble ästhetischer Anschauung, das bereits im frühen 20. Jahrhundert Spott auf sich zog: Karl Valentins „Loreley“ jedenfalls ist weit weg von jener Rheinrührseligkeit, die man gern Romantik nennt.
Auffallenderweise ist die Konstitution des Rheins als romantisches Stück Kultur keine Leistung der Deutschen allein, die sich damit gegen Frankreich und England abzugrenzen versuchten. Die „Wacht am Rhein“ ist ein typisches nationalistisch geprägtes Lied, das die Idee des geheimnisvoll umnebelten, des romantischen Rheins nicht nur ergänzt, sondern diesem zugleich auch entgegenarbeitet.
Seine Konstitution ist zum großen Teil der Modernisierung des Tourismus zu verdanken, an der insbesondere die Engländer großen Anteil hatten. Sie bereisten den Rhein, und auf diese Reisen geht die Erinnerung an jene kulturellen Artefakte zurück, die den romantischen Rhein konstituierten, bis hin zu den Nibelungen, die ihren Schatz bei Worms versenkt haben sollen.
Engländer bereisten schon im frühen 19. Jahrhundert den Strom, und auf diese Reisen geht die Begründung des Baedekers zurück, der sich zur Handfibel des Touristen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert entwickelte. Sein erster Band „Der Rhein“.
Der Rhein-Baedeker war die notwendige Grundlage für die auf Bildung und Vergnügen ausgehende Rheinreise, die das Erbe der Grand Tour antreten sollte. Daneben aber war die Produktion visueller Erinnerungsmarken erforderlich, an denen deutsche Kunstmaler ihren entscheidenden Anteil hatten, eben nicht nur jener William Turner, der heute fast durchweg dafür steht.
Im Zusammenspiel von textlichen und visuellen Mustern entstand das konsistente Bild einer idealen Region, mit der nicht nur ein idealisiertes Wunschland entworfen wurde, in dem die persönliche Anschauung ihre passenden Musterbücher vorfanden. Schaut man in den vorliegenden Band, wird deren fast schon serieller Charakter offensichtlich. Es sind die immerselben Ansichten der immerselben Motive, die in zahlreichen Varianten hergestellt wurden, um ein konsistentes Bild entwerfen zu können.
Im Kern dieser visuellen Strategie stand jene Familie, der der Hauptteil des Bandes gewidmet ist – der Malerdynastie Schütz –, die in enger Verbindung mit jenem Sammler und Verleger Johann Isaak von Gerning stand, der für die intensive kulturelle Kommunikation zwischen dem westlichen Deutschland verantwortlich war. Allein drei Maler, die den Namen Schütz tragen, sind an der Konstruktion des romantischen Rheins beteiligt – Christian Georg Schütz der Ältere, Franz Schütz und Christian Georg Schütz der Vetter.
Hinzu kommen Johann Caspar Schneider, Georg Schneider und Peter Becker, die jenes Spektrum an Rheinansichten malten, das bis heute für den romantischen Rhein steht: sanft bewaldete Ruinenlandschaften, in denen nur geringe Anfänge der Industrialisierung zu sehen sind und in denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Bäuerliche Szenen in einem frugalen Ambiente einer untergangenen Kultur. Die damalige rheinische Kultur nun zeichnet sich durch Beschaulichkeit und Anmut aus, durch Bescheidenheit und durch die Unterwerfung unter die Macht der Geschichte.
Durch all diese Landschaften schlängelt sich ein Fluss, der selbst wieder im Nebel verschwindet. Dabei sind die Menschen auf ihm durchaus beschäftigt. Fischer befahren ihn und Transporte sind auf ihm zu sehen. Aber eben nichts von der drohenden Industrialisierung, die sich den natürlichen Verlauf des Flusses wie seine Geschichtsmacht zu unterwerfen gedenkt und die auf Geschichte keine Rücksicht nimmt. Alle angestammten Verhältnisse wird sie verflüchtigen – aber davon ist eben hier nichts zu sehen.
Bild- und Textprogramm des Bandes klaffen so gesehen weit auseinander. Sind die Beiträge eher biografisch orientiert und spüren den Lebensläufen der Maler, Verleger, Sammler und Mäzene nach, auch der Rezeption des Rheins in England, so lässt sich der Betrachter durch die Bilder des Rheins in den Bann ziehen. Daraus wird eben auch erkennbar, dass die Rheinromantik nicht das Werk einer idealisierenden Naturkraft ist, sondern das Produkt einer fast sachlich zu nennenden Konzeptionsarbeit, die die Emotionen in Wallung bringen.