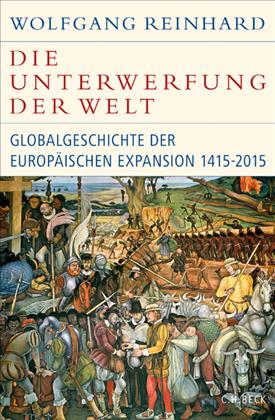Go West
Pete Dexters „Deadwood“ ist ein Western – und ein bemerkenswerter noch dazu
Von Walter Delabar
Wenn einer der besten amerikanischen Krimi-Autoren einen Western veröffentlicht, dann ist das bemerkenswert, auch wenn es sich in diesem Fall um eine Ausgrabung aus dem langjährigen Schaffen Pete Dexters handelt. Dexter, der von seinem Münchener Verlag erst in den vergangenen Jahren unter anderem mit Romanen wie „Paris Trout“ oder „Train“ vorgestellt wurde, ist in den USA bereits seit vielen Jahren präsent. Übermäßig produktiv ist er freilich nicht, hat er doch anscheinend seit 1983 nur sieben Romane geschrieben, was ihn von den Vielschreibern seiner Zunft auffallend unterscheidet – und der Qualität seiner Romane gut getan hat. Aber ein Western?
Die guten Zeiten des Western sind vorbei, wobei das Genre vor allem im Film eine bedeutende Rolle spielte. Zumindest in der Erinnerung ist der Western ein 1950er-Jahre-Spielfilm mit James Stewart oder dem unvermeidlichen John Wayne – weites Land und hohe Himmel eben. In der Literatur hat er es über das Heftchenformat hinaus nicht wirklich geschafft, trotz Karl May und James Fenimore Cooper. Aber auch im Film sind seine guten Zeiten lange vorbei, trotz aller Wiederaufnahmen von Kevin Costner und Quentin Tarantino.
Das ist plausibel, gehört der Western doch zu den Gründungsmythen der USA und weist ein Konzept auf, das sogar Parallelen zum Bauernroman etwa in Deutschland aufweist. Trotz der langen parallelen Phase, in der Western und Krimi gleichermaßen erfolgreich waren, hat der Krimi den Western mittlerweile als paradigmatisches modernes Motiv abgelöst. Und das aus gutem Grund, ist der Krimi doch eng an die Urbanisierung und damit an eines der Kernelemente der Modernisierung gebunden. Wo die Moderne auch die Peripherie radikal an sich anschließt, hat der einsame Mann in der Prärie keine Funktion mehr. Er muss sich stattdessen im städtischen Raum in einem engen sozialen Geflecht bewegen (was dann ja auch Begierden weckt).
Was übrig bleibt von dem Frontiers-Muster ist schließlich in die Science-Fiction verschoben worden – Star Trek in Reinform eben, statt Indianer Aliens, statt Prärie das Weltall. Nur das Ambiente ist verändert und es gibt neue Protagonisten, wenngleich von derselben Art, wie es sie bereits im Western gab.
Mit Dexters „Deadwood“ geraten wir freilich nicht nur in einen Western, sondern zugleich in ein Konglomerat von Medienformaten, die alle gegenseitig aufeinander zu verweisen scheinen: Dazu gehört neben dem Buch, das selbstverständlich auch verfilmt wurde, vor allem die gleichnamige TV-Serie, die immerhin drei Staffeln erreichte, bevor sie 2006 eingestellt wurde.
Dieses Deadwood, von dem man in unseren Landen nichts ahnt, scheint ein attraktives Thema zu sein. Wenn man bedenkt, dass im Roman immerhin Figuren wie Wild Bill Hickhok und eine gewisse Calamity Jane auftauchen, fühlt man sich jedoch ein bisschen in vertrauteren Gefilden, was allerdings nichts heißt.
Hintergrund des Romans, der auf historische Ereignisse Mitte der 1870er-Jahre verweist, sind der Mord an Wild Bill Hickhok und der Brand von Deadwood, der die größten Teile der Barackenstadt vernichtete. Der Roman selbst erzählt davon jedoch eher beiläufig und nebenher, auch wenn mit Wild Bills Tod eines seiner Kapitel schließt. Die tragende Figur des Romans ist ein gewisser Charles Utter, der gemeinsam mit Wild Bill einen Treck Siedler nach Deadwood begleitet und dort hängen bleibt.
Sobald die beiden Männer angekommen sind, finden sie sich in der nicht allzu feinen Gesellschaft Deadwoods je nach Façon zurecht – wobei bemerkenswert ist, dass Wild Bill eigentlich gar nichts tut, außer herumgehen, sich mit der vermurksten Prostata abplagen und Karten spielen.
Das geht solange gut, bis er erschossen wird, weil er – obwohl er nichts tut – von den Bewohnern Deadwoods als kommender Mann angesehen wird – was eben nicht jedem passt. Ob das für einen Auftragsmord reicht? In jedem Fall, und in jedem Fall in diesem Amerika, in dem die Waffen recht locker sitzen, die Sitten rau sind und Mörder keineswegs die Staatsgewalt fürchten müssen.
Wild Bill und Utter bewegen sich allerdings in einem Milieu, das bestenfalls im Film idyllisch wirken kann. Selbst im Buch erhält es eine ganz andere Qualität: Der Wilde Westen muss fürchterlich gestunken haben: Deadwood ist keine Stadt, sondern besteht aus Zelten, bestenfalls Hütten und staubigen Straßen, die bei jedem Regen Schlammlawinen mit sich führen. Die Goldgräber, die es hierher verschlagen hat, arbeiten, schwitzen, bluten, fressen, saufen, fallen in den Dreck, vögeln, urinieren und scheißen, sie sind krank, und was sonst noch alles an humanen Tätigkeiten denkbar ist. Sie waschen sich nur nicht. Mit einer Ausnahme: Charley Utter, der sogar Wert auf frische Wäsche legt.
Das merkwürdige Resultat dieser Lektüre ist, dass im Roman eigentlich zwar die ganze Zeit etwas los ist – Wild Bill erschossen, eine chinesische Sängerin und Prostituierte wird bestialisch ermordet –, aber es sind Ereignisse, die sich nicht in irgendeine finale Struktur einfügen. Dies alles führt nirgendwo hin. Die Erzählung beginnt und sie endet.
Dexters „Deadwood“ nimmt damit eine Erzählweise auf, die im modernen TV-Format mittlerweile dominant ist: Sie läuft nicht geradlinig auf einen Punkt zu, sondern entwickelt sich ihren eigenen Weg, und das in einer extrem komplexen Geschichte, deren Auflösung nicht ohne Schaden möglich ist. Also lesen wir weiter.
|
||