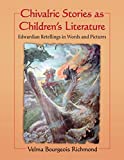Der Ritter im Kinderzimmer
Velma Bourgeois Richmond beschreibt einen reichen Fundus an Kinderbuchliteratur
Von Miriam Strieder
Die Jahre vom Regierungsantritt Edwards VII 1901 bis zum ersten Weltkrieg waren in Großbritannien geprägt von einem Lebensgefühl, das sich durch Nostalgie und Hoffnung auszeichnete. Diese „Edwardian Era“ nimmt Velma Bourgeois Richmond in Chivalric Stories as Children’s Literature zum Anlass, die Kinderbuchliteratur dieser Epoche genauer zu betrachten. Sie legt ihren Fokus dabei auf die Texte und bildlichen Darstellungen, die einen ritterlich-galanten Ursprung haben und auf mittelalterliche Literatur verweisen.
Velma Bourgeois Richmonds Zusammenschau gliedert sich in zwei Teile: Zuerst betrachtet sie die Zeitumstände, die diesen speziellen „Edwardian Moment“ hervorbringen und auf die Romantik und die Strömung der Pre-Raphaelites zurückverweisen, die sich 1848 formierten. Die umfangreiche Beschäftigung nicht nur mit der Literatur sondern auch mit der Kunst und dem Kunsthandwerk brachten besondere Schätze im Dekor hervor, was auch die reichen Schwarz-Weiß-Illustrationen in Richmonds Buch beweisen: Immer wieder belegt sie ihre Ausführungen mit Abdrucken von Bebilderungen der Kinderbücher, zeigt die Einflüsse der Pre-Raphaelites und des Jugendstils auf. Eindrucksvoll kann sie beweisen, dass die Werke des Kanons von Sir Walter Scott, H. W. Longfellow, Alfred Lord Tennyson oder William Morris, der für seine herrlich illustrierten Drucke unter anderem der Canterbury Tales aus der Kelmscott Press berühmt ist, Eingang in die Kinderbuchliteratur des beginnenden 20. Jahrhunderts gefunden haben.
Richmond fängt aber auch die Stimmung ein, die am Vorabend des ersten Weltkriegs in Großbritannien herrscht: Sie geht auf die Rassenlehre ein, die die „nordischen“ Rassen (und damit auch „nordische“ Geschichten) bevorzugt, erläutert den moralischen und didaktischen Wert der Erzählungen, die Frömmigkeit, die Aufrichtigkeit und Ritterlichkeit als erstrebenswerte Tugenden propagieren und zeichnet den Beginn der Kinderbuchliteratur in Großbritannien nach. Dabei betrachtet sie Formate, Ausstattung der Bände und Preise, erläutert die Funktion der Bücher als Schulbücher oder als Geschenke in der Schule und stellt vergleichende Betrachtungen zwischen Großbritannien und den USA an.
Im zweiten Teil ihres Buchs widmet sich Richmond thematisch gegliedert den einzelnen Werken. Dabei geht sie auf englische beziehungsweise britische Sammlungen von ritterlichen Geschichten ein, betrachtet die Geschichten britischer Dichter und erweitert dann den Blick auf Sammlungen, die europäische Geschichten aufnehmen hin zu Büchern, die neben europäischen, mittelalterlichen, frühneuzeitlichen oder romantischen Erzählungen auch Texte aus Amerika, Indien und anderen Ländern beinhalten und dabei meist unter einem spezifischen Motto stehen – zum Beispiel Reisen in fremde Länder, große Helden oder Nationalepen. Anschließend widmet sie sich den beliebtesten Helden der edwardianischen Zeit, darunter natürlich an erster Stelle Beowulf, aber auch Siegfried und Gawein (letzterer besonders durch die mittelenglische Erzählung Sir Gawein and the Green Knight). Auch hier zeigt sich wieder, dass von den Kompilatoren der Sammlungen „nordische“ Helden bevorzugt werden und in Kommentaren besonders Roland aus dem Chanson de Roland nicht besonders wertgeschätzt wird.
Den Abschluss des zweiten Teils bilden Überlegungen zur Pädagogik und zur Erinnerung an die Geschichten aus der Kindheit. Hier betrachtet Richmond Werke, die sich unter anderem mit den richtigen Vorlesetechniken auseinandersetzen oder die geeignete Auswahl für Kinder empfehlen sowie Schullektüren. In ihrem letzten Kapitel untersucht die Autorin Kinderbücher während und nach dem ersten Weltkrieg, die das Heldentum der britischen Nation und ihrer Soldaten in den Mittelpunkt stellen und damit eine Brücke zu den noblen Rittern des Mittelalters schlagen.
Richmonds Sammlung ist umfangreich und bildet eine ideales Nachschlagewerk. Auf Kosten dieser kompilatorischen Eigenschaften geht ein roter Faden, der zwar in den Kapiteln angelegt ist, aber innerhalb der Unterteilungen verlorengeht – eine offensichtlich angestrebte, chronologische Ordnung wird schließlich doch aufgegeben. Ebenso ist die Auswahl der vorgestellten Geschichten aus den Kinderbüchern zum Teil nicht klar zu erkennen: Hier erhält die Zusammenschau einen repetitiven und ermüdenden Charakter. Illustrationen in den einzelnen Büchern werden detailreich beschrieben, die Abbildungen spiegeln aber nicht immer die erwähnten Gestaltungselemente wider.
Eine weitere Ausdeutung der einzelnen Werke wäre an mancher Stelle sinnvoll gewesen; zu kürzen wären beschreibende Elemente des Covers und der Ausstattung der Bücher. Der Fokus einer Übersicht der vorhandenen Kinderbuchliteratur, die auf hauptsächlich mittelalterlichen Texten basiert, nimmt viel Raum ein und begrenzt dadurch Möglichkeiten, auf konkrete Zeitumstände einzugehen, die im ersten und kürzeren Teil des Buchs abgehandelt werden. Wünschenswert wäre auch ein Ausblick auf die Kinderbuchliteratur nach dem ersten und besonders nach dem zweiten Weltkrieg gewesen. Kurze, abschließende Betrachtungen zu Michael Morpurgos War Horse (1982), das 2011 von Steven Spielberg in Szene gesetzt wurde und auch im New London Theatre Bühnenpräsenz hat, oder zu Susan Coopers The Dark is Rising (1973), 2007 verfilmt, würden den Bogen in die Gegenwart spannen.
|
||