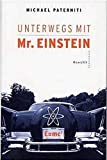Up, up and away...
Mit Einsteins Hirn quer durch die USA
Von Carsten Könneker
Kurz vor der vermeintlichen Jahrtausendwende 1999/2000 zierte ein allseits bekanntes Konterfei die Titelseite des "Spiegel". Unter der Überschrift "Das Gehirn des Jahrhunderts" blickte Einstein einmal mehr in unsere Alltagsrealität herein - ein vertrauter "Zeitgenosse", nur ausnahmsweise einmal ohne die berühmte herausgestreckte Zunge.
Was ist so kultig an Einstein? Allem voran wohl das Genie, seine vermeintlich unübertroffene Intelligenz. Und da diese nach allgemeiner Auffassung physisch im Gehirn angesiedelt ist, konnte der streng genommen misslungene "Spiegel"-Aufmacher überhaupt funktionieren - denn das Gehirn aus der Schlagzeile war ja gar nicht abgebildet, sondern nur dessen auch heute noch immer wieder gern bemühte sentimental-hintersinnig dreinblinzelnde Gesichtsfassade.
Haben Sie sich schon einmal gefragt, was Einstein eigentlich nach seinem Tod gemacht hat? Diese Frage erscheint zwar selbst in unserer Epoche allabendlicher Quizbehelligung zunächst absurd; rückt man ihr aber mit der Logik der Spiegel-Synekdoche zu Leibe, findet sie festen Untergrund. Die richtige Antwort lautet dann: Er schwamm, in rund 240 ungleiche Teile zerstückelt, Jahrzehnte lang in einem formaldehydgefüllten Bonbonglas!
Am 18. April 1955, der Starphysiker war gerade ein paar Stunden tot, öffnete der diensthabende Pathologe des Princetoner Universitätshospitals mit einer Kreissäge den Schädel und entnahm kurzerhand das Gehirn - ob mit Einsteins zuvor erteilter Erlaubnis oder zumindest unter Billigung durch den Nachlassverwalter oder die Erben, ist bis heute unklar. In jedem Fall blieb Dr. Thomas Harvey bis in unsere Gegenwart im Besitz seiner Beute - sogar noch, als er seinen Princetoner Posten verlor und sich im Mittleren Westen der USA phasenweise als Tagelöhner durchschlagen musste. Die ursprünglich anvisierte Forschungsarbeit zum prominentesten aller Gehirne wurde derweil immer wieder aufgeschoben. - Nicht nur auf den ersten Blick eine irgendwie gescheiterte Karriere.
Vor einigen Jahren nun stieß Michael Paterniti auf die Spur von Einsteins Gehirn. Nachdem es über 40 Jahre mit seinem neuen - diesmal zur Abwechslung völlig unspektakulärem - Besitzer von Ort zu Ort und Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle getingelt war, überredete der junge Journalist den mittlerweile schon über 90jährigen "Halbmediziner" Harvey, seine Reliquie doch endlich Einsteins Erben zu überlassen. Und so tuckerten die beiden tagelang in einem alten Skylark von New England nach Kalifornien, zu Evelyn Einstein, des Genies Enkelin - das Gehirn aus Sicherheitsgründen vom Bonbonglas in eine reisefreundlichere Tupperschüssel umgetopft.
Was, bitteschön, ist Stoff für eine gute Story, wenn nicht dieser? Und tatsächlich ist Paterniti mit seinem romanhaft daherkommenden Sachbuch-Erlebnisbericht ein Coup gelungen! Seine Erinnerungen an die Zeit mit Harvey und Einsteins Gehirn sind eine Lektüre, die ihres gleichen sucht: formal eine amerikanische Reisenovelle etwa in der Tradition von John Steinbecks "Travels with Charly", lose verzahnt mit einer fragmentarischen Einstein-Biographie und einer einfühlsamen Portraitskizze seines posthumen "Besitzers". (Bis auf das Gehirn wurde Einsteins Körper dem Willen des Wissenschaftlers folgend eingeäschert und auf See bestattet.) Dazu als Abrundung einige kritische Gedanken zum Thema Geniekult und Wissenschaftsgläubigkeit in unserer Zeit - eine durchweg unterhaltsame, teils tiefsinnige Lektüre und ein Vergnügen, wie es leider nur selten im Buche steht! Und nicht vergessen: Bei alldem schwappt das eingetupperte Jahrhunderthirn munter in einem alten Kofferraum quer durch die USA!
"Die bloße Tatsache, dass Du Einsteins Gehirn im Kofferraum hast, verändert die Art, wie Du die Dinge siehst."
Für Paterniti ist die Reise auch eine Reise zu sich selbst, ein Lebenseinschnitt mit verschiedensten Konsequenzen, und in gewisser Weise auch ein Selbstexperiment. Vor allem aber entdeckt Paterniti in seinen zahlosen Gesprächen mit Harvey, wie sehr dessen gescheitertes Leben vom Schatten der großen Lichtgestalt Einstein beherrscht worden war. Was für ein Mensch wäre aus dem seinerzeit 42jährigen, noch immer aufstrebenden Arzt geworden, hätte er an jenem Schicksalstag die Finger von Einsteins totem Körper gelassen? Mehr und mehr erhärtet sich der Verdacht, dass das Gehirn in Harveys Leben als Entschuldigung für alle möglichen Aufbrüche herhalten musste und ihm ermöglichte, sich auf der ständigen Flucht vor sich selbst immer wieder von nahe stehenden Menschen zu lösen - "Waffe und Schutzmechanismus zugleich", wie Paterniti festhält.
Ein hervorragendes, von der ersten bis zur letzten Zeile unterhaltendes und von Hainer Kober erstklassig übersetztes Buch - phasenweise richtiggehend witzig, etwa im Zuge der Beschreibung eines Zwischenstopps in Las Vegas, wo die skurrile Dreier-Reisegesellschaft für eine Nacht Station macht. In den anonymen Hallen der ewig taghellen Casinos verleiht das Hirn seinem posthumen Chauffeur plötzlich ein unbestimmtes Gefühl von Macht. Späten Casinogästen und Bediensteten berichtet Paterniti unaufgefordert von seiner momentanen Tätigkeit als Tupperbote und befragt seine Gesprächspartner nach ihrer Einstellung zu Einstein. "Ich weiß gar nichts über ihn", antwortet da ein koreanischer Croupier und verweist an seinen Vorgesetzten. Doch auch der lässt den Autor abblitzen: "Hab ihn heute Abend noch nicht gesehen. Tut mir leid, Kumpel."