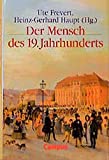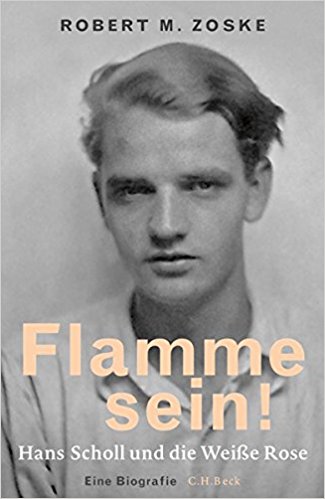Stützen der Gesellschaft
Die Lebenswelt im 19. Jahrhundert
Von Christina Ujma
Ziel des Buches ist es, den Umwälzungen, die das 19. Jahrhundert charakterisieren, in der menschlichen Lebenswelt nachzuspüren. Hier stellten die Industrialisierung und Verwissenschaftlichung der Gesellschaft einerseits, sowie das Anwachsen individueller Rechte und individueller Freizügigkeit andererseits die wichtigsten Veränderungen dar. In 13 Kapiteln werden uns "Der Arbeiter", "Unternehmer und Manager", "Der Ingenieur", "Der Arzt", "Die Gläubige", "Das Dienstmädchen", "Die Lehrerin", "Der Staatsbürger", "Der Migrant", "Großstadtmenschen", "Der Künstler", "Der Adlige" und "Der Bauer" vorgestellt. Was diese recht heterogene Mischung von unterschiedlichen Themen- und Menschengruppen problematisch macht, ist die Tatsache, dass die Autoren sich nicht auf ein Land konzentrieren, sondern eine europäische Perspektive versuchen und sich dabei im Regelfall auf Frankreich, Großbritannien und/oder Deutschland beschränken. Bei den großen Entwicklungsunterschieden, die diese drei Länder im 19. Jahrhundert aufzuweisen hatten, ist dies keine ganz nachvollziehbare Entscheidung. Erstaunlich ist außerdem die fast vollständige Vernachlässigung der mittel- und osteuropäischen Nachbarländer Deutschlands, vor allem des gesamten Habsburgerreiches.
Diese Vorbehalte treffen vor allem auf die Kapitel 1-4 zu, die sich mit den emblematischen Figuren des 19. Jahrhunderts beschäftigen, also mit dem Arbeiter, dem Unternehmer und Manager, dem Ingenieur und dem Arzt. Unbefriedigend ist hier vor allem Vincent Roberts Aufsatz "Der Arbeiter", der eigentlich nur zusammenfaßt, was über die Situation des Arbeiters im 19. Jahrhundert bereits allgemein bekannt ist - und der auch noch die Arbeiterinnen ignoriert. Ähnliche Vorwürfe kann man den folgenden Beiträgen kaum machen, sie bieten detailreiche Abhandlungen über die Entwicklung des jeweiligen Berufsstandes. Youssef Cassis faßt fakten- und facettenreich den Aufstieg der Geschäftsleute als neue gesellschaftliche Elite zusammen, und Sylvie Schweitzer beleuchtet am Beispiel Frankreichs den Aufstieg des Ingenieurs, einer Schlüsselfigur der Industrialisierung. Olivier Faure gibt in seinem Kapitel über den Arzt gar eine kompakte Darstellung der Entwicklung des Gesundheitswesens im 19. Jahrhundert, die dadurch gekennzeichnet ist, dass durch die Einführung von Krankenversicherungen die Institutionalisierung einer breiten Gesundheitspflege und eine Zentralstellung des Arztes erfolgte. So verdienstvoll diese Beiträge auch sind, sie beschränken sich im wesentlichen doch auf die berufshistorische Ebene; die Frage bleibt, ob eine eher kultur- oder mentalitätsgeschichtliche Darstellung nicht mehr Informationen über die Menschen des 19. Jahrhunderts geboten hätte.
Dafür entfaltet der Band seine Stärken, wenn es um die marginaleren und weniger beachteten Menschen des 19. Jahrhunderts geht, die zudem keinem festen Berufsstand zuzuordnen sind, wie z.B. in dem Kapitel über Migranten und Migration. Herausragend ist auch Michela De Giorgios Beitrag über "Die Gläubige". Di Giorgio stellt fest, dass im 19. Jahrhundert eine Verweiblichung des Katholizismus erfolgte: Je mehr sich die Männer von den traditionellen Formen des Glaubens zurückzogen, desto stärker wurde der Bereich Kirche von Frauen aller Altersgruppen erobert. Dies bedeutete einerseits, daß der kirchliche Bereich einer der wenigen Orte des öffentlichen Lebens war, an dem Frauen Zutritt und begrenzte Gestaltungsmöglichkeiten hatten, andererseits war das Weiblichkeitsideal der katholischen Kirche ein repressives. Dies machte sich besonders in der Mädchenerziehung bemerkbar, die damals in Italien und Frankreich fast ausschließlich in den Händen der Kirche lag.
G.-F. Buddes Beitrag über das Dienstmädchen beleuchtet einen oft ignorierten Bestandteil der Lebenswelt des 19. Jahrhunderts. Dabei war im 19. Jahrhundert eine bürgerliche Existenz ohne Hausmädchen nicht vorstellbar, wer etwas auf sich hielt, hatte mehrere. Trotz allgemeinem Freiheits- und Fortschrittspathos feierte in der Beziehung zwischen Herrschaft und Hausmädchen der Feudalismus fröhliche Urständ, hier war der Bürger nun gar nicht mehr fortschrittsorientiert. Nur Pflichten und keine Rechte, so sah der Alltag des Dienstmädchens aus, die Arbeit wurde vorwiegend mit Kost und Logis entgolten, Anspruch auf Freizeit oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gab es kaum.
Besonderer Überwachung war die Sexualität berufstätiger Frauen ausgesetzt. Zölibatär sollten nicht nur Dienstmädchen, sondern auch Lehrerinnen leben, wie Claudia Huerrkamp in ihrem Beitrag ausführt. Der einzig akzeptable Beruf für Bürgerstöchter ist untrennbar verbunden mit dem zähen Kampf um Frauenbildung, dem in Deutschland mehr Widerstand als in den Nachbarländern entgegengesetzt wurde; so öffnete das erste deutsche Mädchengymnasium erst 1893 seine Pforten.
Ein anderer Beruf, in dem relativ viele Frauen anzutreffen waren, war der der Künstlerin, wie Ute Frevert in einem glänzend geschrieben Aufsatz über den Künstler ausführt. Waren Frauen in den performativen Künsten - als Sängerin, Schauspielerin oder Tänzerin - nicht wegzudenken, hatten sie es in der bildenden Kunst erheblich schwerer. Frauen wurden in der Kunstwelt des 19. Jahrhunderts, die zwischen Großkünstlertum und Boheme anzusiedeln ist, massiv diskriminiert und behindert, aber immerhin waren zu Ende des Jahrhunderts 20 Prozent der Maler weiblichen Geschlechts. Da Ausbildung und Zugang im Unterschied zum Beruf des Arztes oder Rechtsanwaltes nicht staatlich reglementiert waren, stellte die Künstlerinnenexistenz immerhin eine Existenzmöglichkeit für Frauen dar, die anderes im Sinn als Ehe und Familie hatten, erklärt Frevert diesen Umstand.
Frank Caesteckers Kapitel über den Migranten und Friedrich Lengers über die Großstadtmenschen beleuchten neue Phänomene des 19. Jahrhunderts, während abschließend die beiden hervorragenden Kapitel über die Bauern und den Adel die Metamorphosen tradioneller Bevölkerungsgruppen analysieren.
Insgesamt schafft es "Der Mensch des 19. Jahrhunderts", die Stützen der Gesellschaft ebenso zu porträtieren wie die Unterprivilegierten; dabei verbleibt der Band allerdings meist im Mainstream der Gesellschaft. So wäre es interessant gewesen, das Kapitel über den Staatsbürger mit einem über diejenigen zu kontrastieren, die sich dem Kampf für staatsbürgerliche Rechte verschrieben hatten, wie den Suffragetten etwa. Der Bohemien, der Anarchist, der Lebensreformer, der Revolutionär, sogar der Sozialdemokrat/Sozialist wären Figuren, die gesellschaftliche Auseinandersetzung symbolisieren würden. Schließlich war das 19. Jahrhundert an Konflikten nicht gerade arm, sie kommen im vorliegenden Band allerdings nur selten zur Sprache.
"Der Mensch des 19. Jahrhunderts" ist eine Aufsatzsammlung, die irgendwo zwischen Wissenschaft und Sachbuch anzusiedeln ist, sie bietet Altes und Neues, einführende Informationen und unbekannte Details in bunter Mischung. Den Menschen des 19. Jahrhunderts haben die Autoren nicht gefunden, weil es ihn, wie die Herausgeber im Vorwort sagen, eigentlich auch nicht gibt.
|
||