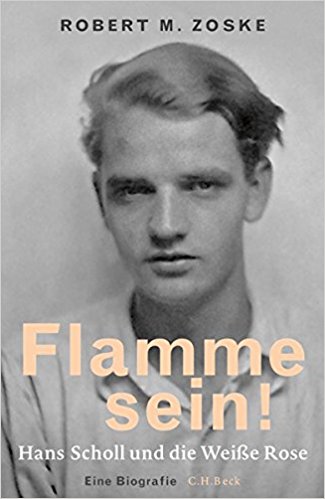20 unter 30
Eine Erzählsammlung junger deutscher Autoren
Von André Hille
Zwanzig frische Eier, Entschuldigung, Autoren präsentiert die Deutsche Verlagsanstalt in ihrer neuen Erzählsammlung "Junge deutsche Autoren. 20 unter 30". Warum jedoch auf dem Umschlag der Anthologie eine Palette mit 20 Eiern, die kein Haltbarkeitsdatum besitzen, abgebildet ist, will sich nicht recht erschließen. Handelt es sich vielleicht um genmanipulierte Eier, die nicht schlecht werden? Oder soll hier die simple Metapher zum Tragen kommen, dass diese Autoren noch ausgebrütet werden müssen? Doch wer ist dann die Henne? Der Verlag?
Wie dem auch sei, die Herausgeber Martin Brinkmann (Jahrgang 1976) und Werner Löcher-Lawrence (Jahrgang 1956) wissen um den "Hype" der in der letzten Zeit um die junge deutsche Literatur gemacht wurde und haben den Anspruch, sich davon abzugrenzen. Jenseits von "Labels wie Popliteratur [...] oder Fräuleinwunder", die nach Meinung der Herausgeber meist oberflächlich bleiben, wollen sie einen Überblick über das bieten, "was sich an wirklich Interessantem in der jungen Literatur tut." Dabei nehmen sie für sich in Anspruch, in ihrer Anthologie zwanzig gute Geschichten von literarischer Qualität versammelt zu haben.
Pauschal lässt sich dem nicht zustimmen. Die Qualität der Texte differiert teilweise stark. Die etwas bekannteren Namen bieten dabei nicht zwangsläufig die besseren Texte. Alexa Hennig von Lange zum Beispiel baut eine Beziehungsstory um das Stück "Baal" von Bertolt Brecht herum auf, wobei komplette Sentenzen des Dramas unmotiviert in die Kurzgeschichte übernommen werden. Der Versuch, den Figuren dadurch Tiefe zu verleihen oder vom Glanz des Zitierten zu profitieren, misslingt gründlich. Die Charaktere und die vorgestellte Beziehung bleiben flach und eindimensional.
Andere, unbekannte Autoren hingegen schufen Texte von beachtlicher Sensibilität. In Patric Aristides "Südwind", Susanne Schrimpfs "Kassiopeia" oder Julie Zehs "Der Hof" werden gekonnt, wenn auch sprachlich bisweilen noch etwas unausgereift, Stimmungen zwischen den Zeilen transportiert. Hier wird der Überdruss einer jungen Generation deutlich, die Abgeklärtheit, mit der die 20 bis 30-jährigen mit Beziehungen oder Bekanntschaften umgehen. Es sind Geschichten recht sprachloser junger Menschen (die Dialogarmut ist übrigens kennzeichnend für den gesamten Band), deren einzige Form von Kommunikation darin besteht, auf Partys herumzuhängen, zu trinken und ab und zu miteinander zu schlafen - wobei selbst dies meist recht leidenschaftslos und egoistisch hinter sich gebracht wird. Das Leben der Protagonisten findet an Zwischenorten statt: in fremden Wohnungen, Kneipen oder Hinterhöfen. Ein kurzer Blick zurück auf die noch schlafende Affäre der letzten Nacht, vorsichtige Schritte auf dem knarrenden Parkett, bevor die Tür endgültig hinter einem fremd gebliebenen Menschen zugezogen wird. Im Grunde geht es, wie eh und je, um Beziehungen, Liebe, Trennung, nur ist in den Geschichten dieser jungen Autoren alles ein wenig flüchtig: flüchtige Begegnungen, flüchtiger Sex und flüchtige Geschichten darüber.
Zugegeben, viele Texte bewegen sich in Anspruch und Engagement durchaus über de, qualitativen Level der deutschen Popliteratur - doch es gibt Ausnahmen. Etwa den Text "Zinke" von Saša Stanišic, eine fragwürdige Verarbeitung des 11. September in Kanak Sprak: "Musste doch früher oder später so kommen. Ist natürlich dick. Klar. Wie Lady Di damals. [...] und wie sich das Flugzeug [...] in die Kurve legt und da reinhämmert. Schon irre, oder? Was meint ihr, was ist schlimmer? Da drin sitzen und rausgucken oder grad gemütlich Kaffee trinken, so im Büro und auf einmal: Scheiße. Ein Scheißflugzeug kommt da angefuckt." Krätzsch, der Freund von Zinke antwortet: "Ist beides Kacke. Aber ich glaube, im Flugzeug hocken, das ist irgendwie brutaler. [...] Das fetzt dich voll weg, oder?" Als sich die Jugendlichen auch noch anschicken, den Vorgang sowie dessen mediale Verarbeitung ausführlich zu kommentieren, wird's vollends unerträglich: "die Amis! Das ist doch wie früher Nazipropagandakack, oder? Ich find das abartig! Ich mein: Was soll das?" Ja, was soll das? Die Bemerkungen und Reflexionen über dieses weltbewegende Ereignis gehen nicht über die üblichen Phrasen hinaus und scheinen den Protagonisten in den Mund gelegt.
Falls sich überhaupt so etwas wie Themengebiete innerhalb dieser Anthologie benennen lassen, so sind es neben den erwähnten "Party-Geschichten" Texte um die Selbst- und Körperwahrnehmung junger Mädchen. Mehrfach werden Probleme der Pubertierenden im Allgemeinen und Mutter-Tochter-Beziehungen im Besonderen verhandelt (oder sollte man sagen, verarbeitet?), denen der Wille zur Psychologisierung deutlich anzumerken ist.
In "Jerusalem" von Bettina Galvagni geht es um ein junges Mädchen, dessen Mutter Psychologin ist. Die Gespräche zwischen Mara und ihrer Mutter wirken zeitweilig wie eine Fachsimpelei zwischen zwei befreundeten Psychologinnen. Das Mädchen legt ein Reflexions- und Sprachvermögen an den Tag, dass es unmöglich besitzen kann. Mara erklärt ihrem Lehrer die Übertragungsliebe: "Die Patienten, das ist eher eine romantische Liebe, die sie empfinden, eine idealisierte Liebe, die von Rätseln lebt, die sie niemals lösen werden. Niemals werden sie wissen, wer meine Mutter ist. Ich erlebe es sogar bei Freunden meiner Mutter, auch sie wissen nicht, wer sie ist, sie bleibt unantastbar, selbst ohne weißen Mantel ist sie wie in ein weißes, jungfräuliches Laken gehüllt, das niemand berühren kann. Dabei - wie viele Augen verfolgen jeden ihrer Schritte, versuchen, diese Schritte an ihr Herz zu pressen, als ob sie sie dadurch wenigstens für einen Augenblick besäßen."
Solche Dialoge wirken gestelzt und konstruiert, wie die ganze Geschichte. Dass die Tochter durch die Gespräche mit der Mutter überfordert und im Grunde eine "kleine Erwachsene" ist, wird nicht zuletzt durch die augenscheinliche Metapher am Ende der Geschichte offensichtlich.
"Zickzack oder die sieben Todsünden" von Silke Scheuermann erzählt von einem pubertierenden Girlie, das ein quasi-inzestuöses Verhältnis zu ihrem Bruder und massive Probleme mit ihrem Körper hat: "Sie klopfte auf ihren Bauch [...], sie war dünner geworden, diätdünn. Zuhause trickste sie, trug stundenlang einen Keks durch die Wohnung, und der Vater sagte, das Mädel kann alles essen, immer isst sie gerade etwas, wenn man sie sieht, und bleibt doch mager wie eine Katze." Sobald der "Schauspieler-Keks [...] seine Schuldigkeit getan" hat, landet er im Mülleimer.
Nicht zu dünn, sondern - zumindest in den Augen der Mutter - zu dick, ist die Tochter in der Geschichte "Babyspeck" von Julia Christina Wolf, in der eine recht simple Kausalität zwischen den ständigen Nörgeleien der Mutter und dem Übergewicht der Tochter hergestellt wird.: "Steffi weiß, was ihre Mutter so denkt, wenn sie sie anguckt. Fünf, wenn nicht sechs, denkt Steffis Mutter, aber sie will nicht zu hart sein, also sagt sie: 'Drei bis vier. Wenn du nur so drei bis vier Kilo abnehmen würdest, Mäuschen. Mmmh? [...] Iss doch einfach mal weniger', sagt Steffis Mutter immer und beendet das Streicheln mit einem aufmunternden Klaps." Doch man gewinnt mit der Zeit den Eindruck, die Verfasserin arbeite sich hier hasserfüllt an seiner Mutter ab, in jeder Zeile sind die Schuldvorwürfe spürbar - doch Wut ist selten ausreichende Motivation für eine gute Geschichte.
Die Herausgeber haben insgesamt recht talentierte Autorinnen und Autoren in ihrer Anthologie versammelt, doch fällt andererseits auch keine der Geschichten wirklich aus dem Rahmen.
Mit "20 unter 30" liegt ein verhältnismäßig konventionelles und in der Qualität schwankendes Generationenporträt vor, das sowohl Stimmungen der twenty-somethings als auch virulente Themen unter den jungen Autoren widerspiegelt.
|
||