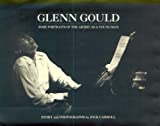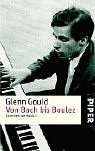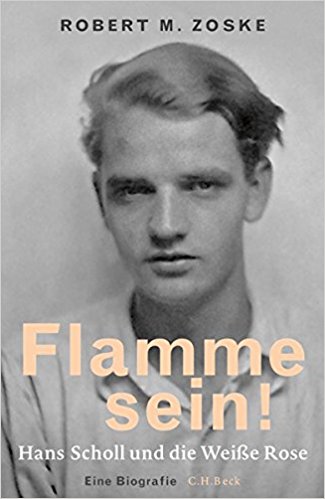Anfang und Ende aller Musik
Neue Publikationen zu Glenn Goulds Leben und Werk
Von Helge Schmid
Mit Bachs "Goldberg-Variationen" begann und endete sein musikalisches Leben. 1955 nahm David Oppenheim, der Direktor von Columbia Masterworks, den jungen Kanadier unter Vertrag. Die erste Aufnahme des Pianisten für sein neues Label sollten die "Goldberg-Variationen" sein, eine kühne Entscheidung, denn eine Einspielung von BWV 988 auf Klavier warf sofort die Frage nach der Authentizität auf. Bedeutende Interpreten erklärten, man dürfe Bach nur auf dem Cembalo oder Clavichord spielen, aber namhafte Pianisten spielten ihn unbeirrt auf dem Klavier. Sie brachten einen romantisierten und harmonisierten Bach zu Gehör, und ihr Paradestück war das lyrisierte ,Italienische Konzert'.
Glenn Gould brach mit dieser Tradition der "integralen" Spielweise: Er betonte die Bachsche Kontrapunktik und arbeitete die einzelnen Stimmen klar heraus. So hatte man Bach noch nicht gehört, weder in dieser Klarheit noch in dieser Schnelligkeit - die Spieldauer betrug nur 38 Minuten und 27 Sekunden. Gould raste durch die Variationen, die er für unbedeutend hielt, und er verweilte bei denen, die er zum Besten zählte, was Bach je geschrieben habe.
"Wie spielt Glenn Gould?", fragte Jens Hagestedt Anfang der 90er Jahre und rekonstruierte Goulds "Theorie der Interpretation" aus einer Fülle von Beispielen und demonstrierte sie anhand von mehr als 200 Notenbeispielen. In seinem - leider vergriffenen - Buch unterstellt er Gould eine gewissenhafte Auslegungstheorie und Auslegungspraxis. Er analysiert nicht nur Goulds Technik, sondern auch Goulds Rezeption in der Kritik, die seit jeher in zwei Lager zerfällt: Die einen feiern Goulds Einspielungen und Konzerte als absolute Kunst, die anderen versuchen, sie als sarkastisch, böswillig oder vom Authentitätspostulat verblendet zu marginalisieren. Inzwischen hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass Gould die "kontrapunktischen Texturen" selbst bei Mozart und Beethoven mit großer Konsequenz, das heißt Rhythmik und Dynamik herausarbeitet: Er verzichtet auf Glättungen und Bindungen, er stellt die Kategorie der ,Werktreue' in Frage, er kultiviert den schroffen Anschlag, die kleinen Notenwerte und die Verschiedenheit der Stimmen, soweit sie sich kontrapunktisch auswerten lassen.
Zwanzig Jahre nach Goulds Tod ist es nicht leicht, aus der Fülle der Publikationen, die an den legendären Pianisten erinnern, auszuwählen. Seit längerem liegen, auch im Deutschen, Goulds "Schriften zur Musik" in zwei Bänden vor. Sie analysieren Komponisten und Werke (und geben dabei Kritikern ,vertrauliche Hinweise'), sie bieten Begleittexte zu eigenen Einspielungen, aber auch zur Aufführungspraxis anderer und zur Medientheorie, die durch Goulds Rückzug aus den Konzertsälen der Welt und durch seine Bevorzugung moderner Studiotechnik Auftrieb erhielt. Viele Beiträge zeigen schon im Titel, dass hier ein witziger, origineller, unkonventioneller Kopf zu entdecken ist, der auch mit Textsorten spielt: "Glenn Gould interviewt sich selbst über Beethoven" oder - noch gewagter - "Glenn Gould interviewt Glenn Gould über Glenn Gould". Manche seiner Musikerporträts sind spöttisch und respektvoll zugleich, etwa das von Yehudi Menuhin, mit dem Gould 1966 im Fernsehen auftrat. Bereits hier wurde Goulds Leidenschaft für den Dialog deutlich: Er bestritt ihn nicht nur mit Instrumenten, sondern auch mit Argumenten, und wir verdanken seiner intellektuellen Streitkultur viele Stunden großer Interpretationskunst. Vor allem die für das französische Fernsehen produzierten Studiogespräche mit Bruno Monsaingeon haben unser Gould-Bild geprägt.
Zwei Bildbände komplettieren die Sammlung: "Glenn Gould. Some Portraits of the Artist as a Young Man" von Jock Carroll ist eine Art Familienalbum ebenso wie das von Malcolm Lester konzipierte Werk "Glenn Gould. Ein Leben in Bildern". Jock Carrolls Bilder stammen aus dem Jahr 1956, demselben, in dem Alfred Wertheimer seine berühmten Elvis-Aufnahmen machte. Jock Carroll arbeitete zwanzig Jahre lang als Autor und Fotograf für das kanadische Weekend Magazine. 1956 bekam er die Chance, Gould auf einer seiner ersten Tournees zu begleiten. Seine Reportage titelte: "There's Nothing Eccentric About Me". Der Bildband, der nach vierzig Jahren mit den Aufnahmen von damals entstand, zeigt den kaum erwachsenen 24jährigen Klavierschüler auf der Schwelle zum Ruhm - schon in den typischen Posen am Klavier, im Mantel, mit Schal, Hut und Fingerhandschuhen. "There's a crazy man in room 421", meldet ein erschrockenes Zimmermädchen dem Hotel-Manager, doch der beruhigt sie: "That's just Glenn Gould. He's pretending to be an orchestra."
Eine Fülle von Aufnahmen bietet Malcolm Lesters Buch "Glenn Gould. Ein Leben in Bildern". Es enthält nicht nur ganz frühe Aufnahmen und Lebenszeugnisse des Kindes und Kleinkindes (darunter die reproduzierte Unterschrift des Fünf- oder Sechsjährigen), sondern - als CD-Beigabe - auch die erste Einspielung überhaupt: "His Very First Recording" von Mozarts Fantasie in f-moll, KV 594, aufgenommen im Juni 1947 im Haus von Alberto Guerrero, dem damaligen Klavierlehrer Goulds.
Viele Dokumente zeigen das Kauzige des Pianisten, zum Beispiel die folgende Karte, die er an Fans und Reporter ausgab: "Vielen Dank für Ihre Rücksichtnahme ... Manchmal erleiden die Hände eines Pianisten unvorhersehbare Verletzungen. Es erübrigt sich wohl zu sagen, dass das eine äußerst ernsthafte Angelegenheit sein kann. Ich bin Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie davon Abstand nehmen, mir die Hand zu schütteln. So gerät keine der beiden Seiten in Verlegenheit." Einige Fotos zeigen Gould in seinen komischen Rollen: als deutscher Tonsetzer Karlheinz Klopweisser oder als englischer Komponist Sir Nigel Twitt-Thornwaite. Bedrückend wirken die letzten Aufnahmen aus Goulds Studio im "Inn on the Park" in Toronto sowie die verwaiste Stadtwohnung nach seinem Tod.
Glenn Gould starb an den Folgen eines schweren Schlaganfalls: Als er am 27. September 1982 gegen zwei Uhr mittags aus dem Schlaf hochfuhr, erkannte er sofort, dass sein Zustand kritisch war. Ein Freund fuhr ihn ins Krankenhaus, wo er in ein Koma fiel, aus dem er nicht mehr erwachte. Am Morgen des 4. Oktober wurde die Herz-Lungen-Maschine ausgeschaltet. Seine Musik lebt weiter.
|
||||||||