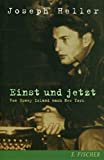Großauge sei wachsam
Joseph Hellers Memoiren "Einst und Jetzt" in schlechter Übersetzung
Von Lutz Hagestedt
Vor Jahren bat Ludwig Harig seinen achzigjährigen Vater, "aufzuschreiben, was ihn in seinem Leben am tiefsten bewegt" habe. Der Vater kommt der Bitte nach, aber seine Erinnerungen erzählen nur vom Krieg: "Mit keinem Wort hat er Mutter erwähnt, hat nichts von mir und meinem Bruder gewußt, nicht einmal seiner täglichen Arbeit gedacht, selbst seine Kindheitserinnerungen sind Kriegsgeschichten aus dem Vorkrieg."
Es ist aufschlußreich, wie Erzähler ihr Leben gewichten. Auch Joseph Heller (geb. 1923 in Brooklyn) war Kriegsteilnehmer, kam dreißig Jahre später als Ludwig Albert Harig zum Einsatz und flog 1944 sechzig Pflichteinsätze als Bomberschütze in Südeuropa. Doch sein Militärdienst nimmt in seinen Erinnerungen kaum dreißig Seiten ein, seine Kriegseinsätze schildert er vor allem im 8. Kapitel (sinnigerweise mit "Frieden" überschrieben), wie ein übermütiger Junge, der artig seine Pflicht erfüllt, um möglichst rasch rauszukommen auf den Bolzplatz oder in das wahre Leben. Mag sein, daß der Krieg in seinen Memoiren deshalb so knapp resumiert wird, weil er dazu schon in seinen Romanen ("Catch-22", 1961; "Was geschah mit Slocum", 1969) alles gesagt hat, denn in Hellers Augen ist der Roman eine Form der Autobiographie. Er erläutert dies an einem Beispiel: darin kommt ein "fein säuberlich gepackter Koffer" vor, "mit dem ich für zwei Wochen in ein Sommerlager auf dem Land fuhr [...]. Was den Rest der Familie so erstaunte und erheiterte, war die Tatsache, daß bei meiner Rückkehr der Koffer noch genau so tadellos säuberlich gepackt war wie bei der Abfahrt. Ich war einfach nicht auf den Gedanken gekommen, ihn auszupacken. [...] Mein ganzes Leben lang war das so - immer war´s so viel einfacher, wenn sich um all das jemand anderer für mich kümmerte. In dem Roman ›Endzeit‹ schreibe ich über meinen Yossarian, daß der Mann es niemals lernte, sein Bett zu machen, und eher verhungert wäre als zu kochen. Das ist Autobiographie."
Joseph Heller ist ein gewitzter, selbstironischer Erzähler. Selbst wo er über Privates schreibt, sind seine Erinnerungen sozialgeschichtlich aufschlußreich, weil er, aus armen Verhältnissen stammend, in verschiedenen Milieus gelebt und gearbeitet hat und dadurch seinen Blick für soziale Unterschiede und habituelle Veränderungen schärfen konnte. Die religiöse Praxis der Familie, jüdische Einwanderer aus Osteuropa, an Jom Kippur den Kaddisch für den toten Vater zu beten, hat sich zum Beispiel so weit abgeschliffen, daß sie mehr die Funktion hat, den Anstand zu wahren, als die, den Glauben zu bekennen.
Anfang der 40er Jahre arbeitet Heller als Hilfsarbeiter in einer Werft der Kriegsmarine. Für die Weißen in Portsmouth/Virginia sind die ebenfalls dort arbeitenden Schwarzen "so bedeutungslos", "daß man sie niemals auch nur erwähnte". Außer bei kurzen Arbeitsanweisungen kommt kein Dialog zwischen Weißen und Schwarzen zustande. Hingegen beobachtet Heller einen ausgeprägten "Haß der Protestanten auf die Katholiken", während er als Jude eine "seltene Novität" darstellt. Frostig wird sein Verhältnis zu den Kollegen erst, als er sie darüber aufzuklären versucht, daß Jesus eigentlich Jude gewesen sei: "Das sofortige und einhellige Erstarren des gesamten Kreises von weißen Gesichtern war eine schnelle, deutliche Warnung, daß sie so etwas noch nie gehört hatten und es auch jetzt nicht hören wollten - nicht jetzt und überhaupt nie."
Heller weiß uns auch von den "precious moments" seines Lebens zu erzählen, die uns anrühren, ohne daß er es darauf angelegt hätte. Seine erste Ehe ist offenbar eine gut funktionierende neurotische Symbiose, doch spielen Frau und Kinder in seinem erzählten Leben eine eher untergeordnete Rolle. Im Zentrum seiner Erinnerung an "sein Leben als Mann" steht die freudianische Therapie, die Heller Ende der 70er Jahre beginnt. Auch dies ist ein sozialgeschichtlich aufschlußreiches Kapitel seiner Lebensgeschichte, es heißt "Psychoanalytisches".
Das Buch ist fast durchgehend schlecht übersetzt, aber man gewöhnt sich daran. Man gewöhnt sich daran, daß Joachim Kalka den fein (selbst-)ironischen Ton dieser Autobiographie nicht trifft. Man gewöhnt sich daran, daß aus der federleichten Selbstaufhebung, die Heller ständig betreibt, ein auftrumpfendes eitles Geschwätz wird. Wo Heller schalkhaft-doppelbödig ist, ist Kalka dumpf und bieder. Man gewöhnt sich daran, daß aus der gewandten Kunst, all das Banale des eigenen Lebens erzählen und das Problematische daran thematisieren zu müssen, das Banale monolithisch zurückbleibt. Man gewöhnt sich an Kalkas holpriges Ausländerdeutsch, das - offenbar Wort für Wort in die Maschine gehackt, huschhusch und wieder "hat ein Buch fertig" - unlektoriert in den Satz gegangen ist. Ein Beispiel gefällig? "Das also war der Häuserblock - ein Abschnitt unserer Straße zwischen zwei Avenuen, der von all der Geselligkeit wimmelte, die wir brauchten, von Jungen und Mädchen. [...] Ich sehe es als eine Art Grund zu negativem Stolz, daß kein einziger der Jungs, mit denen ich aufgewachsen bin, es als Sportler zu etwas brachte oder es auch nur versuchte. Es gab einen Rhythmus unserer Spiele, der sowohl jahreszeitlich wie instinktiv war. [...] Es kam ein gewisser Augenblick nach dem Labor Day, da jeder Junge zu begreifen schien, daß der Sommer endgültig vorüber und die Zeit gekommen war, wo man den Football in Bewegung zu setzen hatte."
Man sieht sie förmlich wimmeln, die Geselligkeit ("companionship", also "Gefolgschaft"), die wir Kinder brauchten ("we young ones needed"), Jungen wie Mädchen ("both boys and girls"). Und man entwickelt "eine Art Grund zu negativem Stolz", die vom guten Deutsch nicht gedeckten Formulierungen des Übersetzers quasi vom Deutschen ins Deutsche zu übersetzen. Es kommt aber "ein gewisser Augenblick", der uns - durch die schwache Übersetzungsleistung - am "deutschen Heller" verzweifeln läßt. Besser wäre es natürlich, das Original zu lesen: "These were the only two true amusement parks then existing, each charging an admission price and incorporating attractions exclusively its own, in name if not necessarily in originality". Im Deutschen: "Dies waren [...] die beiden einzigen echten Vergnügungsparks, die es damals gab; jeder erhob ein spezielles Eintrittsgeld und bot exklusive Attraktionen an, die jedenfalls exklusive Namen trugen". Eine zweifelhafte Attraktion der Kalkaschen Übertragung ist der "letzte, goldene, glückhafte Ring", der uns im ersten Absatz anleuchtet, ebenso falsch übersetzt wie "the real thing" ("wirklich aus Gold") im ersten Satz. Die Bedeutung von Hellers Formulierung wird durch die Übersetzung interpretierend verkürzt und der jugendlich staunende Ton zerstört, der hier ausdrücken soll, daß man so etwas wie den "genuine article" gefunden habe, das Echte, Wahre, Unverfälschte - und nicht einfach einen Ring aus Gold. Die feine, genaue Wahl des Registers bestimmt nur bei Heller über die inhaltliche Aussage, über die Stellung, die der Erzähler zur eigenen Geschichte jeweils einnimmt, bestimmt über den Ton und die Atmosphäre des Erzählten (zwischen Nostalgie und ironischer Distanz), über die Färbung und Schichtung des Stiles (über den Soziolekt der jüdischen Einwanderer, der Jugendlichen, der Militärs, der Stahlarbeiter, der Verlagsbranche). Davon ist im Deutschen wenig geblieben. Kalka nutzt kaum die Möglichkeit zur lexikalischen, syntaktischen, pragmatischen Paraphrase, sondern übersetzt englische Idiomatik wortwörtlich, was ein fehlerhaftes, ungrammatisches und häufig sinnentstellendes Deutsch ergibt: "Als Junge begann er, ein gewisses Kapital anzuhäufen, indem er großäugigen Besuchern Glasphiolen [...] verkaufte." Großaugen, seid wachsam, denn hier sind die "wide-eyed visitors" gemeint, die "staunenden" Badegäste also, die sich an den seltsamen Verrenkungen, die hier das Deutsche im Krebsgang vollführt, gar nicht sattsehen können.