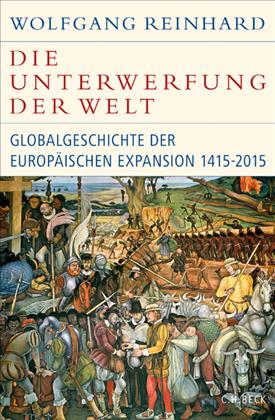Zauberland ist abgebrannt - und brennt noch …
Über die Ton Steine Scherben-Biographie von Kai Sichtermann, Jens Johler und Christian Stahl
Von Uli Volz
Kai Sichtermann, Bassist und "Ur-Scherbe", und seine Co-Autoren Jens Johler (Schriftsteller und Wegbegleiter der Scherben seit Anfangszeit) und Christian Stahl (Journalist) erzählen in "Keine Macht für Niemand" die Geschichte der Band von ihrer Gründung in einer ehemaligen Kreuzberger Fabriketage im August 1970 bis zu ihrer endgültigen Auflösung 1985. Im Vorwort schreibt Kai Sichtermann:
"Was wir nicht wollten, war: Glorifizierung. Nicht die Scherben als ,Mythos', Legende', auch nicht die Scherben als ,Kult', was immer das sein mag, sondern die Geschichte einer Band, die exemplarisch war für ihre Zeit: Sie hat als rebellische Gruppe begonnen, hat die Hausbesetzungen populär gemacht, ist später vor der dogmatischen - auch der terroristischen Linken - aufs Land geflohen, hat eine Landkommune gegründet, hat als Captain Hammer-Band Wahlkampf für die SPD gemacht, war Teil der Schwulenbewegung, hat sich mit Magie und Esoterik beschäftigt, hat mit der ,Grünen Raupe' den Wahlkampf der GRÜNEN unterstützt und sich schließlich, ächzend unter einer drückenden Schuldenlast, aufgelöst."
Dieses Ziel haben die Autoren auch erreicht. Die Gefahr der Mystifizierung oder Verkitschung, der viele Bandbiographien zum Opfer fallen, ist an diesem Buch glücklicherweise vorbei gegangen. Die vielen Widersprüche und Probleme der Band, ihre Entwicklung und ihren harten Kampf um musikalische Anerkennung werden ohne Scheu aufzeigt, und zugleich wird ein nicht unbedeutender Zeitabschnitt deutscher Geschichte, von Hippietum und linker Bewegung, nachzeichnet.
Das Buch ist in zwei Teile gegliedert, zum einen in "Die Scherben in Berlin", zum anderen in die Geschichte der "Die Scherben in Nordfriesland". Jedem Jahr der Bandgeschichte ist ein Kapitel gewidmet, viele Mitglieder und Bekannte der "Scherben-Familie" kommen zu Wort, darunter auch Prominente wie Claudia Roth, die ehemalige Managerin und Paul Breitner, der die Scherben mal am Tempelhofer Ufer besuchte. Diese Interviews sind zumeist sehr gelungen und lassen die Bedeutung erkennen, die viele den Scherben beigemessen haben, und zwar nicht nur als Musiker, sondern gerade auch als "Familie". Deutlich werden zugleich die Spannungen innerhalb der Band und auch zu ihrem Umfeld. Seien es Eifersüchteleien oder der Wäscheberg in der WG, die den Traum vom harmonischen und hierarchielosen Zusammenleben im Alltag scheitern lassen. Aber das Buch illustriert auch, mit wie viel Idealismus und Liebe die Verwirklichung dieses Traums auch gegen die Anfeindungen sowohl des "Establishments" als auch der dogmatischen Linken versucht wurde.
Eindrucksvoll beschrieben wird auch der verzweifelte Kampf Rio Reisers und der Scherben um künstlerischer Anerkennung und auch um die wirtschaftliche Basis ihrer Existenz ("Von hungrigen Rockmusikern hatten weder Marx noch Mao etwas geschrieben. Also gab es sie nicht."). Eine zentrale Rolle spielt natürlich auch die Musik. Die Entstehung sämtlicher Alben wird dargelegt. Man muss allerdings kein eingefleischter Scherben-Fan sein, um dieses Buch zu mögen. Ein Stück deutscher Zeit- und Musikgeschichte wird unterhaltsam und ohne edukatorischen Anspruch beschrieben, und die Lektüre dürfte sowohl Dabeigewesenen wie auch der Generation der Enkel Freude bereiten.
|
||