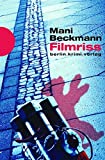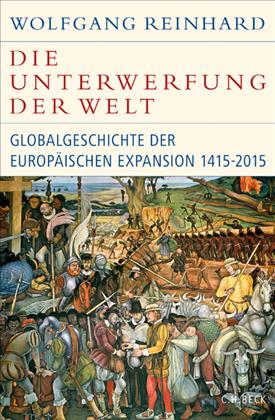Was tun, wenn der Film reißt
Mani Beckmanns kriminalistische Spurensuche im Berlinale-Sumpf der Eitelkeiten
Von Michael Grisko
Wer wünscht sich nicht, einmal Hauptfigur eines Romans zu werden? Für Dieter Koslick, den Leiter der Berlinale, ist der Traum schon nach einem Jahr in Erfüllung gegangen - auch wenn er nur einen Kurzauftritt als Stargast bekommt. Unterhaltsam und ohne die Grenzen zur peinlichen oder selbstverliebten Nabelschau zu überschreiten nutzt der Berliner Journalist und Branchenkenner Mani Beckmann das personelle und atmosphärische Umfeld des größten deutschen Filmfestivals, nicht nur um mit dem Krimi ein Genre zu pflegen, das derzeit im Print- und TV-Bereich garantierten Absatz genießt, sondern auch um gleichzeitig einen Blick auf das sich wandelnde Berlin zwischen den
60er-Jahren, Wiedervereinigung und neuer Gesichtslosigkeit am Beginn des 21. Jahrhunderts zu werfen.
Eine seit den Studienzeiten sorgfältig gepflegte Hassliebe zwischen zwei Filmjournalisten, die gleichzeitig zum Austragungsort unterschiedlicher Publizistik- und Kritikkonzepte wird, eine noch länger zurückliegende Freundschaft, die ihre Verbindung in der Punkmusik zwischen Westfalen und Holland fand, die Pleite eines regionalen Fernsehsenders, eine Briefbombe, ein Junkie in einem Abrisshaus, Liebe und natürlich der Tote in einer Schöneberger-West-Schnösel-Altbauwohnung sind neben dem selbstverständlich etwas schrulligen Kommissar, der kein Blut sehen kann, die würzigen Zutaten einer kriminalistischen Spurensuche im Berlinale-Sumpf der Eitelkeiten. Zwischen dem Kino International, dem Potsdamer Platz, dem SO 36 und Schöneberg dürfen auch die Foto-Calls, die journalistischen Narzissmen, die aufgesetzte Betriebsamkeit eines Festivals und die ganz eigene Stimmung zwischen Wettbewerbsfilm und Forum nicht fehlen. Die Suche nach dem Täter - oder der Täterin, mehr wird hier selbstverständlich nicht verraten wird - auch in der durchgehenden Präsenz vergangener Musikkulturen - zu einer Bestandsaufnahme von Berliner Mentalitäten zu Beginn des 21. Jahrhunderts.
Nun gilt es jedoch schnell allen Mutmaßungen einer soziologischen oder historisch-gesellschaftlichen Programmschrift vorzubeugen, die der Krimi nun wirklich nicht sein will. Branchenkenner werden - Eitelkeits-motiviert - die sicherlich vorhandenen Parallelen zu lebenden Figuren suchen. Aber auch fernab dieser Detailkenntnisse ist es doch spannend zu lesen, wie der Filmriss letztlich zur alkoholgetränkten Metapher wird, der Siegeszug der oberflächlichen Filmpublizistik eingeläutet wird - mit "Mord und Totschlag" - und welche Rolle die "Onanierenden Ordensbrüder" und ein Punkfestival in Holland spielen. Urteil eines Berliners: "Bärig gut!"
P. s.: Dass Beckmann mit der besonderen Hervorhebung von Michael Winterbottom - immerhin der diesjährige Gewinner des Goldenen Bären - ein besonders glückliches Händchen gehabt hat, bleibt, der Chronistenpflicht halber, noch anzumerken.
|
||