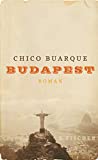Der Geisterschreiber
Chico Buarques Roman "Budapest"
Von Klaus Bonn
Als Don Quixote von seinem Schildknappen Sancho Pansa erfährt, dass bereits ein Buch über die Abenteuer der beiden in Umlauf sei, entgegnet der Ritter, jener Verfasser des Werkes müsse eine Art Zauberer sein. Solchen Leuten bleibe nichts verborgen; sie könnten schreiben, was sie wollten. Damit ist die Idee einer Geisterschreiberei von Gottes Gnaden in die Welt gesetzt. Das einstige Privileg der Himmlischen, über Schicksalstafeln oder ein 'Buch des Lebens' zu verfügen, worin die Geschicke der Irdischen aufgezeichnet stehen, ist in eine besondere menschliche Begabung von Schreibkunst übergegangen, an der Zauber und Magie ihren Anteil haben.
Auch Novalis' Heinrich von Ofterdingen hatte seine Lebensgeschichte in einem rätselhaften Buch vorgefunden, überdies in einer ihm fremden Sprache, so dass er nicht darin zu lesen vermochte - und nicht zuletzt schrieb Arno Schmidt, Novalis' Diktum aufgreifend, unser Leben sei bloß eine Karikatur der großen Romane. In heutiger Zeit zählt die Geisterschreiberei zu den Dienstleistungen, die in den meisten Fällen vertraglich abgesichert sind. Kein Zauber, keine Magie.
Man kann nun die Geschichte um den brasilianischen Ghostwriter José Costa, seine Liebe zur ungarischen Sprache und die Reisen von Rio nach Budapest als gediegene Unterhaltung preisen. Was auch immer dem Erzähler hier und da zustößt, nichts vermag ihm etwas anzuhaben. Er scheint einer jener Unverwüstlichen, denen der Zufall in brenzligen Momenten stets einen Ausweg bereithält. Chico Buarques Roman "Budapest" durchzieht eine auffällige Symmetrie der Verkehrung, die den Rhythmus des Textes beim Lesen entscheidend bestimmt. Die Achse, um die sich das Material des Textes anordnet, bilden die Flüge von Budapest nach Rio und von Rio nach Budapest. Während einer Zwischenlandung in Budapest, nach einem Kongress der anonymen Autoren in Istanbul, betören Costa erstmals die Laute der ungarischen Sprache. Wieder zu Hause, geht er wie gewöhnlich seiner Schreibarbeit nach. Erst über das Gebrabbel seines Sohnes in der Nacht muss er sich eingestehen, dass er selbst in seinen Träumen Ungarisch oder etwas diesem Sprachduktus Ähnliches spricht.
Der Besuch einer Lesung des ungarischen Dichters Kocsis Ferenc im Konsulat bringt Costa die Melodie der fremden Sprache näher. Nachdem er den in Auftrag gegebenen autobiografischen Roman eines deutschen Geschäftsmanns geschrieben hat, beschließt er, nach Budapest zu reisen. Bei Kriska, die er in einer Pester Buchhandlung kennen lernt, nimmt er Sprachunterricht, und über die Sprache verliebt er sich in sie. Das Fehlen aber der anderen Sprache, des Portugiesischen, veranlasst die Rückreise nach Brasilien. Auch hier gibt der Traum die Richtung vor. "Nachdem ich eine Nacht lang meine Sprache gesprochen und geträumt hatte, Kriska spreche Portugiesisch, fand ich nicht mehr die richtige Mundstellung für das Ungarische, wie ein Musiker, der ein Instrument falsch bläst."
Wieder daheim, nach zwei, vielleicht drei Monaten in Budapest, entdeckt Costa im Zeitschriftenständer seiner Frau Vanda das Buch 'Der Frauenschreiber', mit einer Widmung versehen, den Text eben, den er für den Deutschen verfasst hat. Es steht zu vermuten, seine Frau, die beim Fernsehen arbeitet, habe eine Affäre mit dem Fremden gehabt. In einer Silvesternacht bekennt er seiner vom 'Frauenschreiber' schwärmenden Vanda, dass er selbst, José, der Autor sei. Erneut reist Costa nach Budapest ab, für Jahre.
Kriska verschafft ihm eine Arbeit im Literaturklub, wo er den Dienst der Aufnahmeleitung bei Lesungen verrichtet. Mittels Transkriptionen von Tondokumenten bringt sich Costa die ungarische Sprache bei. Eine Begegnung mit Kocsis in der Bibliothek des Klubs regt schließlich Costas Geisterschreiberei, diesmal auf Ungarisch, an. Kocsis' Schaffenskraft scheint zu erlahmen. "Oben auf der ersten Seite, dort, wo er die Feder aufgesetzt hatte, war ein schwarzer Punkt zurückgeblieben. Und ausgehend von diesem Punkt schrieb ich einen Vers, dann noch einen und noch einen. Ich las meine drei Verse und war zufrieden, womöglich waren dies genau die Worte, hinter denen Kocsis Ferenc seit Jahren her war." Da feiert ein divinatorischer Zauber seine Auferstehung. Es entstehen die 'Geheimen Terzette', woraus Costa beim Treffen der anonymen Autoren in Budapest vorliest. Bald darauf wird er, wegen seines illegalen Aufenthaltsstatus, des Landes verwiesen.
Wieder in Rio, stellt sich das Gefühl ein, "in ein Land mit mir nicht bekannter Sprache geraten zu sein, was für mich immer ein schönes Gefühl bedeutete, es war dann so, als begänne das Leben bei null." Die Vorstellung vom gänzlich anderen Leben in der anderen Sprache ist nicht neu, und sie trifft das Ungarische, das Costa nach seiner Ausweisung vergessen möchte, genauso wie zuvor das Portugiesische. "Um die Worte zu vergessen, war es vielleicht notwendig, die ganze Sprache zu vergessen, in der sie gesagt worden waren, so wie man aus einem Haus wegzieht, das uns an einen Toten erinnert." Die letzten zehn Seiten von "Budapest" wirken wie eine märchenhafte Peripetie zu einer schier ausweglos gewordenen Situation. Die Ehefrau Vanda lebt längst ihr eigenes mondänes Leben in São Paulo, der Sohn ist bei den Skins hängen geblieben, die Agentur besteht nicht mehr, der Kollege und Freund Álvaro ist weggezogen. Das Konto ist gesperrt, und Costa traut sich kaum noch aus seinem Hotelzimmer auf die Straße.
Da erreicht ihn ein Anruf aus dem ungarischen Konsulat, er sei von einem großen Budapester Verlagshaus eingeladen, der Flugschein liege schon bereit. Ein Buch mit dem Titel 'Budapest' ist in Ungarn erschienen, sein Autor: Zsoze Kósta, wie José Costa getreu den ungarischen Aussprache- und Schreibregeln heißt. Das Buch avanciert zum Kassenschlager. Ein ominöser Herr ..., dem Costa zuvor schon im Klub, dann bei den Anonymen begegnet ist, und der sich als Kriskas Ex-Ehemann entpuppt, hat den Text geschrieben. "Und so wie meine in seinem Manuskript gefälschte Schrift ähnelte die Geschichte, die er sich ausgedacht hatte, so sehr meiner eigenen, dass sie mir mitunter authentischer schien, als wenn ich sie selbst geschrieben hätte." Zsoze und Kriska finden endlich über die 'Budapest'-Prosa, die sie dermaßen betört, dass er ihr abends im Bett daraus vorlesen muss, zueinander.
Alles wird gut, so scheint es. Die Liebe geht nicht durch den Magen, wie das Sprichwort besagt. Schon Vanda war wie geblendet gewesen von dem 'Frauenschreiber', dem Buch des Deutschen, das ihr Mann geschrieben hat. Buarques Roman bestätigt die Annahme, dass eine erotische Beziehung zum Menschen sich einstellt über das erotische Verhältnis zur Sprache, die er spricht. Wer in einer fremden Sprache spricht oder schreibt, erhält von den Einheimischen einen Bonus des Aparten. Und der Schreiber, der anderen seinen Geist einhaucht, seinen Text übereignet, empfindet selbst eine eigentümliche Lust. Costa bekennt eingangs: "Fremde Namen unter meinen Werken zu sehen bereitete mir ein nervöses Vergnügen, eine Art umgekehrte Eifersucht. Denn für mich war es nicht so, dass der Betreffende sich des von mir Geschriebenen bemächtigte, sondern so, als hätte ich in sein Heft geschrieben." Und an der Liebe zum Schreiben leidet die Liebe zu Personen - hier die Liebe Josés zu Vanda. "Vor lauter Hingabe an mein Handwerk, vor lauter Schreiben und Neuschreiben, Korrigieren und Überarbeiten von Texten, jedes Wort hätschelnd, das ich zu Papier brachte, hatte ich für sie keine schönen Worte mehr übrig." Möglich, dass Kriska bald ein ähnliches Schicksal erleiden muss, sobald Zsozes Ungarisch ihm zur ersten Sprache geworden ist und das Portugiesische einem alten Mauerwerk gleich allmählich verfällt. Doch das steht auf einem anderen Blatt.
Eines bleibt noch zu erwähnen. Dass der Costa zugeschriebene Roman 'Budapest' auf Ungarisch verfasst ist und darum nicht mit Buarques portugiesischem "Budapeste" übereinkommt, ist plausibel. Buarque aber steuert selbst eine Pointe zu dem Roman 'Budapest' seiner Figur Zsoze Kósta bei. Es gibt dieses ungarische Buch 'Budapest' tatsächlich. Noch vor dem portugiesischen Original aus dem Jahr 2003 ist in Ungarn beim Verlag Athenaeum im Jahr 2000 eine Übersetzung von Ferenc Pál erschienen, unter dem Titel "Budapest".