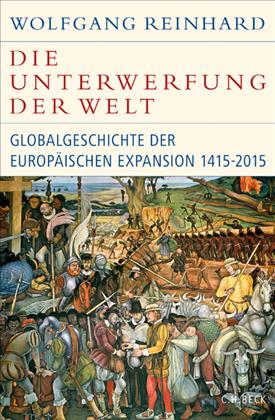Im höheren Luftkreis der Sprache
Walter Benjamins "Écrits français"
Von Christine Blättler
Ab 1933 hielt sich Walter Benjamin während seines Exils in Paris auf. Auch die französische Sprache wurde ihm zunehmend zum Aufenthaltsort, nicht nur in der Lektüre. Er arbeitete stark an Übersetzungen seiner Werke mit, übersetzte sie selbst oder schrieb gleich in Französisch. Der Band mit dem Titel "Écrits français" versammelt dreizehn Artikel und Essays von unterschiedlichem Gewicht, darunter Fragmente der "Berliner Kindheit", den "Kunstwerkaufsatz", "Über Baudelaire", "Paris, Hauptstadt des 19. Jahrhunderts" und "Über den Begriff der Geschichte". Nach seiner Ersterscheinung 1991 in der Reihe "Bibliothèque des Idées" wurde er nun 2003, ebenfalls bei Gallimard, in einem handlichen und preiswerten Band der collection "folio essais" neu aufgelegt. Er ergänzt die dreibändige Ausgabe der "Œuvres" (in derselben Reihe) mit originalen französischen Beiträgen. Eingeleitet und kommentiert vom Philosophen Jean-Maurice Monnoyer, erweitert mit Zeugnissen der Buchhändlerin, Verlegerin und Autorin Adrienne Monnier, der Fotografin Gisèle Freund, die Benjamin mehrfach aufnahm, und Jean Selz, mit dem er sich auf Ibiza anfreundete. Während die französischen Schriften ihr Weiterleben in der Lektüre finden, lassen diese Porträts Benjamin in seiner Exilzeit wieder aufleben.
Was soll eine französische Benjamin-Publikation für ein deutschsprachiges Publikum, das die Originaltexte bestens kennt und mit der Edition der "Gesammelten Werke" vorzüglich bedient ist, mag man sich fragen. Doch wer bedenkt, welchen Stellenwert das Übersetzen für Benjamin hatte, horcht trotzdem auf. Zumal hier Benjamins eigene Übersetzungen und Redigate erstmals versammelt sind, denn in der Gesamtausgabe verstreuen sie sich über die zwölf Bände, zum Teil versteckt im Anmerkungsapparat. Es handelt sich um einen Band, der Übersetzen als Eigenversuch in konzentrierter Form präsentiert. Benjamin kennt beide Seiten und steht hier auf beiden. Die Ansprüche an die Übersetzungen sind so hoch wie an die Originaltexte, nur anders geartet.
Der Verfasser von "Die Aufgabe des Übersetzers" gab seine eigenen Texte kaum aus der Hand, wenn überhaupt arbeitete er mit Vertrauten zusammen. So auch mit Jean Selz an der "Berliner Kindheit". Keine einfache Sache, denn Benjamin ließ seine Übersetzer philologische Seelenqualen erleiden. Auch Pierre Klossowski berichtet in einem Interview, dass er diese schreckliche Woche vergessen wolle, die Benjamin ihm während der letzten Überarbeitung seiner 30-seitigen Übersetzung bereitete. Tag und Nacht hätte er ihn geschunden und sich dabei aufgeführt wie eine hysterische Gouvernante. Benjamin seinerseits war am Ende ganz zufrieden. Klossowski, selbst Philosoph, Literat und bildender Künstler, übersetzte "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit". Veranlasst hat dies Max Horkheimer, der den Text in der "Zeitschrift für Sozialforschung" 1936 in Französisch statt in Deutsch abdrucken wollte, gedacht als Werbung für die Zeitschrift in Frankreich. Selbstverständlich ist dieser Aufsatz auch in den "Écrits français" enthalten.
Es überrascht, welche französischen Übersetzungen es schon zu Benjamins Lebzeiten gegeben und welche seiner Texte er gleich auf französisch geschrieben hat. Verfasst hat er sie meist aus eigenem Antrieb: Aufträge gab es kaum, publiziert wurden die wenigsten. Ein Ausdruck der Not des Exilanten, der immer mehr an den Rand gedrängt wurde. Vielleicht ging das zusammen mit dem Wunsch Benjamins, sich im allerletzten Teil seines Lebens freizuspielen, wie Jean-Maurice Monnoyer vermutet. Er brauchte nun keine Übersetzungshilfe mehr; er sprach in einer geborgten Sprache, deren Vertrautheit er sich erworben hatte. Als hätte er, indem er das Französische annahm, die Sprache des Originalwerks erweitern können.
Auffallend sind die Änderungen, die Benjamin in den französischen Fassungen gegenüber den deutschen vorgenommen hat. Das sieht man am "Kunstwerkaufsatz", der sich während des Übersetzungsprozesses beträchtlich gewandelt hat. Oder an der fünften geschichtsphilosophischen These, die im Deutschen so beginnt: "Das wahre Bild der Vergangenheit huscht vorbei." In Benjamins Übersetzung nimmt der Satz diese Form an: "L'image authentique du passé n'apparaît que dans un éclair." Und anstatt namentlich Gottfried Kellers unbewegliche Wahrheit anzugreifen, taucht in der französischen Version Dante als Bürge auf, wenn es um das unwiederbringliche Bild der Vergangenheit geht.
Die hier vorliegenden Texte laden deshalb besonders zu Nachforschungen ein, die auf Benjamins Übersetzungsverständnis basieren. Dieses geht bekanntlich nicht von semantischen Entsprechungen aus, platte Versionen des Originals sind nicht das Ziel. Vielmehr ist es der Prozess des Übersetzens, der interessiert. Weg von der Vermittlung eines abbildhaften Inhalts ist es der 'eigentümliche Darstellungsmodus', die Form, die das Fortleben eines Werkes in einer anderen Sprache ermöglicht. Nur so kann es nachreifen und auch in einen 'gleichsam höheren und reineren Luftkreis der Sprache hinaufwachsen'. Was auf einen ersten Blick als Mangel an Übereinstimmung mit dem Original erscheinen mag, erhält so seinen eigenen Sinn.
Anmerkung der Redaktion: Christine Blättler ist Mitarbeiterin am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung.
|
||