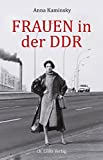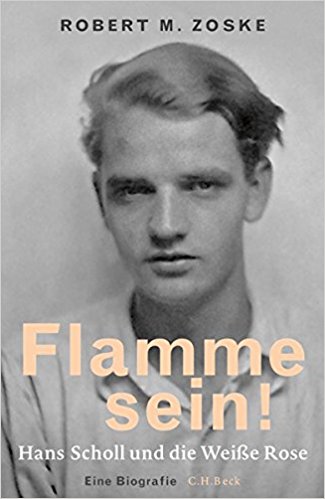Zwischen Tee und Werkbank
Anna Kaminsky über „Frauen in der DDR“
Von Bianca Burger
Das Beste an der DDR seien die Frauen gewesen. Was im Nachhinein zu dieser Aussage verleitete, war die theoretische Gleichberechtigung von Männern und Frauen, die in der Deutschen Demokraten Republik zumindest auf dem Papier die gleichen Rechte und Pflichten hatten. Dieser Ausspruch wird von Anna Kaminsky gleich auf der ersten Seite zitiert und man könnte ihn gleichsam als Motto für den Rest ihres Buches Frauen in der DDR ansehen. Von außen betrachtet waren Frauen in der DDR wirtschaftlich unabhängig, weil sie ihr eigenes Geld verdienen konnten beziehungsweise mussten. Als fortschrittlich und für diese Zeit durchaus ungewöhnlich könnte man in diesem Zusammenhang bezeichnen, dass sie auch so genannte „Männerberufe“ ergriffen. Allerdings erfolgt von Kaminsky zugleich die Einschränkung, dass dies nicht immer aus freien Stücken, sondern auf Wunsch der Staatsführung geschah. Von Seiten des Staates wurde vieles unternommen, um Frauen in das Arbeitsleben zu integrieren, damit auch sie ihren Beitrag zur Gemeinschaft leisteten. Die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen war nur eine Maßnahme, um die notwendige Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Ein Vorhaben, das sich in der Realität allerdings nur schwer umsetzen ließ. Trotz aller Gleichstellungsversuche wurde der familiäre Bereich weiterhin als reine Frauensache angesehen. Die Mehrfachbelastung wurde überwiegend von Frauen getragen; die Gleichberechtigung, die in der DDR theoretisch hätte bestehen sollen, hielt der Alltagsprobe somit nicht stand.
Anna Kaminsky, seit 2001 Geschäftsführerin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, versucht in ihrem Buch die Lebenswelt der Frauen in der DDR nachzuzeichnen. Ein Vorhaben, das auf den ersten Blick ohne weitere Einschränkungen – beispielsweise hinsichtlich sozialer, ethnischer oder auch religiöser Herkunft – geschehen soll. Auch zeitlich erfolgt keine Eingrenzung: Die Autorin nimmt sich vor, die Geschichte von Frauen während der gesamten Zeitspanne der Existenz der DDR auf knapp 250 Seiten zu erforschen. Ein Mammutprojekt, das nur bedingt gelungen ist.
Kaminsky fokussiert sich im Verlauf des Buches auf die Doppelrolle der Frau von Arbeiterin und Hausfrau respektive Mutter, auch wenn sie wiederholt versucht, den Blick auf Aspekte wie Frauen in der Politik/Öffentlichkeit, im kulturellen Bereich und im Sport zu legen. Das generelle Problem ihres Vorhabens ist, eine Gesamtgeschichte der Frauen in der DDR schreiben zu wollen. Es kann dadurch keine differenzierte Betrachtung der unterschiedlichsten Themenfelder erfolgen, weshalb sich die Autorin oft in Verallgemeinerungen flüchtet. Das Herzstück der Frauen- und Geschlechtergeschichte ist es, Geschlecht als relationale Kategorie zu verstehen, um dadurch genau solchen Verallgemeinerungen vorzubeugen. Etwas, das die Verfasserin anfänglich auch versucht, indem sie darauf hinweist, dass sich die Lebensrealitäten der Frauen in der DDR im Laufe der Zeit verändert haben und sich voneinander unterschieden. Bedauerlicherweise verliert sich dieser Blick und damit die differenzierte Herangehensweise im Laufe des Buches. An ihre Stelle treten Pauschalisierungen, ein unreflektierter Umgang mit Begriffen wie „Männerberufe“ oder „traditionelle Frauen“ sowie Unklarheiten, von welchem Jahr oder Jahrzehnt gerade gesprochen wird. Dies ist umso beklagenswerter, weil die Autorin anfänglich selbst noch auf die Bedeutung der unterschiedlichen Jahrzehnte für die Geschichte hinweist. Ebenso geht Kaminsky offenbar davon aus, dass Frauen automatisch Verständnis für ihre Geschlechtsgenossinnen haben müssten, beispielsweise wenn sie davon spricht, dass es selbst bei westdeutschen Frauen oft an Verständnis für die Belastungen, welchen die ostdeutschen Frauen nach 1990 ausgesetzt waren, fehle.
Frauen in der DDR gliedert sich in mehrere Über- und Unterkapitel, wobei die Kapitel als in sich geschlossen verstanden werden können. Den Beginn macht ein Abschnitt über Frauen in Politik und Öffentlichkeit, bevor sich die Autorin auf die Mehrfachbelastung zwischen Arbeit, Mutter beziehungsweise Ehefrau konzentriert. Es folgt ein Abschnitt über Frauen in Literatur, Film und Sport, bevor sich Kaminsky abermals der Politik zuwendet – diesmal liegt der Fokus jedoch auf den Repressionen, politischer Verfolgung und Opposition. Abgeschlossen wird das Buch mit einem Ausblick auf ostdeutsche Frauen nach 1989. Obwohl sich die jeweiligen Abschnitte im Umfang kaum voneinander unterscheiden, ist der Gehalt und Aussagewert derselben sehr unterschiedlich. Der Fließtext wird wiederholt durch Bilder unterbrochen, die jedoch oft nur lose an den Inhalt anknüpfen. In diesem Fall helfen die Bildunterschriften bei der thematischen Zuordnung. Ähnlich verhält es sich mit den zahlreichen Frauenbiografien, die als eine Art Exkurs und ebenfalls optisch deutlich hervorgehoben den Text durchbrechen. Zusätzlich finden sich im gesamten Buch vermehrt grafisch hervorgehobene Zitate, die dem Leser und der Leserin sofort ins Auge stechen. Kritisch muss hier angemerkt werden, dass diese Textstellen aus unterschiedlichsten Medien wie beispielsweise Zeitungen, Romanen, Filmen und Broschüren stammen und meist unkommentiert und unreflektiert verwendet werden. Positiv hervorzuheben ist der umfangreiche Anhang, in dem sich neben dem Verzeichnis der Verweise und der Literatur zudem eine Sammlung an Beschlüssen, Verordnungen und Gesetzen zur Förderung der Frau in der DDR findet.
Jeder Aspekt, der von Kaminsky angesprochen wird, könnte umfassender, für sich genommen aufgearbeitet und erschlossen werden. Das Potenzial, das in diesem Themenkomplex steckt, wird auch von der Autorin selbst erkannt. Sie weist darauf hin, dass beispielsweise die Geschichte der Frauen, die aus politischen Gründen in der DDR verfolgt wurden, noch weitestgehend unerforscht ist.
Als Fazit kann festgehalten werden, dass Frauen in der DDR für interessierte Laien als Einstiegslektüre dienen kann, jedoch zur wissenschaftlichen oder eingehenderen Beschäftigung inhaltlich nicht das nötige Maß an kritischer Reflexion bietet. Man kann nur hoffen, dass es Kaminsky mit ihrem Buch zumindest gelingt, offene Fragen in der Geschichte der Frauen in der DDR bekannter zu machen, damit diese in Zukunft eingehender bearbeitet werden können.
|
||