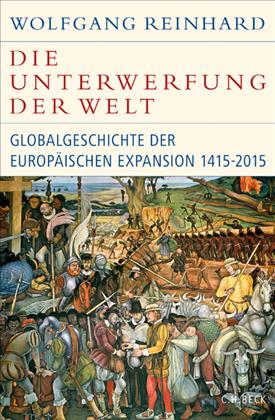XII
Ja! eine Sonne ist der Mensch,
allsehend, allverklärend, wenn er liebt,
und liebt er nicht,
so ist er eine dunkle Wohnung,
wo ein rauchend Lämpchen brennt.
Friedrich Hölderlin
(Aus: Hyperion)
Philosophie und Dichtung hatten euch zueinander geführt. Euer Dichter, auf dessen Spuren ihr seid, sah beides als Einheit. Seinen Hyperion lässt er sagen, die Dichtung sei „der Anfang und das Ende aller Philosophie“. Eine interessante These, findest du. Dein bisheriges Leben – oder war es streckenweise mehr ein Gelebt-Werden? – hat dir für derlei Gedanken nicht viel Zeit gelassen. Gewissermaßen ausgehungert stürzt du dich nun auf alles, woran es dir bislang mangelte. Die Briefe deines Philosophenfreundes wurden zur Startbahn für Höhenflüge. Kein Bodenkontakt mehr. In keinerlei Hinsicht. Geht Erotik zuweilen über den Kopf? Wer weiß es! Was brachte den Funken zum Entflammen? Es begann mit einem sehr alten Gedicht aus der Zeit der Minnelieder, in schönstem Mittelhochdeutsch. „Bleibe mir erhalten!“, hattest du einmal schlicht geschrieben und erhieltest als Antwort:
Dû bist mîn, ich bin dîn,
des solt dû gewis sîn.
dû bist beslozzen
in mînem herzen,
verlorn ist das sluzzelîn:
dû muost ouch immêr darinne sîn.
Du kanntest dies zuvor nicht – oder konntest dich nicht mehr daran erinnern. Immerhin soll es sich hier um das bekannteste Liebeslied des Mittelalters handeln. Es stammt aus der Tegernseer Briefsammlung, der Verfasser gilt als unbekannt. Was war es, das dich daran so besonders angerührt hatte? Die Schlichtheit der Aussage, mit der alles gesagt ist, was die Verbindung zweier Menschen vor tausend Jahren kennzeichnete, über die ihr ansonsten nichts wissen könnt? Hatte sie ähnlich begonnen wie eure? Als zärtliche Freundschaft, die nichts vom anderen forderte? Nun allerdings hatte dies Gedicht ein Gefühl der Wärme im Innersten hinterlassen, von der Art, die sich in Wellen über den ganzen Körper auszubreiten vermag, und du bist – hier ganz Schwäbin – viel zu geizig mit dieser Kostbarkeit, als dass du zulassen wolltest, dass sie einfach so wieder verschwinden sollte.
Diotima nannte er dich zuweilen. Da kam nun euer Dichter wieder ins Spiel: Die Gestalt der Diotima im „Hyperion“. Die literarische Entsprechung der Susette Gontard in des Dichters wirklichem Leben. Eine unglückliche Liebe. Aber was heißt eigentlich unglücklich? Wer legt denn solches fest und maßt sich an, über Glück und Unglück zu befinden? Wer will ausschließen, dass eine aus gewöhnlicher Sicht unglückliche Verbindung nicht Glücksmomente kannte, die andere in vermeintlich glücklichen Beziehungen möglicherweise nie erfahren? Dem Vergleich mit einer Susette Gontard würdest du allerdings nicht standhalten. Vor allem ist dir deren Maß an Leidensfähigkeit geradezu unheimlich. Gewiss ist solches in erster Linie der Zeit und ihren Umständen geschuldet. Die Ohnmacht der Frauen, die durch ihre rechtlose Stellung vor die Wahl gestellt waren, entweder eine solche Liebe aufzugeben und unter Verzicht auf die eigenen Bedürfnisse in einem Leben auszuharren, das ihnen ganz und gar verkehrt erschien, oder jegliche Sicherheit und Lebensgrundlage und obendrein die eigenen Kinder zu verlieren. Eine Vorstellung von Lebendig-begraben-Sein, die dich das Grauen lehrt!
Eher nennst du dich doch im Laufe eurer Korrespondenz „Bettine“, nach der Bettine von Arnim, geborene Brentano, Schwester des Clemens. Sie steht dir näher. Ihre Ungeduld, ihre Unbedingtheit, ihre Neigung zur Grenzüberschreitung. Ihr Briefwechsel mit dem von deinem Philosophenfreund wiederum so sehr verehrten Goethe. Bettine, die Hölderlin hoch schätzte und ihn gegen die kursierenden Aussagen über seine vermeintliche Verrücktheit in Schutz nahm. Wenngleich es sich nicht mehr ergab, dass die beiden sich persönlich begegneten, was einst ihr glühender Wunsch war. In ihrem erst in späteren Jahren literarisch aufbereiteten und veröffentlichten Briefwechsel mit Karoline von Günderrode schrieb sie über ihn:
Die Gedichte, die mir St. Clair (Sinclair) von ihm vorlas … ach was ist doch die Sprache für ein heilig Wesen. Er war mit ihr verbündet, sie hat ihm ihren heimlichsten innigsten Reiz geschenkt, nicht wie dem Goethe durch die unangetastete Innigkeit des Gefühls, sondern durch ihren persönlichen Umgang. So wahr! Er muss die Sprache geküsst haben. – Ja so geht’s, wer mit den Göttern zu nah verkehrt, dem wenden sie’s zum Elend.
Bettine von Arnim
(Aus: Die Günderode)
Bettine. Mit ihr identifizierst du dich, trägst sie als Schutzschild vor dir her, erlaubst dir jede Kühnheit in ihrem Namen, schlägst in demselben über die Stränge. Zitierst sie gar bei wenig literarischen Anlässen, wie bei öffentlichen Reden, die du, von Natur nicht mit allzu viel Selbstsicherheit ausgestattet, unverhofft immer öfter zu halten hast, weil etwas davon abhängt und deine Mitstreitenden Hoffnung in dich gesetzt haben. Wer stünde dir in diesem Fall näher als Bettine?
Was aber der Mut erwirbt, das ist immer Wahrheit, was den Geist verzagen macht, ist Lüge. Verzagtheit im Geist ist gespensterhaft und macht Furcht. Selbstdenken ist der höchste Mut.
Bettine von Arnim
(Aus: Die Günderrode)
Du fühlst eine eigenartige Kraft von ihr auszugehen, die sich auf dich und manchmal in diesem Zuge auch auf andere überträgt. Gewissermaßen gefährlich für dich, denn es fällt immer schwerer, aus solchen Sphären wieder hinunterzugelangen und den sprichwörtlichen Bodenkontakt wiederzufinden. Und du ertappst dich dabei, dass du das eigentlich nicht mehr willst, dass du schon lange genug hast vom „Boden der Tatsachen“, auf den du dich nach Meinung anderer gefälligst zurückzubegeben hast. Überhaupt kann so etwas ja nur mit einer Bruchlandung enden und nach einer solchen steht dir nicht der Sinn! Trägst ja noch die Narben von früheren mit dir herum!
Den Hyperion werdet ihr – dein Philosophenfreund und du – gemeinsam lesen, er wird euch für einige Zeit begleiten.
„Wer bloß an meiner Pflanze riecht, der kennt sie nicht, und wer sie pflückt, bloß, um daran zu lernen, kennt sie auch nicht“.
Du hörst ihn gern vorlesen, liebst es einzutauchen in den warmen Klang seiner Stimme. Deren rheinische Färbung tut all dem nichts, ganz im Gegenteil. Genießt es, dich an seiner Seite zu versenken in die Schönheit der Sprache dieses Werks. Manchmal geschieht es, dass sich die beruhigende Wirkung allzu schnell einstellt und dich vorübergehend in den Schlaf sinken lässt. Womit dir allerdings zu deinem Leidwesen manches des Vorgelesenen entgeht. Gewöhnlich bemerkt er es rechtzeitig, du erwachst von seiner unendlich sanften Berührung, siehst seinen Blick voller Zärtlichkeit auf dir ruhen. „Schon um dieser Augen-Blicke willen…“, denkst du.
„Nun lies du vor!“, sagt er. Und du willst zunächst nicht, findest tausend Ausreden, sagst, du könntest das nicht, du seist immer zu schnell, zu ungeduldig, würdest dich ständig verhaspeln, fürchtest, dein Lesen würde neben seinem nicht bestehen. Er lächelt nur, lässt es nicht gelten. Du fasst dir ein Herz, fängst an zu lesen:
„Eines zu sein mit Allem, das ist Leben der Gottheit, das ist der Himmel des Menschen.“
Und merkst: Was immer du als Ausflucht angeführt hattest, es stimmt alles nicht, erweist sich als haltlos. Du wirst ruhiger, sicherer und beginnst, Gefallen zu finden am unvergleichlichen Rhythmus und den Bildern dieser Sprache:
„O ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt.“
Aus Bettina Johl: Holunderblüten. Zwei Liebende auf den Spuren Hölderlins. Roman. Erschienen 2020 als Sonderausgabe von literaturkritik.de. Seit dem 20.12.2020 auch als E-Book (PDF) erhältlich.