Informationen über das Buch
|
||
Rezensionen von literaturkritik.de
Zur Zeit sind keine Rezensionen in literaturkritik.de vorhanden.
Rezensionen unserer Online-Abonnenten
Andere Rezensionen
Google-Suche in von uns ausgewählten Rezensionsorganen
Klappentext des Verlages
Aus Lucian Freud, Sigmund Freuds Enkel, ist inzwischen ebenfalls "der Freud" geworden:
der Maler, der das "Portrait" neu definiert und mit seiner enormen Ausdruckskraft die
figurative Malerei durchgängig fest etabliert hat. Enthusiastisch gefeiert und heftig umstritten gilt er als einer der bedeutendsten Gegenwartskünstler der Welt.
Mit erzählerischer Leichtigkeit verknüpft die Autorin Kunst, Zeitgeschichte und
Psychoanalyse, um Lucian Freuds Arbeitsweise, sein Lebenswerk und seine großen Erfolge
auf dem Kunstmarkt darzustellen und seine künstlerische Entwicklung zu reflektieren.
Leseprobe vom Verlag
Der Beginn einer langen Freundschaft:
Lucian Freud und Francis Bacon
Von Ingrid Lange-Schmidt
Sucht man nach Personen, die für die persönliche und die künstlerische Entwicklung des jungen Erwachsenen Lucian Freud von Bedeutung sind, so stößt man unweigerlich auf Francis Bacon, einen im Londoner Stadtteil Kensington arbeitenden irischen Maler, der menschlich und künstlerisch als ausgesprochen markante Persönlichkeit gilt.
Freund, Kollege, Vorbild, Gönner
Lucian Freud lernt den dreizehn Jahre älteren Francis Bacon 1944 über den Maler Graham Sutherland kennen, der Bacon für den „besten Maler Englands“ hält. Bacon und Freud verbindet beide das Interesse an der Darstellung der menschlichen Figur, bald aber auch die Lust an ausgedehnten Kneipentouren, die regelrecht berüchtigt sind. Von dem fast überzogen extrovertierten Bacon lernt Freud nach eigener Aussage, „wie man beflügelt durchs Leben geht, wie man Risiken eingeht, wie man sich dem Zufall annähert, und wie man die Norm durchbricht.“ Bacon prägt dafür den Ausdruck „Sensualität des Verrats“. Freud ist sofort von Bacons Persönlichkeit und von dessen Arbeitsweise, auch seinen Provokationen, beeindruckt. Er holt sich von ihm Anregungen und lernt von dessen forscher Vorgehensweise. Man kann sich vorstellen, dass er sich ganz gern zu einem Künstler entwickelt, der rückblickend von seinem Kollegen Bruce Bernhard als ein Mann mit „exotischer und irgendwie dämonischer Aura“ beschrieben wird.
Der junge Freud ist aber auch von Bacon als Künstler enorm fasziniert: „Francis (...) hatte Ideen, die er umsetzte und dann zerstörte und dann rasch erneut umsetzte. Es war seine Einstellung, die ich bewunderte. Diese absolute Unerbittlichkeit seinen eigenen Arbeiten gegenüber.“ Weil er Bacon akzeptiert, kann er von ihm auch Kritik an seinem Verhalten annehmen: „Ich war damals oft in Schlägereien verwickelt. Nicht, weil es mir besonders Spaß gemacht hat. Aber die Leute sagten Dinge zu mir, auf die für mein Empfinden die einzige Antwort war, sie zu verprügeln. Wenn Francis dabei war, sagte er immer: ,Meinst du nicht, dass du versuchen solltest, deinen Charme spielen zu lassen?’ Und ich dachte ,Naja, vielleicht...’ Vorher hatte ich mir über mein ,Verhalten’ als solches eigentlich keine Gedanken gemacht. Ich dachte nur darüber nach, was ich tun wollte, und tat es. Und oft wollte ich die Leute verprügeln. Francis belehrte mich in keiner Weise. Aber man kann sagen, wenn man als erwachsener Mensch auf jemanden losgeht, dann ist das wirklich ein Armutszeugnis, nicht wahr? Ich meine, man muss einen anderen Weg finden, damit umzugehen.“
Die Auseinandersetzung mit Bacon als Persönlichkeit und als Maler bestimmt über sehr lange Zeit Freuds Leben und seine Malerei. Beide verbindet neben Schulabbrüchen, vielen Trennungen und Todesfällen im privaten Umkreis nun der unbedingte Wille, sich künstlerisch auszudrücken. Obwohl Bacon als Jugendlicher nur rudimentäre Schulbildung genossen hat, gilt er inzwischen als belesener Intellektueller. Künstlerisch ist er ein völliger Autodidakt, aber zur Zeit ihrer Begegnung ist Bacon in England schon eine Bekanntheit. Er hat mit seinen Gemälden auf Ausstellungen bereits viel Erfolg und damit auch keine finanziellen Sorgen mehr. Während ihrer Freundschaft lernt Freud Bacons ungewöhnliche Arbeits- und Selbstdisziplin kennen und übernimmt sie. Er setzt sich bald mit dessen zentralen Themen Gewalt, Zerstörung, Verfall, Existenz ohne Sinn und Erlösung teilweise auch in eigenen Bildern, aber auf ganz andere Art, auseinander. Jeden Nachmittag trifft er sich mit Bacon, und nachts zieht er mit ihm durch die Pubs und die Spielhöllen – Freud gilt als Spieler, der nicht selten einiges Geld verliert. Gelegentlich ist er dann darauf angewiesen, von Bacons Generosität zu profitieren: „Damals sagte er einfach: ,Ich habe eine ganze Menge von denen hier’ – ein Bündel Geldscheine – ,ich dachte, du würdest gern ein paar haben.’ Für mich waren damit die nächsten drei Monate gerettet.“
Eigener Aufstieg
1951 wird zu einem Erfolgsjahr für Lucian Freud. Er gewinnt mit seinem Bild „Interior at Paddington, 1951“, einem Beitrag zum Festival of Britain, den „Purchase Prize“ des Art Council of Great Britain. Auf dem Gemälde stellt er seinen Freund Harry Diamond dar, der schäbig, blass und angespannt mit gerunzelter Stirn, geballter Faust und Zigarette in einem kargen Raum steht. Er starrt auf eine im Vordergrund stehende vertrocknende Zimmerpalme und scheint mit seinen Lebensumständen zu hadern. Gesicht und Körperhaltung strahlen dabei deutliches Unbehagen aus. Mit der hohen Anerkennung für dieses Ölgemälde festigt Freud nun seinen Ruf, die inneren Zustände eines Menschen auf die Leinwand bannen zu können. Aufgrund eigener schmerzlicher Erfahrungen ist er vermutlich sehr empfänglich für die Wahrnehmung dieser Stimmungen – und möglicherweise wählt er seine Modelle sogar entsprechend seiner eigenen Stimmungslage aus.
Ein weiteres Bild, das sofort von der Kritik begeistert aufgenommen wird, ist ein Brustbild seines Malerkollegen und Illustrators Minton: „Portrait of John Minton, 1952“. Mit feinem Pinselstrich realistisch dargestellt, auffällig durch sehr subtil gemalte Augen und einen leeren Blick, überträgt sich das im Gesichtsausdruck vermittelte tiefe Unglücklichsein direkt auf den Betrachter. Wegen dieser Darstellung des seelischen Zustandes eines Menschen gilt auch dieses Minton-Portrait sofort als Meisterwerk. Es ist ein Bild, von dem man sich aufgrund des dargestellten Gefühlsinhalts abwenden möchte, das gleichzeitig aber durch die Art der Darstellung fesselt – eine Wirkung, die Freud auch mit seinen späteren Bildern immer wieder auslöst.
Jahrzehnte hinweg bleiben Freud und Bacon gut befreundet und arbeiten künstlerisch zusammen. Mehrfach portraitieren sie sich gegenseitig. So ist z.B. das erste Portrait Bacons, das sich auch im Titel auf eine bestimmte Person bezieht und daher in seinen Werken eine hervorgehobene Bedeutung erlangt, sein lebensgroßes „Portrait of Lucian Freud, 1951“. Bacon malt dieses Portrait, ohne dass Freud überhaupt Modell sitzen muss: Als figürliche Vorlage nutzt er eine Postkarte mit einer Fotografie von Kafka – leider gibt es keine Mitteilung darüber, welche Assoziationen zu dieser Auswahl geführt haben.
Anschließend sitzt Bacon selbst Modell bei seinem Freund für dessen Portrait „Francis Bacon, 1952“. Es entsteht ein winzige Ölbild (17,8 x 12,8 cm), das anschließend von der Tate Gallery erworben wird. Es gilt aufgrund der Intensität des dargestellten emotionalen Zustandes sofort als eines der bedeutendsten Portraits des 20. Jahrhunderts.
Diese beiden gegenseitigen Portraits sind wesentlich dafür, dass beide gemeinsam mit Ben Nicholson im Jahr 1954 eingeladen werden, Großbritannien im britischen Pavillon auf der 27. Biennale in Venedig zu repräsentieren. Auf dieser Biennale schafft Bacon seinen Durchbruch und wird international gefeiert. Trotz geringeren Erfolges ist diese Einladung zur Biennale aber auch für Freud sehr wichtig. Das Auswahlkomitee wählt achtzehn seiner eingereichten Bilder aus, darunter „Girl with a White Dog, 1950–1951“, „Girl with Roses, 1947–1948“ und das Stillleben „Bananas, 1953“. Somit kann er sich bereits im Alter von 32 Jahren als Künstler über England hinaus einen Namen machen.
Es ist in diesem Zusammenhang anzunehmen, dass es für Freud von großer Bedeutung ist, dass Francis Bacon sein lebensgroßes „Portrait of Lucian Freud, 1951“, das auf der Biennale gezeigt wird, mit Freuds Namen betitelt hat, da es ein deutliches „Gesehen-Werden“ und auch veröffentlichte Anerkennung zeigt. Freud nennt vielleicht auch deswegen später Modelle aus dem nicht öffentlichen Raum, die ihm viel bedeuten, im Titel seiner Werke.
(Um Fußnoten gekürzter Ausschnitt aus dem Kapitel „Auseinandersetzung mit Bacon“ aus dem Buch von Lange-Schmidt: Lucian Freud. Viel mehr als nur "der Enkel'' - Aspekte einer künstlerischen Entwicklung. LIT Verlag, Münster 2010. Veröffentlichung auf dieser Seite mit freundlicher Genehmigung der Autorin)
Informationen über den Autor
Informationen über Ingrid Lange-Schmidt in unserem Online-Lexikon

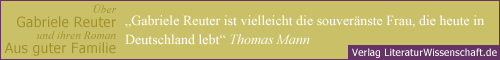



 Lade Rezensionen ...
Lade Rezensionen ...






